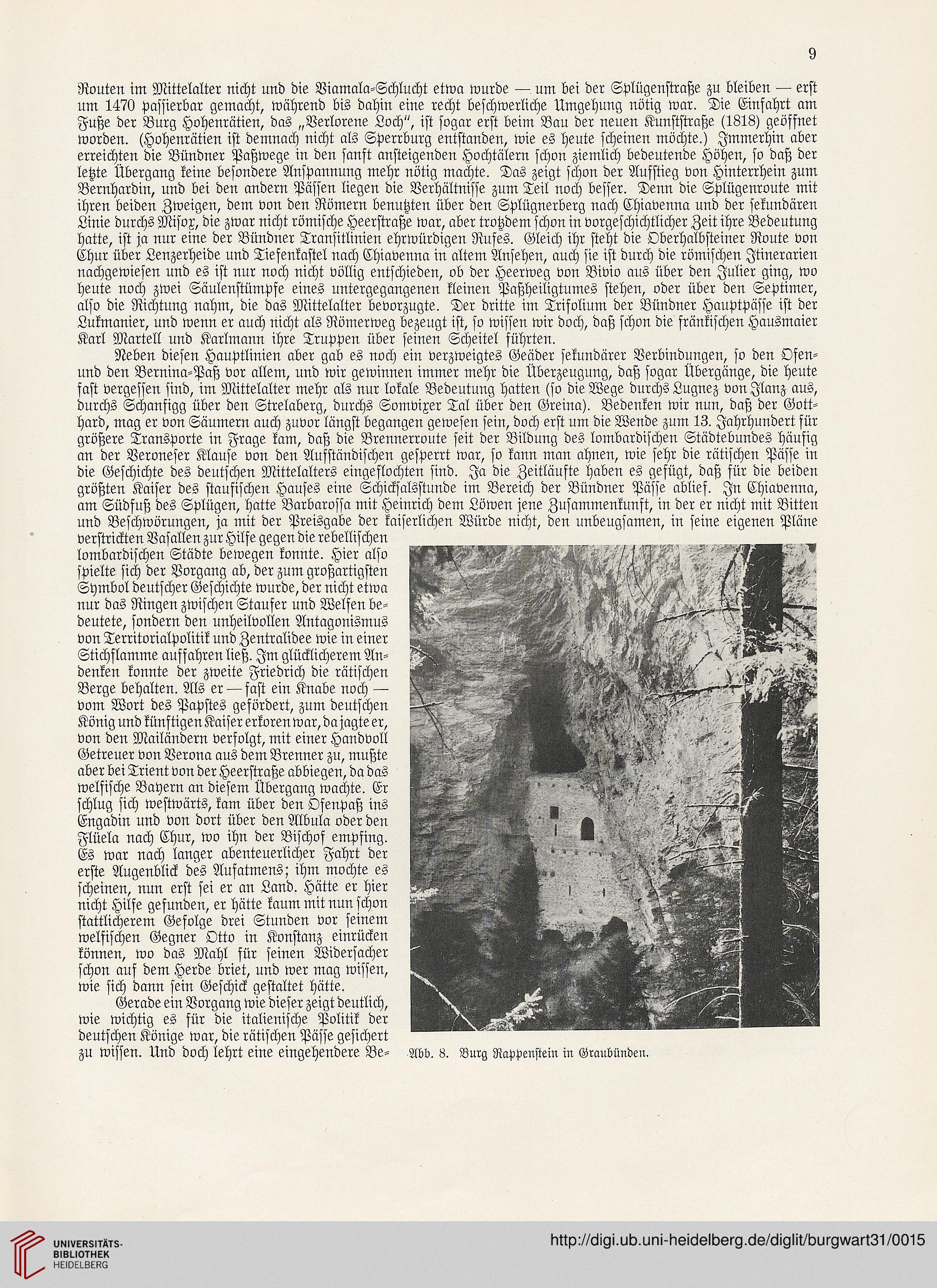9
Routen im Mittelalter nicht und die Viamala-Schlucht etwa wurde — um bei der Splügenstraße zu bleiben — erst
um 1470 passierbar gemacht, während bis dahin eine recht beschwerliche Umgehung nötig war. Die Einfahrt am
Fuße der Burg Hohenrätien, das „Verlorene Loch", ist sogar erst beim Bau der neuen Kunststraße (1818) geöffnet
worden. (Hohenrätien ist demnach nicht als Sperrburg entstanden, wie es heute scheinen möchte.) Immerhin aber
erreichten die Bündner Paßwege in den sanft ansteigenden Hochtälern schon ziemlich bedeutende Höhen, so daß der
letzte Übergang keine besondere Anspannung mehr nötig machte. Das zeigt schon der Aufstieg von Hinterrhein zum
Bernhardin, und bei den andern Pässen liegen die Verhältnisse zum Teil noch besser. Denn die Splügenroute mit
ihren beiden Zweigen, dem von den Römern benutzten über den Splügnerberg nach Chiavenna und der sekundären
Linie durchs Misox, die zwar nicht römische Heerstraße war, aber trotzdem schon in vorgeschichtlicher Zeit ihre Bedeutung
hatte, ist ja nur eine der Bündner Transitlinien ehrwürdigen Rufes. Gleich ihr steht die Oberhalbsteiner Route von
Chur über Lenzerheide und Tiefenkastel nach Chiavenna in altem Ansehen, auch sie ist durch die römischen Jtinerarien
nachgewiesen und es ist nur noch nicht völlig entschieden, ob der Heerweg von Bivio aus über den Julier ging, wo
heute noch zwei Säulenstümpfe eines untergegangenen kleinen Paßheiligtumes stehen, oder über den Septimer,
also die Richtung nahm, die das Mittelalter bevorzugte. Der dritte im Trifolium der Bündner Hauptpässe ist der
Lukmanier, und wenn er auch nicht als Römerweg bezeugt ist, so wissen wir doch, daß schon die fränkischen Hausmaier
Karl Martell und Karlmann ihre Truppen über seinen Scheitel führten.
Neben diesen Hauptlinien aber gab es noch ein verzweigtes Geäder sekundärer Verbindungen, so den Ofen-
und den Bernina-Paß vor allem, und wir gewinnen inrmer mehr die Überzeugung, daß sogar Übergänge, die heute
fast vergessen sind, im Mittelalter mehr als nur lokale Bedeutung hatten (so die Wege durchs Lugnez von Jlanz aus,
durchs Schanfigg über den Strelaberg, durchs Somvixer Tal über den Greina). Bedenken wir nun, daß der Gott-
hard, mag er von Säumern auch zuvor längst begangen gewesen sein, doch erst um die Wende zum 13. Jahrhundert für
größere Transporte in Frage kam, daß die Brennerroute seit der Bildung des lombardischen Städtebundes häufig
an der Veroneser Klause von den Aufständischen gesperrt war, so kann man ahnen, wie sehr die rätischen Pässe in
die Geschichte des deutschen Mittelalters eingeflochten sind. Ja die Zeitläufte haben es gefügt, daß für die beiden
größten Kaiser des staufischen Hauses eine Schicksalsstunde im Bereich der Bündner Pässe ablief. In Chiavenna,
am Südfuß des Splügen, hatte Barbarossa mit Heinrich dem Löwen jene Zusammenkunft, in der er nicht mit Bitten
und Beschwörungen, ja mit der Preisgabe der kaiserlichen Würde nicht, den unbeugsamen, in seine eigenen Pläne
verstrickten Vasallen zur Hilfe gegen die rebellischen
lombardischen Städte bewegen konnte. Hier also
spielte sich der Vorgang ab, der zum großartigsten
Symbol deutscher Geschichte wurde, der nicht etwa
nur das Ringen zwischen Staufer und Welfen be-
deutete, sondern den unheilvollen Antagonismus
von Territorialpolitik und Zentralidee wie in einer
Stichflamme auffahren ließ. Im glücklicherem An-
denken konnte der zweite Friedrich die rätischen
Berge behalten. Als er — fast ein Knabe noch —
vom Wort des Papstes gefördert, zum deutschen
König und künftigen Kaiser erkoren war, da jagte er,
von den Mailändern verfolgt, mit einer Handvoll
Getreuer von Verona aus dem Brenner zu, mußte
aber bei Trient von der Heerstraße abbiegen, da das
welfische Bayern an diesem Übergang wachte. Er
schlug sich westwärts, kam über den Ofenpaß ins
Engadin und von dort über den Albula oder den
Flüela nach Chur, wo ihn der Bischof empfing.
Es war nach langer abenteuerlicher Fahrt der
erste Augenblick des Aufatmens; ihm mochte es
scheinen, nun erst sei er an Land. Hätte er hier
nicht Hilfe gefunden, er hätte kaum mit nun schon
stattlicherem Gefolge drei Stunden vor seinem
wölfischen Gegner Otto in Konstanz einrücken
können, wo das Mahl für seinen Widersacher
schon auf dem Herde briet, und wer mag wissen,
wie sich dann sein Geschick gestaltet hätte.
Gerade ein Vorgang wie dieser zeigt deutlich,
wie wichtig es für die italienische Politik der
deutschen Könige war, die rätischen Pässe gesichert
zu wissen. Und doch lehrt eine eingehendere Be- Abb. 8. Burg Rappenstein in Graubünden.
Routen im Mittelalter nicht und die Viamala-Schlucht etwa wurde — um bei der Splügenstraße zu bleiben — erst
um 1470 passierbar gemacht, während bis dahin eine recht beschwerliche Umgehung nötig war. Die Einfahrt am
Fuße der Burg Hohenrätien, das „Verlorene Loch", ist sogar erst beim Bau der neuen Kunststraße (1818) geöffnet
worden. (Hohenrätien ist demnach nicht als Sperrburg entstanden, wie es heute scheinen möchte.) Immerhin aber
erreichten die Bündner Paßwege in den sanft ansteigenden Hochtälern schon ziemlich bedeutende Höhen, so daß der
letzte Übergang keine besondere Anspannung mehr nötig machte. Das zeigt schon der Aufstieg von Hinterrhein zum
Bernhardin, und bei den andern Pässen liegen die Verhältnisse zum Teil noch besser. Denn die Splügenroute mit
ihren beiden Zweigen, dem von den Römern benutzten über den Splügnerberg nach Chiavenna und der sekundären
Linie durchs Misox, die zwar nicht römische Heerstraße war, aber trotzdem schon in vorgeschichtlicher Zeit ihre Bedeutung
hatte, ist ja nur eine der Bündner Transitlinien ehrwürdigen Rufes. Gleich ihr steht die Oberhalbsteiner Route von
Chur über Lenzerheide und Tiefenkastel nach Chiavenna in altem Ansehen, auch sie ist durch die römischen Jtinerarien
nachgewiesen und es ist nur noch nicht völlig entschieden, ob der Heerweg von Bivio aus über den Julier ging, wo
heute noch zwei Säulenstümpfe eines untergegangenen kleinen Paßheiligtumes stehen, oder über den Septimer,
also die Richtung nahm, die das Mittelalter bevorzugte. Der dritte im Trifolium der Bündner Hauptpässe ist der
Lukmanier, und wenn er auch nicht als Römerweg bezeugt ist, so wissen wir doch, daß schon die fränkischen Hausmaier
Karl Martell und Karlmann ihre Truppen über seinen Scheitel führten.
Neben diesen Hauptlinien aber gab es noch ein verzweigtes Geäder sekundärer Verbindungen, so den Ofen-
und den Bernina-Paß vor allem, und wir gewinnen inrmer mehr die Überzeugung, daß sogar Übergänge, die heute
fast vergessen sind, im Mittelalter mehr als nur lokale Bedeutung hatten (so die Wege durchs Lugnez von Jlanz aus,
durchs Schanfigg über den Strelaberg, durchs Somvixer Tal über den Greina). Bedenken wir nun, daß der Gott-
hard, mag er von Säumern auch zuvor längst begangen gewesen sein, doch erst um die Wende zum 13. Jahrhundert für
größere Transporte in Frage kam, daß die Brennerroute seit der Bildung des lombardischen Städtebundes häufig
an der Veroneser Klause von den Aufständischen gesperrt war, so kann man ahnen, wie sehr die rätischen Pässe in
die Geschichte des deutschen Mittelalters eingeflochten sind. Ja die Zeitläufte haben es gefügt, daß für die beiden
größten Kaiser des staufischen Hauses eine Schicksalsstunde im Bereich der Bündner Pässe ablief. In Chiavenna,
am Südfuß des Splügen, hatte Barbarossa mit Heinrich dem Löwen jene Zusammenkunft, in der er nicht mit Bitten
und Beschwörungen, ja mit der Preisgabe der kaiserlichen Würde nicht, den unbeugsamen, in seine eigenen Pläne
verstrickten Vasallen zur Hilfe gegen die rebellischen
lombardischen Städte bewegen konnte. Hier also
spielte sich der Vorgang ab, der zum großartigsten
Symbol deutscher Geschichte wurde, der nicht etwa
nur das Ringen zwischen Staufer und Welfen be-
deutete, sondern den unheilvollen Antagonismus
von Territorialpolitik und Zentralidee wie in einer
Stichflamme auffahren ließ. Im glücklicherem An-
denken konnte der zweite Friedrich die rätischen
Berge behalten. Als er — fast ein Knabe noch —
vom Wort des Papstes gefördert, zum deutschen
König und künftigen Kaiser erkoren war, da jagte er,
von den Mailändern verfolgt, mit einer Handvoll
Getreuer von Verona aus dem Brenner zu, mußte
aber bei Trient von der Heerstraße abbiegen, da das
welfische Bayern an diesem Übergang wachte. Er
schlug sich westwärts, kam über den Ofenpaß ins
Engadin und von dort über den Albula oder den
Flüela nach Chur, wo ihn der Bischof empfing.
Es war nach langer abenteuerlicher Fahrt der
erste Augenblick des Aufatmens; ihm mochte es
scheinen, nun erst sei er an Land. Hätte er hier
nicht Hilfe gefunden, er hätte kaum mit nun schon
stattlicherem Gefolge drei Stunden vor seinem
wölfischen Gegner Otto in Konstanz einrücken
können, wo das Mahl für seinen Widersacher
schon auf dem Herde briet, und wer mag wissen,
wie sich dann sein Geschick gestaltet hätte.
Gerade ein Vorgang wie dieser zeigt deutlich,
wie wichtig es für die italienische Politik der
deutschen Könige war, die rätischen Pässe gesichert
zu wissen. Und doch lehrt eine eingehendere Be- Abb. 8. Burg Rappenstein in Graubünden.