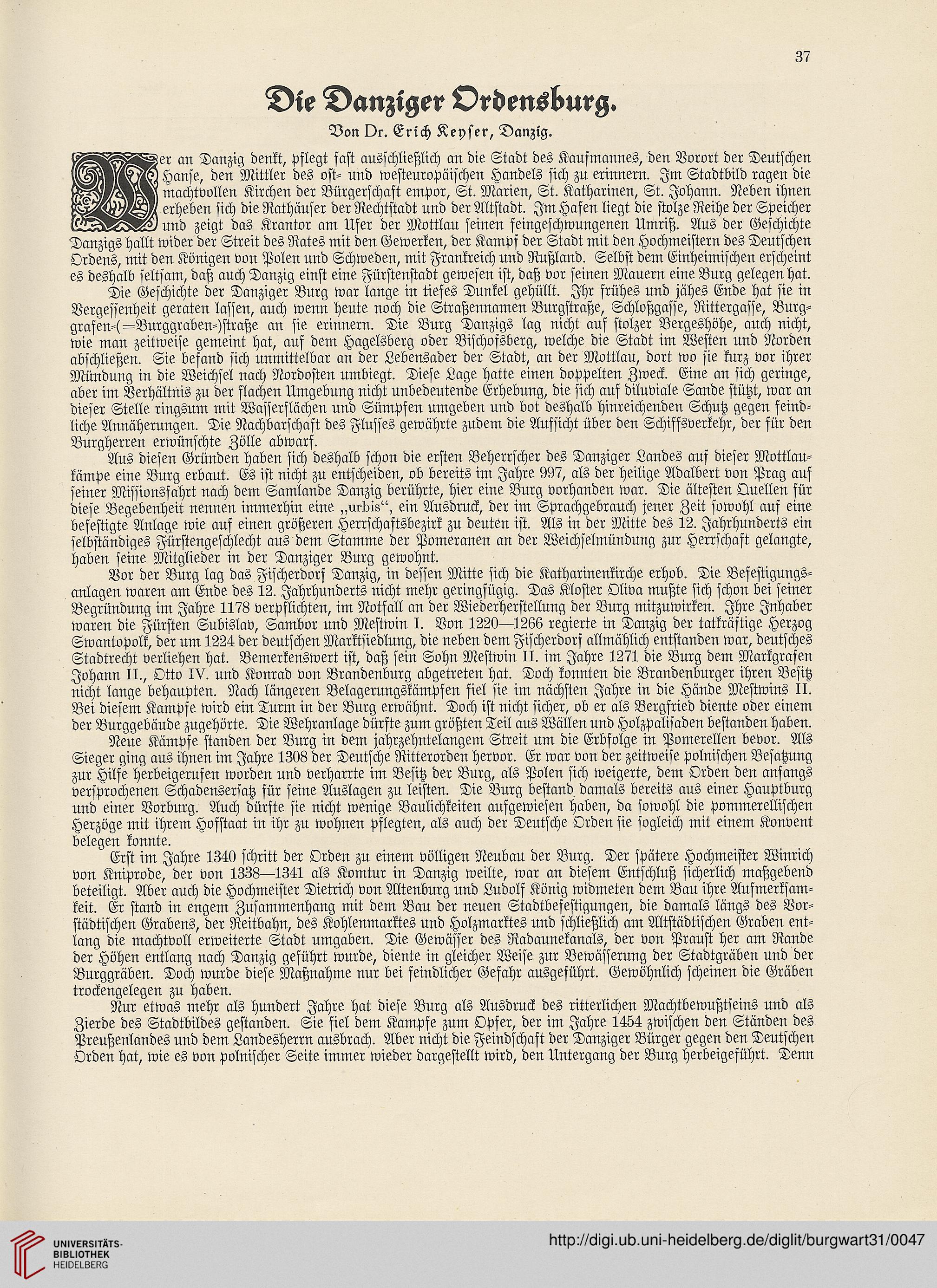37
Die Danziger Ordensburg.
Von Or. Erich Keyser, Danzig.
er an Danzig denkt, Pflegt fast ausschließlich an die Stadt des Kaufmannes, den Vorort der Deutschen
Hanse, den Mittler des oft- und westeuropäischen Handels sich zu erinnern. Im Stadtbild ragen die
machtvollen Kirchen der Bürgerschaft empor, St. Marien, St. Katharinen, St. Johann. Neben ihnen
erheben sich die Rathäuser der Rechtstadt und der Altstadt. Im Hafen liegt die stolze Reihe der Speicher
und zeigt das Krantor am Ufer der Mottlau seinen feingeschwungenen Umriß. Aus der Geschichte
Danzigs hallt wider der Streit des Rates mit den Gewerken, der Kampf der Stadt mit den Hochmeistern des Deutschen
Ordens, mit den Königen von Polen und Schweden, mit Frankreich und Rußland. Selbst dem Einheimischen erscheint
es deshalb seltsam, daß auch Danzig einst eine Fürstenstadt gewesen ist, daß vor seinen Mauern eine Burg gelegen hat.
Die Geschichte der Danziger Burg war lange in tiefes Dunkel gehüllt. Ihr frühes und jähes Ende hat sie in
Vergessenheit geraten lassen, auch wenn heute noch die Straßennamen Burgstraße, Schloßgasse, Rittergasse, Burg-
grafen-(^Burggraben-)straße an sie erinnern. Die Burg Danzigs lag nicht auf stolzer Bergeshöhe, auch uicht,
wie man zeitweise gemeint hat, auf dem Hagelsberg oder Bischofsberg, welche die Stadt im Westen und Norden
abschließen. Sie befand sich unmittelbar an der Lebensader der Stadt, an der Mottlau, dort wo sie kurz vor ihrer
Mündung in die Weichsel nach Nordosten umbiegt. Diese Lage hatte einen doppelten Zweck. Eine an sich geringe,
aber im Verhältnis zu der flachen Umgebung nicht unbedeutende Erhebung, die sich auf diluviale Sande stützt, war an
dieser Stelle ringsum mit Wasserflächen und Sümpfen umgeben und bot deshalb hinreichenden Schutz gegen feind-
liche Annäherungen. Die Nachbarschaft des Flusses gewährte zudem die Aufsicht über den Schiffsverkehr, der für den
Burgherren erwünschte Zölle abwarf.
Aus diesen Gründen haben sich deshalb schon die ersten Beherrscher des Danziger Landes auf dieser Mottlau-
kämpe eine Burg erbaut. Es ist nicht zu entscheiden, ob bereits im Jahre 997, als der heilige Adalbert von Prag auf
seiner Missionsfahrt nach dem Samlande Danzig berührte, hier eine Burg vorhanden war. Die ältesten Quellen für
diese Begebenheit nennen immerhin eine „urbis", ein Ausdruck, der im Sprachgebrauch jener Zeit sowohl auf eine
befestigte Anlage wie auf einen größeren Herrschaftsbezirk zu deuten ist. Als in der Mitte des 12. Jahrhunderts ein
selbständiges Fürstengeschlecht aus dem Stamme der Pomeranen an der Weichselmündung zur Herrschaft gelangte,
haben seine Mitglieder in der Danziger Burg gewohnt.
Vor der Burg lag das Fischerdorf Danzig, in dessen Mitte sich die Katharinenkirche erhob. Die Befestigungs-
anlagen waren am Ende des 12. Jahrhunderts nicht mehr geringfügig. Das Kloster Oliva mußte sich schon bei seiner
Begründung im Jahre 1178 verpflichten, im Notfall an der Wiederherstellung der Burg mitzuwirken. Ihre Inhaber
waren die Fürsten Subislav, Sambor und Mestwin I. Von 1220—1266 regierte in Danzig der tatkräftige Herzog
Swantopolk, der um 1224 der deutschen Marktsiedlung, die neben dem Fischerdorf allmählich entstanden war, deutsches
Stadtrecht verliehen hat. Bemerkenswert ist, daß sein Sohn Mestwin II. im Jahre 1271 die Burg dem Markgrafen
Johann II., Otto IV. und Konrad von Brandenburg abgetreten hat. Doch konnten die Brandenburger ihren Besitz
nicht lange behaupten. Nach längeren Belagerungskämpfen fiel sie im nächsten Jahre in die Hände Mestwins II.
Bei diesem Kampfe wird ein Turm in der Burg erwähnt. Doch ist nicht sicher, ob er als Bergfried diente oder einem
der Burggebäude zugehörte. Die Wehranlage dürfte zum größten Teil aus Wällen und Holzpalisaden bestanden haben.
Neue Kämpfe standen der Burg in dem jahrzehntelangem Streit um die Erbfolge in Pomerellen bevor. Als
Sieger ging aus ihnen im Jahre 1308 der Deutsche Ritterorden hervor. Er war von der zeitweise polnischen Besatzung
zur Hilfe herbeigerufen worden und verharrte im Besitz der Burg, als Polen sich weigerte, dem Orden den anfangs
versprochenen Schadensersatz für seine Auslagen zu leisten. Die Burg bestand damals bereits aus einer Hauptburg
und einer Borburg. Auch dürfte sie nicht wenige Baulichkeiten aufgewiesen haben, da sowohl die pommerellischen
Herzöge mit ihrem Hofstaat in ihr zu wohnen pflegten, als auch der Deutsche Orden sie sogleich mit einem Konvent
belegen konnte.
Erst im Jahre 1340 schritt der Orden zu einem völligen Neubau der Burg. Der spätere Hochmeister Winrich
von Kniprode, der von 1338—1341 als Komtur in Danzig weilte, war an diesem Entschluß sicherlich maßgebend
beteiligt. Aber auch die Hochmeister Dietrich von Altenburg und Ludolf König widmeten dem Bau ihre Aufmerksam-
keit. Er stand in engem Zusammenhang mit dem Bau der neuen Stadtbefestigungen, die damals längs des Bor-
städtischen Grabens, der Reitbahn, des Kohlenmarktes und Holzmarktes und schließlich am Altstädtischen Graben ent-
lang die machtvoll erweiterte Stadt umgaben. Die Gewässer des Radaunekanals, der von Pranst her am Rande
der Höhen entlang nach Danzig geführt wurde, diente in gleicher Weise zur Bewässerung der Stadtgräben und der
Burggräben. Doch wurde diese Maßnahme nur bei feindlicher Gefahr ausgeführt. Gewöhnlich scheinen die Gräben
trockengelegen zu haben.
Nur etwas mehr als hundert Jahre hat diese Burg als Ausdruck des ritterlichen Machtbewußtseins und als
Zierde des Stadtbildes gestanden. Sie fiel dem Kampfe zum Opfer, der im Jahre 1454 zwischen den Ständen des
Preußenlandes und dem Landesherrn ausbrach. Aber nicht die Feindschaft der Danziger Bürger gegen den Deutschen
Orden hat, wie es von polnischer Seite immer wieder dargestellt wird, den Untergang der Burg herbeigeführt. Denn
Die Danziger Ordensburg.
Von Or. Erich Keyser, Danzig.
er an Danzig denkt, Pflegt fast ausschließlich an die Stadt des Kaufmannes, den Vorort der Deutschen
Hanse, den Mittler des oft- und westeuropäischen Handels sich zu erinnern. Im Stadtbild ragen die
machtvollen Kirchen der Bürgerschaft empor, St. Marien, St. Katharinen, St. Johann. Neben ihnen
erheben sich die Rathäuser der Rechtstadt und der Altstadt. Im Hafen liegt die stolze Reihe der Speicher
und zeigt das Krantor am Ufer der Mottlau seinen feingeschwungenen Umriß. Aus der Geschichte
Danzigs hallt wider der Streit des Rates mit den Gewerken, der Kampf der Stadt mit den Hochmeistern des Deutschen
Ordens, mit den Königen von Polen und Schweden, mit Frankreich und Rußland. Selbst dem Einheimischen erscheint
es deshalb seltsam, daß auch Danzig einst eine Fürstenstadt gewesen ist, daß vor seinen Mauern eine Burg gelegen hat.
Die Geschichte der Danziger Burg war lange in tiefes Dunkel gehüllt. Ihr frühes und jähes Ende hat sie in
Vergessenheit geraten lassen, auch wenn heute noch die Straßennamen Burgstraße, Schloßgasse, Rittergasse, Burg-
grafen-(^Burggraben-)straße an sie erinnern. Die Burg Danzigs lag nicht auf stolzer Bergeshöhe, auch uicht,
wie man zeitweise gemeint hat, auf dem Hagelsberg oder Bischofsberg, welche die Stadt im Westen und Norden
abschließen. Sie befand sich unmittelbar an der Lebensader der Stadt, an der Mottlau, dort wo sie kurz vor ihrer
Mündung in die Weichsel nach Nordosten umbiegt. Diese Lage hatte einen doppelten Zweck. Eine an sich geringe,
aber im Verhältnis zu der flachen Umgebung nicht unbedeutende Erhebung, die sich auf diluviale Sande stützt, war an
dieser Stelle ringsum mit Wasserflächen und Sümpfen umgeben und bot deshalb hinreichenden Schutz gegen feind-
liche Annäherungen. Die Nachbarschaft des Flusses gewährte zudem die Aufsicht über den Schiffsverkehr, der für den
Burgherren erwünschte Zölle abwarf.
Aus diesen Gründen haben sich deshalb schon die ersten Beherrscher des Danziger Landes auf dieser Mottlau-
kämpe eine Burg erbaut. Es ist nicht zu entscheiden, ob bereits im Jahre 997, als der heilige Adalbert von Prag auf
seiner Missionsfahrt nach dem Samlande Danzig berührte, hier eine Burg vorhanden war. Die ältesten Quellen für
diese Begebenheit nennen immerhin eine „urbis", ein Ausdruck, der im Sprachgebrauch jener Zeit sowohl auf eine
befestigte Anlage wie auf einen größeren Herrschaftsbezirk zu deuten ist. Als in der Mitte des 12. Jahrhunderts ein
selbständiges Fürstengeschlecht aus dem Stamme der Pomeranen an der Weichselmündung zur Herrschaft gelangte,
haben seine Mitglieder in der Danziger Burg gewohnt.
Vor der Burg lag das Fischerdorf Danzig, in dessen Mitte sich die Katharinenkirche erhob. Die Befestigungs-
anlagen waren am Ende des 12. Jahrhunderts nicht mehr geringfügig. Das Kloster Oliva mußte sich schon bei seiner
Begründung im Jahre 1178 verpflichten, im Notfall an der Wiederherstellung der Burg mitzuwirken. Ihre Inhaber
waren die Fürsten Subislav, Sambor und Mestwin I. Von 1220—1266 regierte in Danzig der tatkräftige Herzog
Swantopolk, der um 1224 der deutschen Marktsiedlung, die neben dem Fischerdorf allmählich entstanden war, deutsches
Stadtrecht verliehen hat. Bemerkenswert ist, daß sein Sohn Mestwin II. im Jahre 1271 die Burg dem Markgrafen
Johann II., Otto IV. und Konrad von Brandenburg abgetreten hat. Doch konnten die Brandenburger ihren Besitz
nicht lange behaupten. Nach längeren Belagerungskämpfen fiel sie im nächsten Jahre in die Hände Mestwins II.
Bei diesem Kampfe wird ein Turm in der Burg erwähnt. Doch ist nicht sicher, ob er als Bergfried diente oder einem
der Burggebäude zugehörte. Die Wehranlage dürfte zum größten Teil aus Wällen und Holzpalisaden bestanden haben.
Neue Kämpfe standen der Burg in dem jahrzehntelangem Streit um die Erbfolge in Pomerellen bevor. Als
Sieger ging aus ihnen im Jahre 1308 der Deutsche Ritterorden hervor. Er war von der zeitweise polnischen Besatzung
zur Hilfe herbeigerufen worden und verharrte im Besitz der Burg, als Polen sich weigerte, dem Orden den anfangs
versprochenen Schadensersatz für seine Auslagen zu leisten. Die Burg bestand damals bereits aus einer Hauptburg
und einer Borburg. Auch dürfte sie nicht wenige Baulichkeiten aufgewiesen haben, da sowohl die pommerellischen
Herzöge mit ihrem Hofstaat in ihr zu wohnen pflegten, als auch der Deutsche Orden sie sogleich mit einem Konvent
belegen konnte.
Erst im Jahre 1340 schritt der Orden zu einem völligen Neubau der Burg. Der spätere Hochmeister Winrich
von Kniprode, der von 1338—1341 als Komtur in Danzig weilte, war an diesem Entschluß sicherlich maßgebend
beteiligt. Aber auch die Hochmeister Dietrich von Altenburg und Ludolf König widmeten dem Bau ihre Aufmerksam-
keit. Er stand in engem Zusammenhang mit dem Bau der neuen Stadtbefestigungen, die damals längs des Bor-
städtischen Grabens, der Reitbahn, des Kohlenmarktes und Holzmarktes und schließlich am Altstädtischen Graben ent-
lang die machtvoll erweiterte Stadt umgaben. Die Gewässer des Radaunekanals, der von Pranst her am Rande
der Höhen entlang nach Danzig geführt wurde, diente in gleicher Weise zur Bewässerung der Stadtgräben und der
Burggräben. Doch wurde diese Maßnahme nur bei feindlicher Gefahr ausgeführt. Gewöhnlich scheinen die Gräben
trockengelegen zu haben.
Nur etwas mehr als hundert Jahre hat diese Burg als Ausdruck des ritterlichen Machtbewußtseins und als
Zierde des Stadtbildes gestanden. Sie fiel dem Kampfe zum Opfer, der im Jahre 1454 zwischen den Ständen des
Preußenlandes und dem Landesherrn ausbrach. Aber nicht die Feindschaft der Danziger Bürger gegen den Deutschen
Orden hat, wie es von polnischer Seite immer wieder dargestellt wird, den Untergang der Burg herbeigeführt. Denn