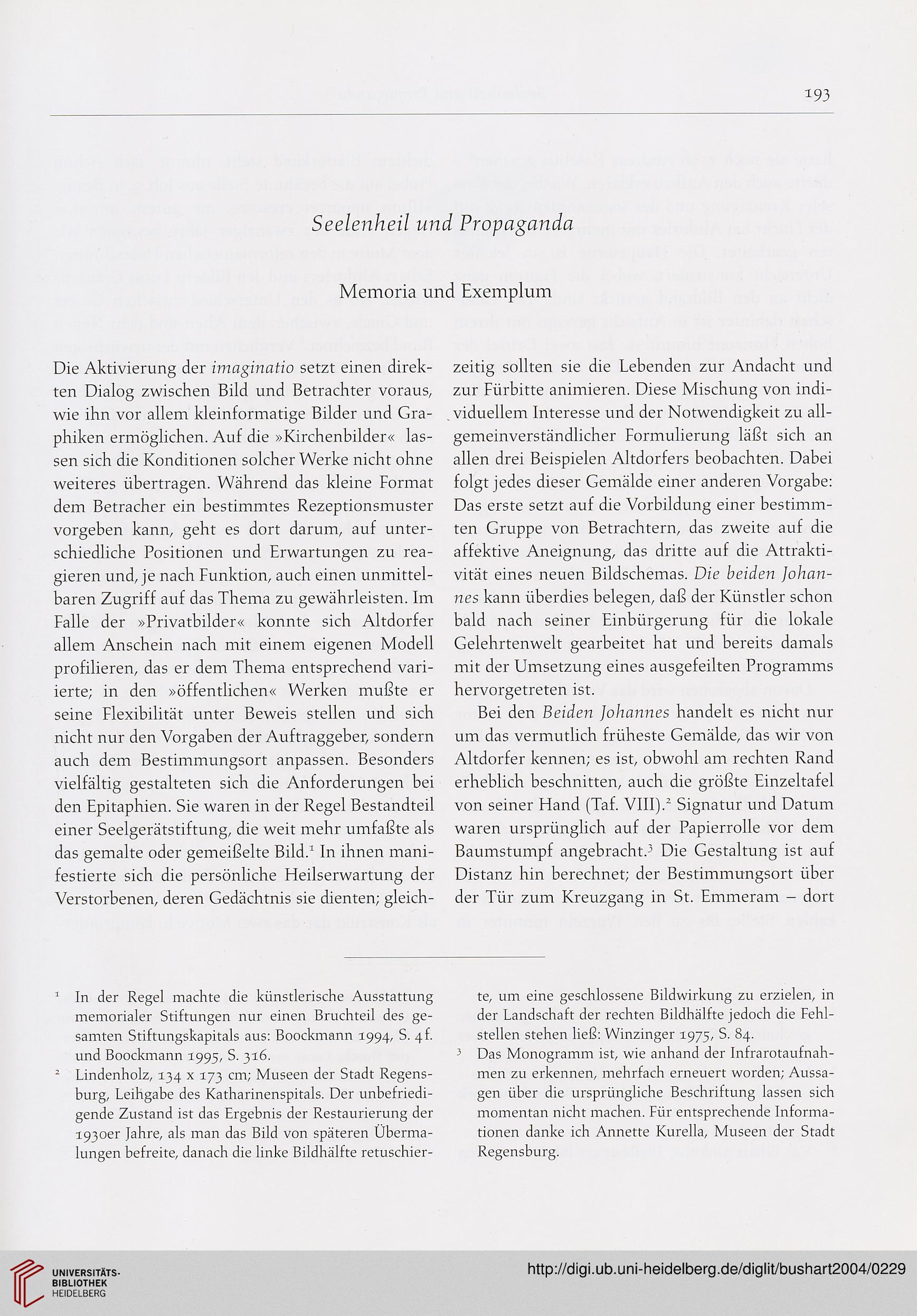193
Seelenheil und Propaganda
Memoria und Exemplum
Die Aktivierung der imaginatio setzt einen direk-
ten Dialog zwischen Bild und Betrachter voraus,
wie ihn vor allem kleinformatige Bilder und Gra-
phiken ermöglichen. Auf die »Kirchenbilder« las-
sen sich die Konditionen solcher Werke nicht ohne
weiteres übertragen. Während das kleine Format
dem Betracher ein bestimmtes Rezeptionsmuster
vorgeben kann, geht es dort darum, auf unter-
schiedliche Positionen und Erwartungen zu rea-
gieren und, je nach Funktion, auch einen unmittel-
baren Zugriff auf das Thema zu gewährleisten. Im
Falle der »Privatbilder« konnte sich Altdorfer
allem Anschein nach mit einem eigenen Modell
profilieren, das er dem Thema entsprechend vari-
ierte; in den »öffentlichen« Werken mußte er
seine Flexibilität unter Beweis stellen und sich
nicht nur den Vorgaben der Auftraggeber, sondern
auch dem Bestimmungsort anpassen. Besonders
vielfältig gestalteten sich die Anforderungen bei
den Epitaphien. Sie waren in der Regel Bestandteil
einer Seelgerätstiftung, die weit mehr umfaßte als
das gemalte oder gemeißelte Bild.1 In ihnen mani-
festierte sich die persönliche Heilserwartung der
Verstorbenen, deren Gedächtnis sie dienten; gleich-
zeitig sollten sie die Lebenden zur Andacht und
zur Fürbitte animieren. Diese Mischung von indi-
viduellem Interesse und der Notwendigkeit zu all-
gemeinverständlicher Formulierung läßt sich an
allen drei Beispielen Altdorfers beobachten. Dabei
folgt jedes dieser Gemälde einer anderen Vorgabe:
Das erste setzt auf die Vorbildung einer bestimm-
ten Gruppe von Betrachtern, das zweite auf die
affektive Aneignung, das dritte auf die Attrakti-
vität eines neuen Bildschemas. Die beiden Johan-
nes kann überdies belegen, daß der Künstler schon
bald nach seiner Einbürgerung für die lokale
Gelehrtenwelt gearbeitet hat und bereits damals
mit der Umsetzung eines ausgefeilten Programms
hervorgetreten ist.
Bei den Beiden Johannes handelt es nicht nur
um das vermutlich früheste Gemälde, das wir von
Altdorfer kennen; es ist, obwohl am rechten Rand
erheblich beschnitten, auch die größte Einzeltafel
von seiner Hand (Taf. VIII).2 Signatur und Datum
waren ursprünglich auf der Papierrolle vor dem
Baumstumpf angebracht.3 Die Gestaltung ist auf
Distanz hin berechnet; der Bestimmungsort über
der Tür zum Kreuzgang in St. Emmeram - dort
1 In der Regel machte die künstlerische Ausstattung
memorialer Stiftungen nur einen Bruchteil des ge-
samten Stiftungskapitals aus: Boockmann 1994, S. 4L
und Boockmann 1995, S. 316.
2 Lindenholz, 134 x 173 cm; Museen der Stadt Regens¬
burg, Leihgabe des Katharinenspitals. Der unbefriedi-
gende Zustand ist das Ergebnis der Restaurierung der
1930er Jahre, als man das Bild von späteren Überma-
lungen befreite, danach die linke Bildhälfte retuschier¬
te, um eine geschlossene Bildwirkung zu erzielen, in
der Landschaft der rechten Bildhälfte jedoch die Fehl-
stellen stehen ließ: Winzinger 1975, S. 84.
3 Das Monogramm ist, wie anhand der Infrarotaufnah-
men zu erkennen, mehrfach erneuert worden; Aussa-
gen über die ursprüngliche Beschriftung lassen sich
momentan nicht machen. Für entsprechende Informa-
tionen danke ich Annette Kurella, Museen der Stadt
Regensburg.
Seelenheil und Propaganda
Memoria und Exemplum
Die Aktivierung der imaginatio setzt einen direk-
ten Dialog zwischen Bild und Betrachter voraus,
wie ihn vor allem kleinformatige Bilder und Gra-
phiken ermöglichen. Auf die »Kirchenbilder« las-
sen sich die Konditionen solcher Werke nicht ohne
weiteres übertragen. Während das kleine Format
dem Betracher ein bestimmtes Rezeptionsmuster
vorgeben kann, geht es dort darum, auf unter-
schiedliche Positionen und Erwartungen zu rea-
gieren und, je nach Funktion, auch einen unmittel-
baren Zugriff auf das Thema zu gewährleisten. Im
Falle der »Privatbilder« konnte sich Altdorfer
allem Anschein nach mit einem eigenen Modell
profilieren, das er dem Thema entsprechend vari-
ierte; in den »öffentlichen« Werken mußte er
seine Flexibilität unter Beweis stellen und sich
nicht nur den Vorgaben der Auftraggeber, sondern
auch dem Bestimmungsort anpassen. Besonders
vielfältig gestalteten sich die Anforderungen bei
den Epitaphien. Sie waren in der Regel Bestandteil
einer Seelgerätstiftung, die weit mehr umfaßte als
das gemalte oder gemeißelte Bild.1 In ihnen mani-
festierte sich die persönliche Heilserwartung der
Verstorbenen, deren Gedächtnis sie dienten; gleich-
zeitig sollten sie die Lebenden zur Andacht und
zur Fürbitte animieren. Diese Mischung von indi-
viduellem Interesse und der Notwendigkeit zu all-
gemeinverständlicher Formulierung läßt sich an
allen drei Beispielen Altdorfers beobachten. Dabei
folgt jedes dieser Gemälde einer anderen Vorgabe:
Das erste setzt auf die Vorbildung einer bestimm-
ten Gruppe von Betrachtern, das zweite auf die
affektive Aneignung, das dritte auf die Attrakti-
vität eines neuen Bildschemas. Die beiden Johan-
nes kann überdies belegen, daß der Künstler schon
bald nach seiner Einbürgerung für die lokale
Gelehrtenwelt gearbeitet hat und bereits damals
mit der Umsetzung eines ausgefeilten Programms
hervorgetreten ist.
Bei den Beiden Johannes handelt es nicht nur
um das vermutlich früheste Gemälde, das wir von
Altdorfer kennen; es ist, obwohl am rechten Rand
erheblich beschnitten, auch die größte Einzeltafel
von seiner Hand (Taf. VIII).2 Signatur und Datum
waren ursprünglich auf der Papierrolle vor dem
Baumstumpf angebracht.3 Die Gestaltung ist auf
Distanz hin berechnet; der Bestimmungsort über
der Tür zum Kreuzgang in St. Emmeram - dort
1 In der Regel machte die künstlerische Ausstattung
memorialer Stiftungen nur einen Bruchteil des ge-
samten Stiftungskapitals aus: Boockmann 1994, S. 4L
und Boockmann 1995, S. 316.
2 Lindenholz, 134 x 173 cm; Museen der Stadt Regens¬
burg, Leihgabe des Katharinenspitals. Der unbefriedi-
gende Zustand ist das Ergebnis der Restaurierung der
1930er Jahre, als man das Bild von späteren Überma-
lungen befreite, danach die linke Bildhälfte retuschier¬
te, um eine geschlossene Bildwirkung zu erzielen, in
der Landschaft der rechten Bildhälfte jedoch die Fehl-
stellen stehen ließ: Winzinger 1975, S. 84.
3 Das Monogramm ist, wie anhand der Infrarotaufnah-
men zu erkennen, mehrfach erneuert worden; Aussa-
gen über die ursprüngliche Beschriftung lassen sich
momentan nicht machen. Für entsprechende Informa-
tionen danke ich Annette Kurella, Museen der Stadt
Regensburg.