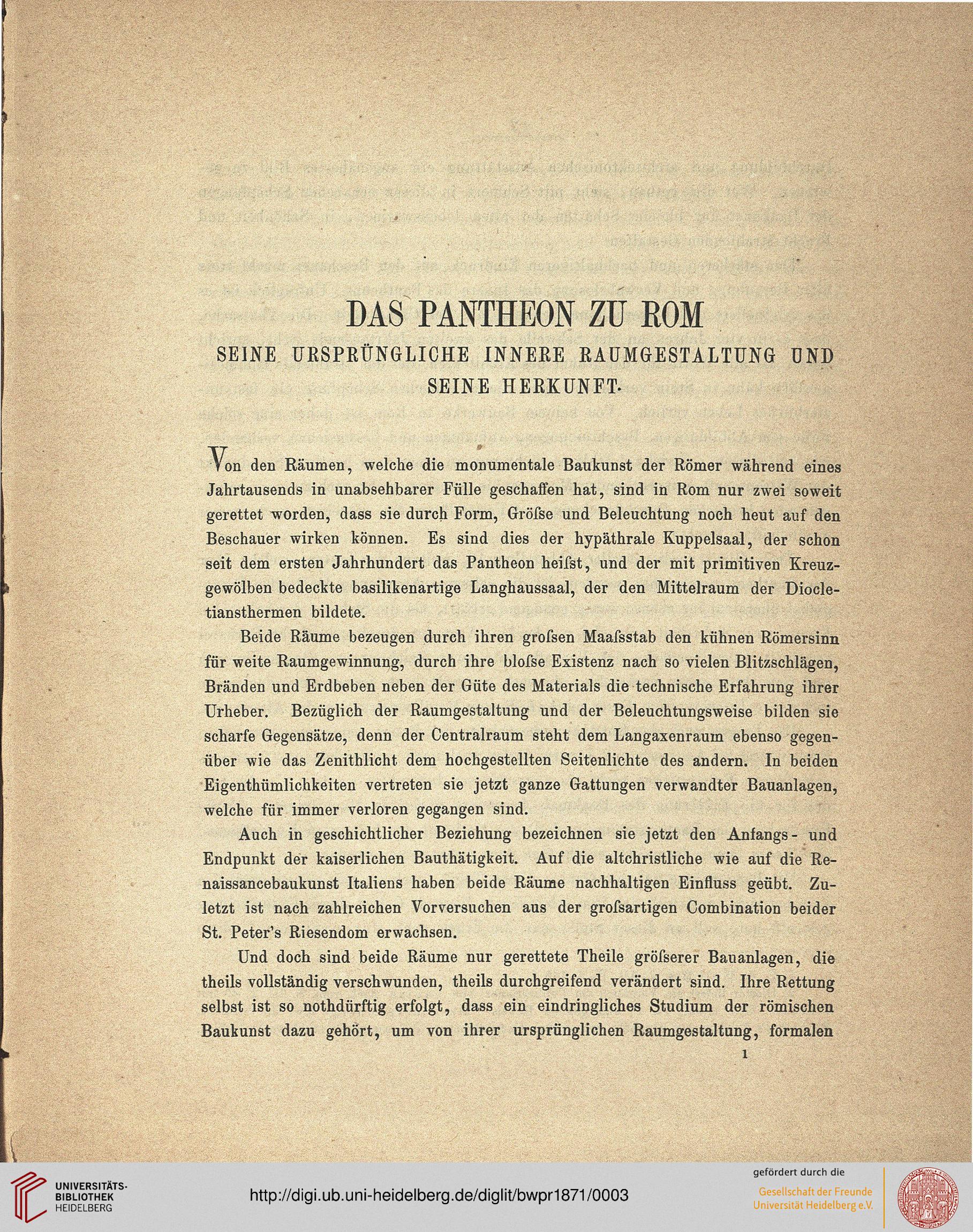DAS PANTHEON ZU ROM
SEINE URSPRÜNGLICHE INNERE RAUMGESTALTUNG UND
SEINE HERKUNFT.
Von den Bäumen, welche die monumentale Baukunst der Römer während eines
Jahrtausends in unabsehbarer Fülle geschaffen hat, sind in Rom nur zwei soweit
gerettet -worden, dass sie durch Form, Gröfse und Beleuchtung noch heut auf den
Beschauer wirken können. Es sind dies der hypäthrale Kuppelsaal, der schon
seit dem ersten Jahrhundert das Pantheon heifst, und der mit primitiven Kreuz-
gewölben bedeckte basilikenartige Langhaussaal, der den Mittelraum der Diocle-
tiansthermen bildete.
Beide Räume bezeugen durch ihren grofsen Maafsstab den kühnen Römersinn
für weite Raumgewinnung, durch ihre blofse Existenz nach so vielen Blitzschlägen,
Bränden und Erdbeben neben der Güte des Materials die technische Erfahrung ihrer
Urheber. Bezüglich der Raumgestaltung und der Beleuchtungsweise bilden sie
scharfe Gegensätze, denn der Centralraum steht dem Langaxenrauin ebenso gegen-
über wie das Zenithlicht dem hochgestellten Seitenlichte des andern. In beiden
Eigenthümlichkeiten vertreten sie jetzt ganze Gattungen verwandter Bauanlagen,
welche für immer verloren gegangen sind.
Auch in geschichtlicher Beziehung bezeichnen sie jetzt den Anfangs- und
Endpunkt der kaiserlichen Bauthätigkeit. Auf die altchristliche wie auf die Re-
naissancebaukunst Italiens haben beide Räume nachhaltigen Einfluss geübt. Zu-
letzt ist nach zahlreichen Vorversuchen aus der grofsartigen Combination beider
St. Peter's Riesendom erwachsen.
Und doch sind beide Räume nur gerettete Theile gröfserer Bauanlagen, die
theils vollständig verschwunden, theils durchgreifend verändert sind. Ihre Rettung
selbst ist so nothdürftig erfolgt, dass ein eindringliches Studium der römischen
Baukunst dazu gehört, um von ihrer ursprünglichen Raumgestaltung, formalen
SEINE URSPRÜNGLICHE INNERE RAUMGESTALTUNG UND
SEINE HERKUNFT.
Von den Bäumen, welche die monumentale Baukunst der Römer während eines
Jahrtausends in unabsehbarer Fülle geschaffen hat, sind in Rom nur zwei soweit
gerettet -worden, dass sie durch Form, Gröfse und Beleuchtung noch heut auf den
Beschauer wirken können. Es sind dies der hypäthrale Kuppelsaal, der schon
seit dem ersten Jahrhundert das Pantheon heifst, und der mit primitiven Kreuz-
gewölben bedeckte basilikenartige Langhaussaal, der den Mittelraum der Diocle-
tiansthermen bildete.
Beide Räume bezeugen durch ihren grofsen Maafsstab den kühnen Römersinn
für weite Raumgewinnung, durch ihre blofse Existenz nach so vielen Blitzschlägen,
Bränden und Erdbeben neben der Güte des Materials die technische Erfahrung ihrer
Urheber. Bezüglich der Raumgestaltung und der Beleuchtungsweise bilden sie
scharfe Gegensätze, denn der Centralraum steht dem Langaxenrauin ebenso gegen-
über wie das Zenithlicht dem hochgestellten Seitenlichte des andern. In beiden
Eigenthümlichkeiten vertreten sie jetzt ganze Gattungen verwandter Bauanlagen,
welche für immer verloren gegangen sind.
Auch in geschichtlicher Beziehung bezeichnen sie jetzt den Anfangs- und
Endpunkt der kaiserlichen Bauthätigkeit. Auf die altchristliche wie auf die Re-
naissancebaukunst Italiens haben beide Räume nachhaltigen Einfluss geübt. Zu-
letzt ist nach zahlreichen Vorversuchen aus der grofsartigen Combination beider
St. Peter's Riesendom erwachsen.
Und doch sind beide Räume nur gerettete Theile gröfserer Bauanlagen, die
theils vollständig verschwunden, theils durchgreifend verändert sind. Ihre Rettung
selbst ist so nothdürftig erfolgt, dass ein eindringliches Studium der römischen
Baukunst dazu gehört, um von ihrer ursprünglichen Raumgestaltung, formalen