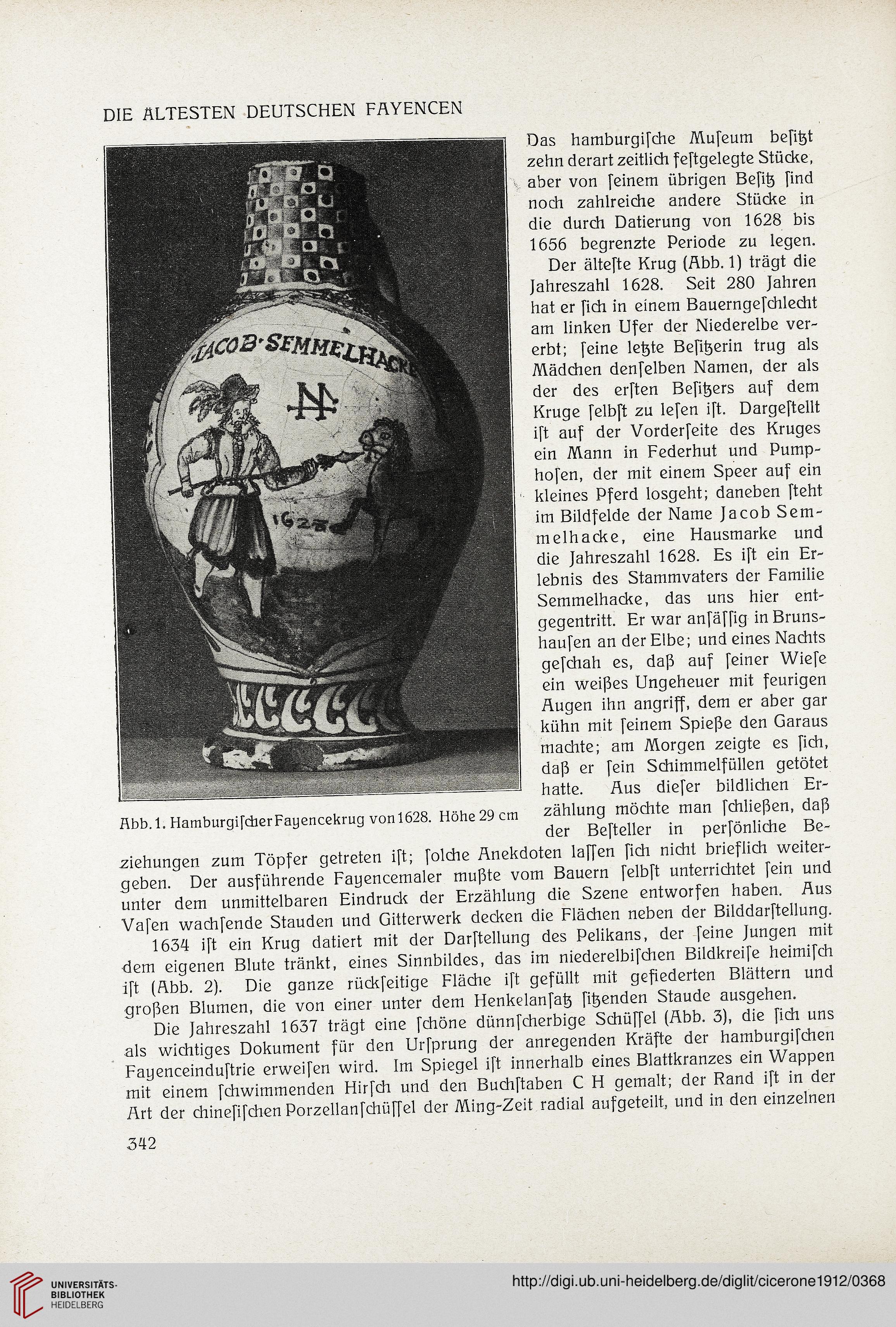DIE ÄLTESTEN DEUTSCHEN FAYENCEN
Das hamburgifche Mufeum befit^t
zehn derart zeitlich feftgelegte Stücke,
aber von [einem übrigen Befiß find
noch zahlreiche andere Stücke in
die durch Datierung von 1628 bis
1656 begrenzte Periode zu legen.
Der ältefte Krug (Äbb. 1) trägt die
Jahreszahl 1628. Seit 280 Jahren
hat er [ich in einem Bauerngefchlecht
am linken Ufer der Niederelbe ver-
erbt; [eine leiste Befißerin trug als
Mädchen denfelben Namen, der als
der des erften Befißers auf dem
Kruge felbft zu lefen ift. Dargeftellt
ift auf der Vorderfeite des Kruges
ein Mann in Federhut und Pump-
hofen, der mit einem Speer auf ein
kleines Pferd losgeht; daneben [teht
im Bildfelde der Name Jacob Sem-
melhacke, eine Hausmarke und
die Jahreszahl 1628. Es ift ein Er-
lebnis des Stammvaters der Familie
Semmelhacke, das uns hier ent-
gegentritt. Er war anfäffig in Bruns-
haufen an der Elbe; und eines Nachts
gefchah es, daß auf feiner Wiefe
ein weißes Ungeheuer mit feurigen
Äugen ihn angriff, dem er aber gar
kühn mit feinem Spieße den Garaus
machte; am Morgen zeigte es [ich,
daß er fein Schimmelfüllen getötet
hatte. Aus diefer bildlichen Er-
Äbb. 1. HamburgifcberFayencekrug von 1628. Höhe 29 cm zählung möchte man fchließen, daß
der Befteller in perfönliche Be-
ziehungen zum Töpfer getreten ift; folche Anekdoten laffen [ich nicht brieflich weiter-
geben. Der ausführende Fayencemaler mußte vom Bauern felbft unterrichtet fein und
unter dem unmittelbaren Eindruck der Erzählung die Szene entworfen haben. Aus
Vafen wachfende Stauden und Gitterwerk decken die Flächen neben der Bilddarftellung.
1634 ift ein Krug datiert mit der Darftellung des Pelikans, der feine Jungen mit
dem eigenen Blute tränkt, eines Sinnbildes, das im niederelbifchen Bildkreife heimifch
ift (Abb. 2). Die ganze rückfeitige Fläche ift gefüllt mit gefiederten Blättern und
großen Blumen, die von einer unter dem Henkelanfaß fißenden Staude ausgehen.
Die Jahreszahl 1637 trägt eine fchöne dünnfcherbige Schüffel (Äbb. 3), die [ich uns
als wichtiges Dokument für den Urfprung der anregenden Kräfte der hamburgifchen
Fayenceinduftrie erweifen wird. Im Spiegel ift innerhalb eines Blattkranzes ein Wappen
mit einem fchwimmenden Hirfch und den Buchftaben C H gemalt; der Rand ift in der
Art der chinefifchen Porzellanfchüffel der Ming-Zeit radial aufgeteilt, und in den einzelnen
342
Das hamburgifche Mufeum befit^t
zehn derart zeitlich feftgelegte Stücke,
aber von [einem übrigen Befiß find
noch zahlreiche andere Stücke in
die durch Datierung von 1628 bis
1656 begrenzte Periode zu legen.
Der ältefte Krug (Äbb. 1) trägt die
Jahreszahl 1628. Seit 280 Jahren
hat er [ich in einem Bauerngefchlecht
am linken Ufer der Niederelbe ver-
erbt; [eine leiste Befißerin trug als
Mädchen denfelben Namen, der als
der des erften Befißers auf dem
Kruge felbft zu lefen ift. Dargeftellt
ift auf der Vorderfeite des Kruges
ein Mann in Federhut und Pump-
hofen, der mit einem Speer auf ein
kleines Pferd losgeht; daneben [teht
im Bildfelde der Name Jacob Sem-
melhacke, eine Hausmarke und
die Jahreszahl 1628. Es ift ein Er-
lebnis des Stammvaters der Familie
Semmelhacke, das uns hier ent-
gegentritt. Er war anfäffig in Bruns-
haufen an der Elbe; und eines Nachts
gefchah es, daß auf feiner Wiefe
ein weißes Ungeheuer mit feurigen
Äugen ihn angriff, dem er aber gar
kühn mit feinem Spieße den Garaus
machte; am Morgen zeigte es [ich,
daß er fein Schimmelfüllen getötet
hatte. Aus diefer bildlichen Er-
Äbb. 1. HamburgifcberFayencekrug von 1628. Höhe 29 cm zählung möchte man fchließen, daß
der Befteller in perfönliche Be-
ziehungen zum Töpfer getreten ift; folche Anekdoten laffen [ich nicht brieflich weiter-
geben. Der ausführende Fayencemaler mußte vom Bauern felbft unterrichtet fein und
unter dem unmittelbaren Eindruck der Erzählung die Szene entworfen haben. Aus
Vafen wachfende Stauden und Gitterwerk decken die Flächen neben der Bilddarftellung.
1634 ift ein Krug datiert mit der Darftellung des Pelikans, der feine Jungen mit
dem eigenen Blute tränkt, eines Sinnbildes, das im niederelbifchen Bildkreife heimifch
ift (Abb. 2). Die ganze rückfeitige Fläche ift gefüllt mit gefiederten Blättern und
großen Blumen, die von einer unter dem Henkelanfaß fißenden Staude ausgehen.
Die Jahreszahl 1637 trägt eine fchöne dünnfcherbige Schüffel (Äbb. 3), die [ich uns
als wichtiges Dokument für den Urfprung der anregenden Kräfte der hamburgifchen
Fayenceinduftrie erweifen wird. Im Spiegel ift innerhalb eines Blattkranzes ein Wappen
mit einem fchwimmenden Hirfch und den Buchftaben C H gemalt; der Rand ift in der
Art der chinefifchen Porzellanfchüffel der Ming-Zeit radial aufgeteilt, und in den einzelnen
342