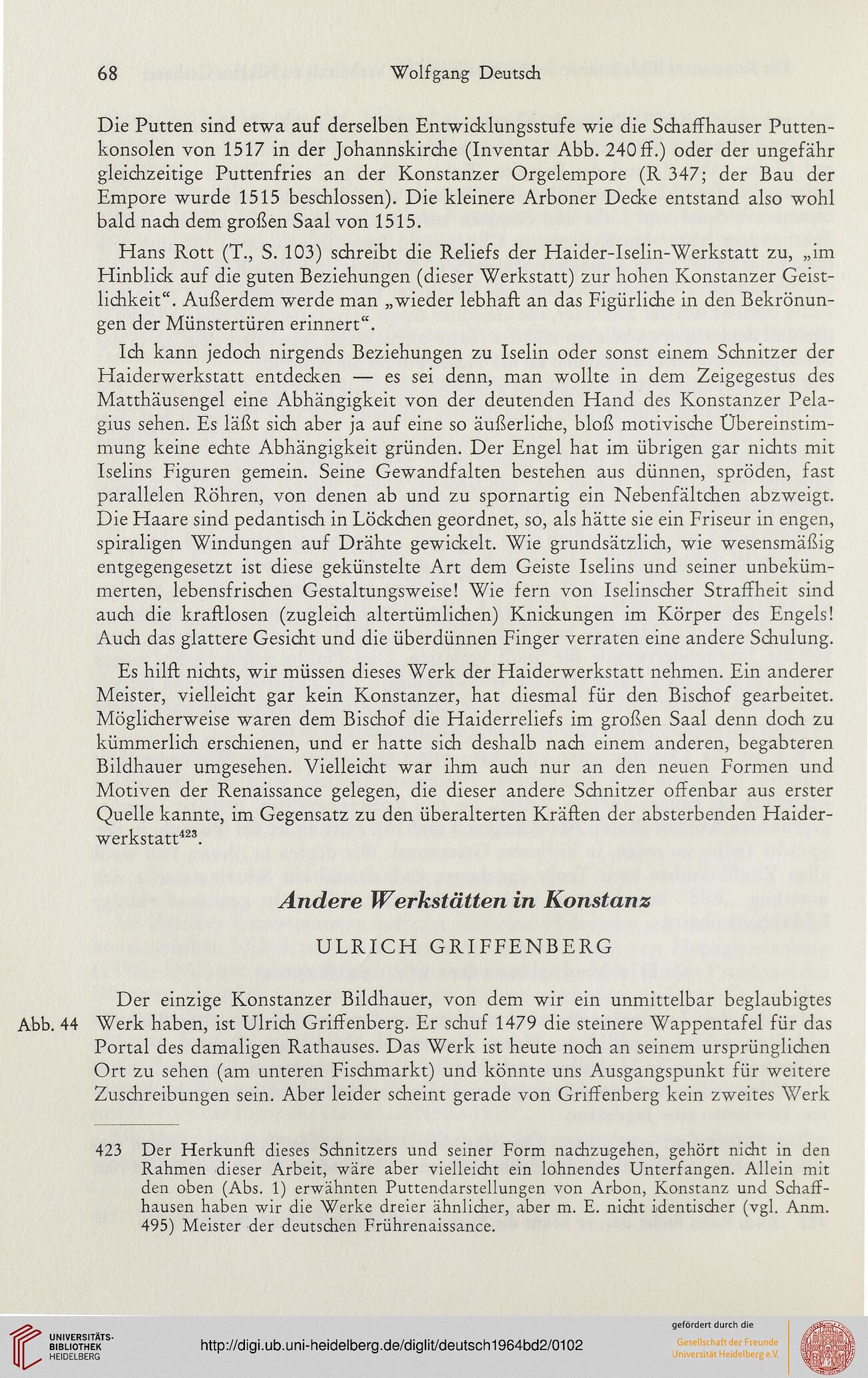68
Wolfgang Deutsch
Die Putten sind etwa auf derselben Entwicklungsstufe wie die Schaffhauser Putten-
konsolen von 1517 in der Johannskirche (Inventar Abb. 240 ff.) oder der ungefähr
gleichzeitige Puttenfries an der Konstanzer Orgelempore (R 347; der Bau der
Empore wurde 1515 beschlossen). Die kleinere Arboner Decke entstand also wohl
bald nach dem großen Saal von 1515.
Hans Rott (T., S. 103) schreibt die Reliefs der Haider-Iselin-Werkstatt zu, „im
Hinblick auf die guten Beziehungen (dieser Werkstatt) zur hohen Konstanzer Geist-
lichkeit“. Außerdem werde man „wieder lebhaft an das Figürliche in den Bekrönun-
gen der Münstertüren erinnert“.
Ich kann jedoch nirgends Beziehungen zu Iselin oder sonst einem Schnitzer der
Haiderwerkstatt entdecken — es sei denn, man wollte in dem Zeigegestus des
Matthäusengel eine Abhängigkeit von der deutenden Hand des Konstanzer Pela-
gius sehen. Es läßt sich aber ja auf eine so äußerliche, bloß motivische Übereinstim-
mung keine echte Abhängigkeit gründen. Der Engel hat im übrigen gar nichts mit
Iselins Figuren gemein. Seine Gewandfalten bestehen aus dünnen, spröden, fast
parallelen Röhren, von denen ab und zu spornartig ein Nebenfältchen abzweigt.
Die Haare sind pedantisch in Löckchen geordnet, so, als hätte sie ein Friseur in engen,
spiraligen Windungen auf Drähte gewickelt. Wie grundsätzlich, wie wesensmäßig
entgegengesetzt ist diese gekünstelte Art dem Geiste Iselins und seiner unbeküm-
merten, lebensfrischen Gestaltungsweise! Wie fern von Iselinscher Straffheit sind
auch die kraftlosen (zugleich altertümlichen) Knickungen im Körper des Engels!
Auch das glattere Gesicht und die überdünnen Finger verraten eine andere Schulung.
Es hilft nichts, wir müssen dieses Werk der Haiderwerkstatt nehmen. Ein anderer
Meister, vielleicht gar kein Konstanzer, hat diesmal für den Bischof gearbeitet.
Möglicherweise waren dem Bischof die Haiderreliefs im großen Saal denn doch zu
kümmerlich erschienen, und er hatte sich deshalb nach einem anderen, begabteren
Bildhauer umgesehen. Vielleicht war ihm auch nur an den neuen Formen und
Motiven der Renaissance gelegen, die dieser andere Schnitzer offenbar aus erster
Quelle kannte, im Gegensatz zu den überalterten Kräften der absterbenden Haider-
werkstatt423.
Andere Werkstätten in Konstanz
ULRICH GRIFFENBERG
Der einzige Konstanzer Bildhauer, von dem wir ein unmittelbar beglaubigtes
Abb. 44 Werk haben, ist Ulrich Griffenberg. Er schuf 1479 die steinere Wappentafel für das
Portal des damaligen Rathauses. Das Werk ist heute noch an seinem ursprünglichen
Ort zu sehen (am unteren Fischmarkt) und könnte uns Ausgangspunkt für weitere
Zuschreibungen sein. Aber leider scheint gerade von Griffenberg kein zweites Werk
423 Der Herkunft dieses Schnitzers und seiner Form nachzugehen, gehört nicht in den
Rahmen dieser Arbeit, wäre aber vielleicht ein lohnendes Unterfangen. Allein mit
den oben (Abs. 1) erwähnten Puttendarstellungen von Arbon, Konstanz und Schaff-
hausen haben wir die Werke dreier ähnlicher, aber m. E. nicht identischer (vgl. Anm.
495) Meister der deutschen Frührenaissance.
Wolfgang Deutsch
Die Putten sind etwa auf derselben Entwicklungsstufe wie die Schaffhauser Putten-
konsolen von 1517 in der Johannskirche (Inventar Abb. 240 ff.) oder der ungefähr
gleichzeitige Puttenfries an der Konstanzer Orgelempore (R 347; der Bau der
Empore wurde 1515 beschlossen). Die kleinere Arboner Decke entstand also wohl
bald nach dem großen Saal von 1515.
Hans Rott (T., S. 103) schreibt die Reliefs der Haider-Iselin-Werkstatt zu, „im
Hinblick auf die guten Beziehungen (dieser Werkstatt) zur hohen Konstanzer Geist-
lichkeit“. Außerdem werde man „wieder lebhaft an das Figürliche in den Bekrönun-
gen der Münstertüren erinnert“.
Ich kann jedoch nirgends Beziehungen zu Iselin oder sonst einem Schnitzer der
Haiderwerkstatt entdecken — es sei denn, man wollte in dem Zeigegestus des
Matthäusengel eine Abhängigkeit von der deutenden Hand des Konstanzer Pela-
gius sehen. Es läßt sich aber ja auf eine so äußerliche, bloß motivische Übereinstim-
mung keine echte Abhängigkeit gründen. Der Engel hat im übrigen gar nichts mit
Iselins Figuren gemein. Seine Gewandfalten bestehen aus dünnen, spröden, fast
parallelen Röhren, von denen ab und zu spornartig ein Nebenfältchen abzweigt.
Die Haare sind pedantisch in Löckchen geordnet, so, als hätte sie ein Friseur in engen,
spiraligen Windungen auf Drähte gewickelt. Wie grundsätzlich, wie wesensmäßig
entgegengesetzt ist diese gekünstelte Art dem Geiste Iselins und seiner unbeküm-
merten, lebensfrischen Gestaltungsweise! Wie fern von Iselinscher Straffheit sind
auch die kraftlosen (zugleich altertümlichen) Knickungen im Körper des Engels!
Auch das glattere Gesicht und die überdünnen Finger verraten eine andere Schulung.
Es hilft nichts, wir müssen dieses Werk der Haiderwerkstatt nehmen. Ein anderer
Meister, vielleicht gar kein Konstanzer, hat diesmal für den Bischof gearbeitet.
Möglicherweise waren dem Bischof die Haiderreliefs im großen Saal denn doch zu
kümmerlich erschienen, und er hatte sich deshalb nach einem anderen, begabteren
Bildhauer umgesehen. Vielleicht war ihm auch nur an den neuen Formen und
Motiven der Renaissance gelegen, die dieser andere Schnitzer offenbar aus erster
Quelle kannte, im Gegensatz zu den überalterten Kräften der absterbenden Haider-
werkstatt423.
Andere Werkstätten in Konstanz
ULRICH GRIFFENBERG
Der einzige Konstanzer Bildhauer, von dem wir ein unmittelbar beglaubigtes
Abb. 44 Werk haben, ist Ulrich Griffenberg. Er schuf 1479 die steinere Wappentafel für das
Portal des damaligen Rathauses. Das Werk ist heute noch an seinem ursprünglichen
Ort zu sehen (am unteren Fischmarkt) und könnte uns Ausgangspunkt für weitere
Zuschreibungen sein. Aber leider scheint gerade von Griffenberg kein zweites Werk
423 Der Herkunft dieses Schnitzers und seiner Form nachzugehen, gehört nicht in den
Rahmen dieser Arbeit, wäre aber vielleicht ein lohnendes Unterfangen. Allein mit
den oben (Abs. 1) erwähnten Puttendarstellungen von Arbon, Konstanz und Schaff-
hausen haben wir die Werke dreier ähnlicher, aber m. E. nicht identischer (vgl. Anm.
495) Meister der deutschen Frührenaissance.