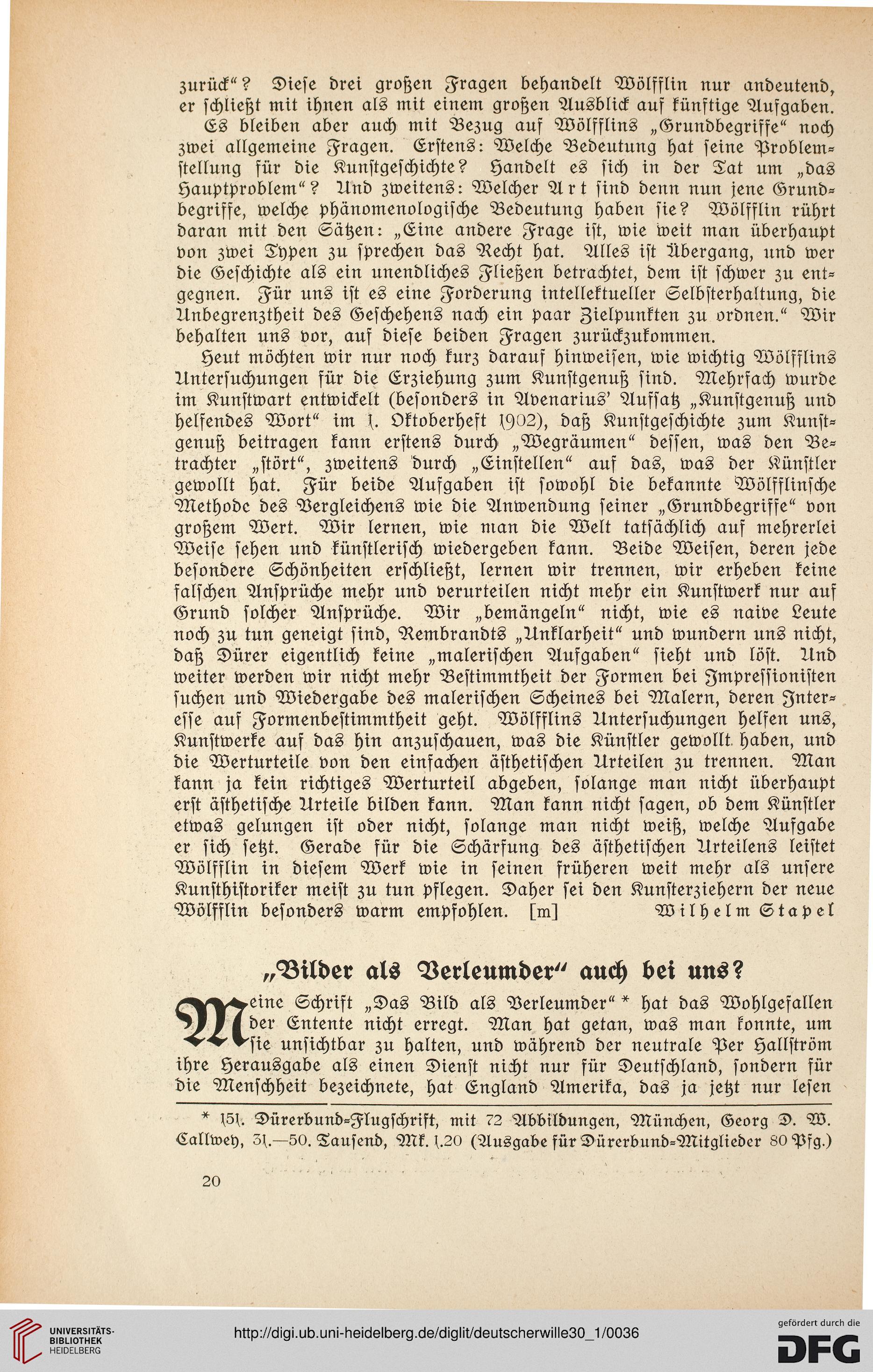zurück"? Diese drei großen Fragen behandelt Wölfflin nur andeutend,
er schließt mit ihnen als mit einem großen Ausblick auf künftige Aufgaben.
Es bleiben aber auch mit Bezug auf Wölfflins „Grundbegriffe^ noch
zwei allgemeine Fragen. Erstens: Welche Bedeutung hat seine Problem-
stellung für die Kunstgeschichte? Handelt es sich in der Tat um „das
tzauptproblem" ? Und zweitens: Welcher Art sind denn nun jene Grund-
degriffe, welche phänomenologische Bedeutung haben sie? Wölfflin rührt
daran mit den Sätzen: „Eine andere Frage ist, wie weit man überhaupt
von zwei Typen zu sprechen das Recht hat. Alles ist Abergang, und wer
die Geschichte als ein unendliches Fließen betrachtet, dem ist schwer zu ent-
gegnen. Für uns ist es eine Forderung intellektueller Selbsterhaltung, die
Unbegrenztheit des Geschehens nach ein paar Zielpunkten zu ordnen." Wir
behalten uns vor, auf diese beiden Fragen zurückzukommen.
tzeut möchten wir nur noch kurz darauf hinweisen, wie wichtig Wölfflins
Antersuchungen für die Erziehung zum Kunstgenuß sind. Mehrfach wurde
im Kunstwart entwickelt (besonders in Avenarius' Aufsatz „Kunstgenuß und
helfendes Wort" im (. Oktoberheft W02), daß Kunstgeschichte zum Kunst-
genuß beitragen kann erstens durch „Wegräumen" dessen, was den Be-
trachter „stört", zweitens durch „Einstellen" auf das, was der Künstler
gewollt hat. Für beide Aufgaben ist sowohl die bekannte Wölfflinsche
Methode des Vergleichens wie die Anwendung seiner „Grundbegriffe" von
großem Wert. Wir lernen, wie man die Welt tatsächlich auf mehrerlei
Weise sehen und künstlerisch wiedergeben kann. Beide Weisen, deren jede
besondere Schönheiten erschließt, lernen wir trennen, wir erheben keine
falschen Ansprüche mehr und verurteilen nicht mehr ein Kunstwerk nur auf
Grund solcher Ansprüche. Wir „bemängeln" nicht, wie es naive Leute
noch zu tun geneigt sind, Rembrandts „Anklarheit" und wundern uns nicht,
daß Dürer eigentlich keine „malerischen Aufgaben" sieht und löst. Ilnd
weiter werden wir nicht mehr Bestimmtheit der Formen bei Impressionisten
suchen und Wiedergabe des malerischen Scheines bei Malern, deren Inter-
esse auf Formenbestimmtheit geht. Wölfflins Untersuchungen helfen uns,
Kunstwerke auf das hin anzuschauen, was die Künstler gewollt haben, und
die Werturteile von den einfachen ästhetischen Urteilen zu trennen. Man
kann ja kein richtiges Werturteil abgeben, solange man nicht überhaupt
erst ästhetische Urteile bilden kann. Man kann nicht sagen, ob dem Künstler
etwas gelungen ist oder nicht, solange man nicht weiß, welche Aufgabe
er sich setzt. Gerade für die Schärfung des ästhetischen Arteilens leistet
Wölfflin in diesem Werk wie in seinen früheren weit mehr als unsere
Kunsthistoriker meist zu tun pflegen. Daher sei den Kunsterziehern der neue
Wölfflin besonders warm empfohlen. Wilhelm Stapel
„Bilder als Verleumder" auch bei uns?
eine Schrift „Das Bild als Verleumder" * hat das Wohlgefallen
der Entente nicht erregt. Man hat getan, was man konnte, um
'sie unsichtbar zu halten, und während der neutrale Per Hallström
ihre Herausgabe als einen Dienst nicht nur für Deutschland, sondern für
die Menschheit bezeichnete, hat England Amerika, das ja jetzt nur lesen
* Dürerbund-Flugschrift, mit 72 Abbildungen, München, Georg D. W.
Eallweh, A-—50. Tausend, Mk. l-20 (Ausgabe für Dürerbund-Mitglieder 80Pfg.)
20
er schließt mit ihnen als mit einem großen Ausblick auf künftige Aufgaben.
Es bleiben aber auch mit Bezug auf Wölfflins „Grundbegriffe^ noch
zwei allgemeine Fragen. Erstens: Welche Bedeutung hat seine Problem-
stellung für die Kunstgeschichte? Handelt es sich in der Tat um „das
tzauptproblem" ? Und zweitens: Welcher Art sind denn nun jene Grund-
degriffe, welche phänomenologische Bedeutung haben sie? Wölfflin rührt
daran mit den Sätzen: „Eine andere Frage ist, wie weit man überhaupt
von zwei Typen zu sprechen das Recht hat. Alles ist Abergang, und wer
die Geschichte als ein unendliches Fließen betrachtet, dem ist schwer zu ent-
gegnen. Für uns ist es eine Forderung intellektueller Selbsterhaltung, die
Unbegrenztheit des Geschehens nach ein paar Zielpunkten zu ordnen." Wir
behalten uns vor, auf diese beiden Fragen zurückzukommen.
tzeut möchten wir nur noch kurz darauf hinweisen, wie wichtig Wölfflins
Antersuchungen für die Erziehung zum Kunstgenuß sind. Mehrfach wurde
im Kunstwart entwickelt (besonders in Avenarius' Aufsatz „Kunstgenuß und
helfendes Wort" im (. Oktoberheft W02), daß Kunstgeschichte zum Kunst-
genuß beitragen kann erstens durch „Wegräumen" dessen, was den Be-
trachter „stört", zweitens durch „Einstellen" auf das, was der Künstler
gewollt hat. Für beide Aufgaben ist sowohl die bekannte Wölfflinsche
Methode des Vergleichens wie die Anwendung seiner „Grundbegriffe" von
großem Wert. Wir lernen, wie man die Welt tatsächlich auf mehrerlei
Weise sehen und künstlerisch wiedergeben kann. Beide Weisen, deren jede
besondere Schönheiten erschließt, lernen wir trennen, wir erheben keine
falschen Ansprüche mehr und verurteilen nicht mehr ein Kunstwerk nur auf
Grund solcher Ansprüche. Wir „bemängeln" nicht, wie es naive Leute
noch zu tun geneigt sind, Rembrandts „Anklarheit" und wundern uns nicht,
daß Dürer eigentlich keine „malerischen Aufgaben" sieht und löst. Ilnd
weiter werden wir nicht mehr Bestimmtheit der Formen bei Impressionisten
suchen und Wiedergabe des malerischen Scheines bei Malern, deren Inter-
esse auf Formenbestimmtheit geht. Wölfflins Untersuchungen helfen uns,
Kunstwerke auf das hin anzuschauen, was die Künstler gewollt haben, und
die Werturteile von den einfachen ästhetischen Urteilen zu trennen. Man
kann ja kein richtiges Werturteil abgeben, solange man nicht überhaupt
erst ästhetische Urteile bilden kann. Man kann nicht sagen, ob dem Künstler
etwas gelungen ist oder nicht, solange man nicht weiß, welche Aufgabe
er sich setzt. Gerade für die Schärfung des ästhetischen Arteilens leistet
Wölfflin in diesem Werk wie in seinen früheren weit mehr als unsere
Kunsthistoriker meist zu tun pflegen. Daher sei den Kunsterziehern der neue
Wölfflin besonders warm empfohlen. Wilhelm Stapel
„Bilder als Verleumder" auch bei uns?
eine Schrift „Das Bild als Verleumder" * hat das Wohlgefallen
der Entente nicht erregt. Man hat getan, was man konnte, um
'sie unsichtbar zu halten, und während der neutrale Per Hallström
ihre Herausgabe als einen Dienst nicht nur für Deutschland, sondern für
die Menschheit bezeichnete, hat England Amerika, das ja jetzt nur lesen
* Dürerbund-Flugschrift, mit 72 Abbildungen, München, Georg D. W.
Eallweh, A-—50. Tausend, Mk. l-20 (Ausgabe für Dürerbund-Mitglieder 80Pfg.)
20