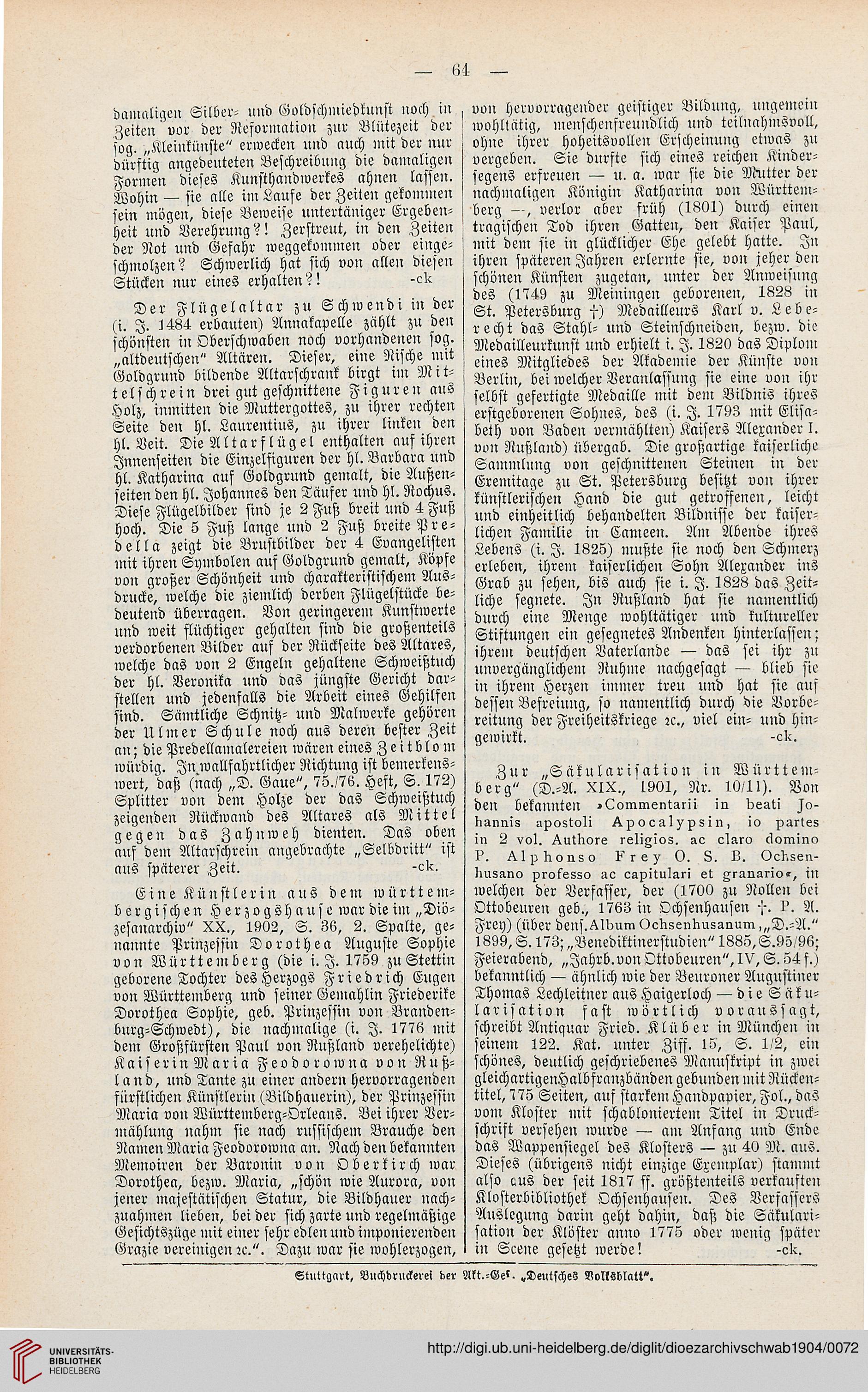damaligen Silber- und Goldschmiedtnnst »och in
Seiten vor der Reformation zur Blütezeit der
sog. „Kleinkünste" erwecken und auch mit der nur
dürftig angedeuteten Beschreibung die damaligen
Formen dieses Kunsthandwerkes ahnen lassen.
Wohin — sie alle im Laufe der Zeiten gekommen
sein mögen, diese Beweise untertäniger Ergeben-
heit und Verehrung?! Zerstreut, i» den Zeiten
der Not und Gefahr weggekommen oder einge-
schmolzen? Schwerlich hat sich von allen diesen
Stücken nur eines erhalten?!
Der Flügelaltar zu Schwendi in der
(i. I. Z484 erbauten) Annakapelle zählt zu den
schönsten in Oberschwabeu noch vorhandenen sog.
„altdeutschen" Altären. Dieser, eine Nische mit
Goldgrund bildende Altarschrank birgt im Mit-
telschrein drei gut geschnittene Figuren aus
Solz, inmitten die Muttergottes, zu ihrer rechten
Seite den hl. Laurentius, zu ihrer linken den
hl. Veit. Die Altarflüget enthalten auf ihren
Junenseiten die Einzelsiguren der hl. Barbara uud
hl. Katharina auf Goldgrund gemalt, die Außen-
seiten den hl. Johannes den Täufer und HI. Rochus.
Diese Flügelbilder sind je 2 Fuß breit uud 4 Fuß
hoch. Die S Fuß lange uud 2 Fuß breite Pre-
della zeigt die Brustbilder der 4 Evangelisten
mit ihren Symbolen auf Goldgrund gemalt, Köpfe
von großer Schönheit uud charakteristischem Aus-
drucke, welche die ziemlich derben Flügelstücke be-
deutend überragen. Von geringerem Kunstwerts
und weit flüchtiger gehalten sind die großenteils
verdorbenen Bilder auf der Rückseite des Altares,
welche das von 2 Engeln gehaltene Schweißtuch
der hl. Veronika und das jüngste Gericht dar-
stellen uud jedenfalls die Arbeit eines Gehilfen
find. Sämtliche Schnitz- und Malwerke gehören
der Ulm er Schule noch aus deren bester Zeit
an; die Predellamalereien wären eines Zeitblom
würdig. Jn.wallsahrtlicher Richtung ist bemerkens-
wert, daß (nach „D. Gaue", 75./76. Heft, S. 172)
Splitter von dem Holze der das Schweißtuch
zeigenden Rückwand des Altares als Mittel
gegen das Zahnweh dienten. Das oben
auf dem Altarschrein angebrachte „Selbdritt" ist
aus späterer Zeit. -ck.
Eine Künstlerin aus dein Württem-
berg i s ch e n Herzogshause war die im „Diö-
zesanarchiv" XX., 1902, S. 36, 2. Spalte, ge-
nannte Prinzessin Dorothea Auguste Sophie
von Württemberg (die i. I. 1759 zu Stettin
geborene Tochter des Herzogs Friedrich Eugen
von Württemberg und seiner Gemahlin Friederike
Dorothea Sophie, geb. Prinzessin von Branden-
burg-Schwedt), die nachmalige (i. I. 1776 mit
dem Großfürsten Panl von Rußland verehelichte)
Kaif erin Maria Feodorowna von Ruß-
land, und Tante zu einer ander» hervorragenden
fürstlichen Künstlerin (Bildhauerin), der Prinzessin
Maria von Württemberg-Orleans. Bei ihrer Ver-
mählung nahm sie nach russischem Brauche den
Namen Maria Feodorowna an. Nach de» bekannten
Memoiren der Baronin von Oberkirch war
Dorothea, bezw. Maria, „schön wie Aurora, von
jener majestätischen Statur, die Bildhauer nach-
zuahmen lieben, beider sich zarte und regelmäßige
Gesichtszüge mit einer sehr edlen und imponierenden
Grazie vereinigen zc.". Dazu war sie wohlerzogen,
^ von hervorragender geistiger Bildung, nngemein
wohllätig, menschenfrenndlich und teilnahmsvoll,
ohne ihrer hoheitsvollen Erscheinnng etwas zn
vergeben. Sie durfte sich eines reichen Kinder-
segens erfreuen — u. a. war sie die Mitter der
nachmaligen Königin Katharina von Württem-
berg —, verlor aber früh (1801) durch einen
tragischen Tod ihren Gatten, den Kaiser Panl,
mit dem sie in glücklicher Ehe gelebt hatte. In
ihren späteren Jahren erlernte sie, von jeher den
schönen Künsten zugetan, unter der Anweisung
des (1749 zu Meiuiugeu geborenen, 1828 in
St. Petersburg -j-) Medailleurs Karl v. Lebe-
recht das Stahl- uud Steinschneiden, bezw. die
Medailleurkunst und erhielt i. 1.1820 das Diplom
eines Mitgliedes der Akademie der Künste von
Berlin, bei welcher Veranlassung sie eine von ihr
selbst gefertigte Medaille mit dein Bildnis ihres
erstgeborenen Sohnes, des (i. I. 1793 »nt Elisa-
beth von Baden vermählten) Kaisers Alexander I.
von Rußland) übergab. Die großartige kaiserliche
Sammlung von geschnittenen Steinen in der
Eremitage zu St. Petersburg besitzt von ihrer
künstlerischen Hand die gut getroffenen, leicht
und einheitlich behandelten Bildnisse der kaiser-
lichen Familie in Camee». Am Abende ihres
Lebens (i. I. 1825) muhte sie noch den Schmerz
erleben, ihrem kaiserlichen Sohn Alexander ins
Grab zu sehen, bis auch sie i. I. 1828 das Zeit-
liche segnete. In Rußland hat sie namentlich
durch eine Menge wohltätiger und kultureller
Stiftungen ein gesegnetes Andenken hinterlassen;
ihrem deutschen Baterlande — das sei ihr zn
unvergänglichem Ruhme nachgesagt — blieb sie
in ihrem Herzen immer treu und hat sie auf
dessen Befreiung, so namentlich durch die Vorbe-
reitung der Freiheitskriege ze., viel ein- und hin-
gewirkt. -ck.
Zur „Säkularisation in Württem-
berg" (D.-A. XIX., 1901, Nr. 10/1 l). Von
den bekannten »Lommentarii !ll deat!
bsnnis upostoli ^ p o c a I y p s i n, io partes
!n 2 vol. ^utliore religiös. sc claro cloininn
1^. ^Iplionso ? r e ^ O. 8. IZ. Ochsen»
Iiusano prosesso ac cspitulzri et xranario-, in
welchen der Verfasser, der (1700 zu Rollen bei
Ottobeuren geb., 1763 in Ochsenhauseu ?. A.
Frey) (über dens.^IdumOcKsei>Kusallui»,„D.-A."
I8S9,S. 173;„Benedikti»erstndien" 1885,S.9ö 96;
Feierabend, „Jahrb. von Ottobeuren", I V, S. 54 f.)
bekanntlich — ähnlich wie der Benroner Augustiner
Thomas Lechleitner aus Haigerloch — dieSäku-
larisatio» fast wörtlich voraussagt,
schreibt Antiquar Fried. Klüb er in München in
seinem 122. Kat. nnter Zisf. 15, S. 1/2, ei»
schönes, deutlich geschriebenes Manuskript in zwei
gleichartigenHalbfranzbänden gebunden mit Rücken-
titel, 775 Seiten, auf starke»! Handpapier, Fol., das
vom Kloster mit schabloiiiertem Titel in Druck-
schrift versehen wurde — am Anfang und Ende
das Wappensiegel des Klosters — zu 40 M. aus.
Dieses (übrigens nicht einzige Exemplar) stammt
also cus der seit 1817 ff. größtenteils verkauften
Klosterbibliothek Ochfenhaufen. Des Verfassers
Auslegung darin geht dahin, daß die Säkulari-
sation der Klöster anno 1775 oder wenig später
in Scene gesetzt werde! -ck.
Stuttgart, Buchdruckers! der Akt.-Gst, .Deutsches Nollöblatt'.
Seiten vor der Reformation zur Blütezeit der
sog. „Kleinkünste" erwecken und auch mit der nur
dürftig angedeuteten Beschreibung die damaligen
Formen dieses Kunsthandwerkes ahnen lassen.
Wohin — sie alle im Laufe der Zeiten gekommen
sein mögen, diese Beweise untertäniger Ergeben-
heit und Verehrung?! Zerstreut, i» den Zeiten
der Not und Gefahr weggekommen oder einge-
schmolzen? Schwerlich hat sich von allen diesen
Stücken nur eines erhalten?!
Der Flügelaltar zu Schwendi in der
(i. I. Z484 erbauten) Annakapelle zählt zu den
schönsten in Oberschwabeu noch vorhandenen sog.
„altdeutschen" Altären. Dieser, eine Nische mit
Goldgrund bildende Altarschrank birgt im Mit-
telschrein drei gut geschnittene Figuren aus
Solz, inmitten die Muttergottes, zu ihrer rechten
Seite den hl. Laurentius, zu ihrer linken den
hl. Veit. Die Altarflüget enthalten auf ihren
Junenseiten die Einzelsiguren der hl. Barbara uud
hl. Katharina auf Goldgrund gemalt, die Außen-
seiten den hl. Johannes den Täufer und HI. Rochus.
Diese Flügelbilder sind je 2 Fuß breit uud 4 Fuß
hoch. Die S Fuß lange uud 2 Fuß breite Pre-
della zeigt die Brustbilder der 4 Evangelisten
mit ihren Symbolen auf Goldgrund gemalt, Köpfe
von großer Schönheit uud charakteristischem Aus-
drucke, welche die ziemlich derben Flügelstücke be-
deutend überragen. Von geringerem Kunstwerts
und weit flüchtiger gehalten sind die großenteils
verdorbenen Bilder auf der Rückseite des Altares,
welche das von 2 Engeln gehaltene Schweißtuch
der hl. Veronika und das jüngste Gericht dar-
stellen uud jedenfalls die Arbeit eines Gehilfen
find. Sämtliche Schnitz- und Malwerke gehören
der Ulm er Schule noch aus deren bester Zeit
an; die Predellamalereien wären eines Zeitblom
würdig. Jn.wallsahrtlicher Richtung ist bemerkens-
wert, daß (nach „D. Gaue", 75./76. Heft, S. 172)
Splitter von dem Holze der das Schweißtuch
zeigenden Rückwand des Altares als Mittel
gegen das Zahnweh dienten. Das oben
auf dem Altarschrein angebrachte „Selbdritt" ist
aus späterer Zeit. -ck.
Eine Künstlerin aus dein Württem-
berg i s ch e n Herzogshause war die im „Diö-
zesanarchiv" XX., 1902, S. 36, 2. Spalte, ge-
nannte Prinzessin Dorothea Auguste Sophie
von Württemberg (die i. I. 1759 zu Stettin
geborene Tochter des Herzogs Friedrich Eugen
von Württemberg und seiner Gemahlin Friederike
Dorothea Sophie, geb. Prinzessin von Branden-
burg-Schwedt), die nachmalige (i. I. 1776 mit
dem Großfürsten Panl von Rußland verehelichte)
Kaif erin Maria Feodorowna von Ruß-
land, und Tante zu einer ander» hervorragenden
fürstlichen Künstlerin (Bildhauerin), der Prinzessin
Maria von Württemberg-Orleans. Bei ihrer Ver-
mählung nahm sie nach russischem Brauche den
Namen Maria Feodorowna an. Nach de» bekannten
Memoiren der Baronin von Oberkirch war
Dorothea, bezw. Maria, „schön wie Aurora, von
jener majestätischen Statur, die Bildhauer nach-
zuahmen lieben, beider sich zarte und regelmäßige
Gesichtszüge mit einer sehr edlen und imponierenden
Grazie vereinigen zc.". Dazu war sie wohlerzogen,
^ von hervorragender geistiger Bildung, nngemein
wohllätig, menschenfrenndlich und teilnahmsvoll,
ohne ihrer hoheitsvollen Erscheinnng etwas zn
vergeben. Sie durfte sich eines reichen Kinder-
segens erfreuen — u. a. war sie die Mitter der
nachmaligen Königin Katharina von Württem-
berg —, verlor aber früh (1801) durch einen
tragischen Tod ihren Gatten, den Kaiser Panl,
mit dem sie in glücklicher Ehe gelebt hatte. In
ihren späteren Jahren erlernte sie, von jeher den
schönen Künsten zugetan, unter der Anweisung
des (1749 zu Meiuiugeu geborenen, 1828 in
St. Petersburg -j-) Medailleurs Karl v. Lebe-
recht das Stahl- uud Steinschneiden, bezw. die
Medailleurkunst und erhielt i. 1.1820 das Diplom
eines Mitgliedes der Akademie der Künste von
Berlin, bei welcher Veranlassung sie eine von ihr
selbst gefertigte Medaille mit dein Bildnis ihres
erstgeborenen Sohnes, des (i. I. 1793 »nt Elisa-
beth von Baden vermählten) Kaisers Alexander I.
von Rußland) übergab. Die großartige kaiserliche
Sammlung von geschnittenen Steinen in der
Eremitage zu St. Petersburg besitzt von ihrer
künstlerischen Hand die gut getroffenen, leicht
und einheitlich behandelten Bildnisse der kaiser-
lichen Familie in Camee». Am Abende ihres
Lebens (i. I. 1825) muhte sie noch den Schmerz
erleben, ihrem kaiserlichen Sohn Alexander ins
Grab zu sehen, bis auch sie i. I. 1828 das Zeit-
liche segnete. In Rußland hat sie namentlich
durch eine Menge wohltätiger und kultureller
Stiftungen ein gesegnetes Andenken hinterlassen;
ihrem deutschen Baterlande — das sei ihr zn
unvergänglichem Ruhme nachgesagt — blieb sie
in ihrem Herzen immer treu und hat sie auf
dessen Befreiung, so namentlich durch die Vorbe-
reitung der Freiheitskriege ze., viel ein- und hin-
gewirkt. -ck.
Zur „Säkularisation in Württem-
berg" (D.-A. XIX., 1901, Nr. 10/1 l). Von
den bekannten »Lommentarii !ll deat!
bsnnis upostoli ^ p o c a I y p s i n, io partes
!n 2 vol. ^utliore religiös. sc claro cloininn
1^. ^Iplionso ? r e ^ O. 8. IZ. Ochsen»
Iiusano prosesso ac cspitulzri et xranario-, in
welchen der Verfasser, der (1700 zu Rollen bei
Ottobeuren geb., 1763 in Ochsenhauseu ?. A.
Frey) (über dens.^IdumOcKsei>Kusallui»,„D.-A."
I8S9,S. 173;„Benedikti»erstndien" 1885,S.9ö 96;
Feierabend, „Jahrb. von Ottobeuren", I V, S. 54 f.)
bekanntlich — ähnlich wie der Benroner Augustiner
Thomas Lechleitner aus Haigerloch — dieSäku-
larisatio» fast wörtlich voraussagt,
schreibt Antiquar Fried. Klüb er in München in
seinem 122. Kat. nnter Zisf. 15, S. 1/2, ei»
schönes, deutlich geschriebenes Manuskript in zwei
gleichartigenHalbfranzbänden gebunden mit Rücken-
titel, 775 Seiten, auf starke»! Handpapier, Fol., das
vom Kloster mit schabloiiiertem Titel in Druck-
schrift versehen wurde — am Anfang und Ende
das Wappensiegel des Klosters — zu 40 M. aus.
Dieses (übrigens nicht einzige Exemplar) stammt
also cus der seit 1817 ff. größtenteils verkauften
Klosterbibliothek Ochfenhaufen. Des Verfassers
Auslegung darin geht dahin, daß die Säkulari-
sation der Klöster anno 1775 oder wenig später
in Scene gesetzt werde! -ck.
Stuttgart, Buchdruckers! der Akt.-Gst, .Deutsches Nollöblatt'.