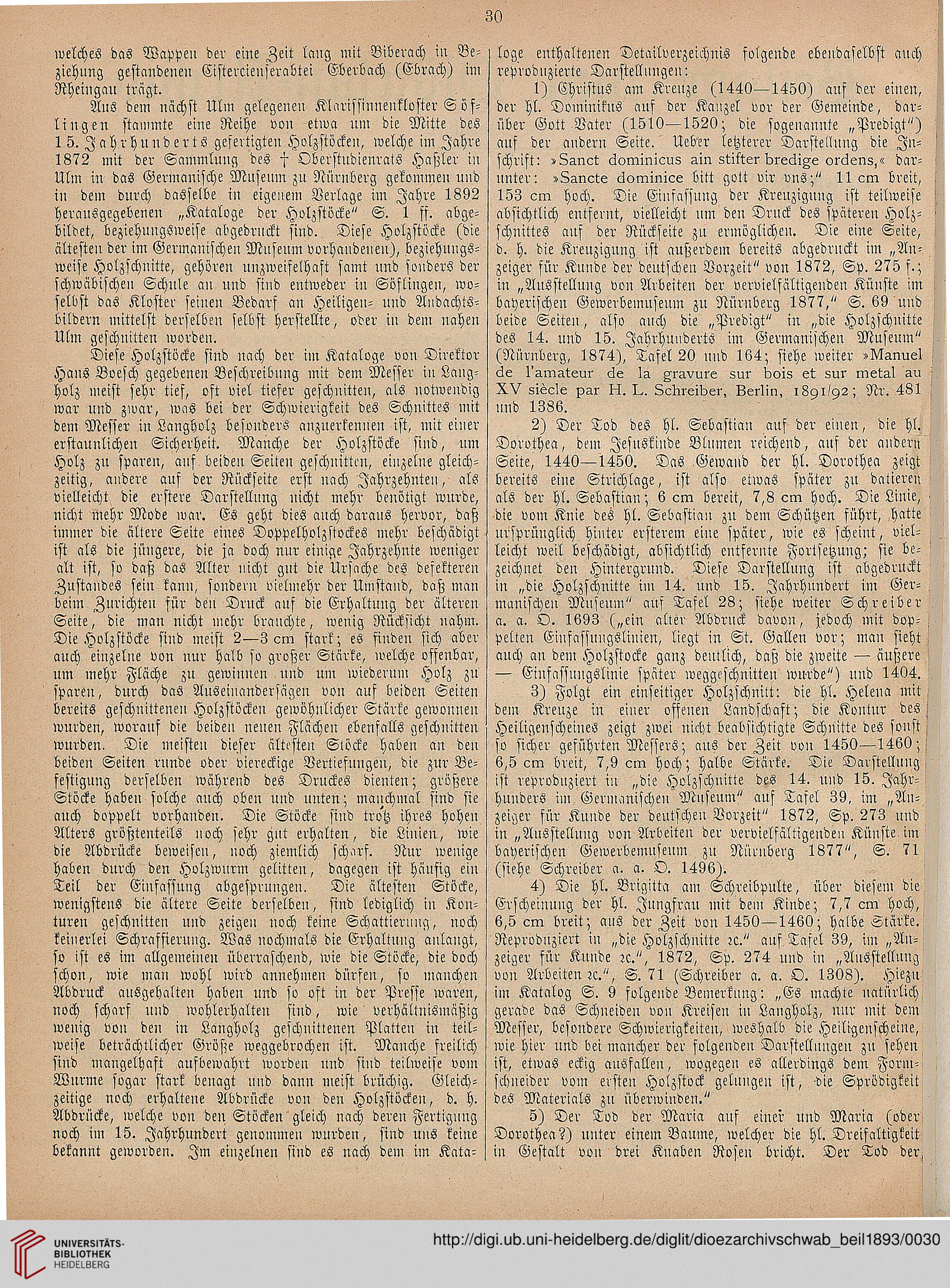30
welches das Wappen der eine Zeit lang mit Biberach in Be-
ziehung gestandenen Cistercienserabtei Eberbach (Ebrach) im
Rheingau trägt.
Ans dem nächst Ulm gelegenen Klarissinnenkloster S öf-
lingen stammte eine Reihe von etwa um die Mitte deö
1 5. Jahrhunderts gefertigten Holzstöcken, welche im Jahre
1872 mit der Sammlung des f Oberstudienrats Häßler in
Ulm in das Germanische Museum zu Nürnberg gekommen und
in dem durch dasselbe in eigenem Verlage im Jahre 1892
herausgegebenen „Kataloge der Hvlzstöcke" S. 1 ff. abge-
bildet, beziehungsweise abgedrnckt sind.. Diese Hvlzstöcke (die
ältesten der im Germanischen Museum vorhandenen), beziehungs-
weise Holzschnitte, gehören unzweifelhaft samt und sonders der
schwäbische» Schule an und sind entweder in Söflingen, wo-
selbst das Kloster seinen Bedarf an Heiligen- und Andachts-
bildern mittelst derselben selbst herstellte, oder in dem nahen
Ulm geschnitten worden.
Diese Holzstöcke sind nach der im Kataloge von Direktor
Hans Boesch gegebenen Beschreibung mit dem Messer in Lang-
holz meist sehr tief, oft viel tiefer geschnitten, als notwendig
war und zwar, was bei der Schwierigkeit des Schnittes mit
dem Messer in Langholz besonders anzuerkennen ist, mit einer
erstaunlichen Sicherheit. Manche der Holzstöcke sind, um
Holz zu sparen, ans beiden Seiten geschnitten, einzelne gleich-
zeitig, andere auf der Rückseite erst nach Jahrzehnten, als
vielleicht die erstere Darstellung nicht mehr benötigt wurde,
nicht mehr Mode war. Es geht dies auch daraus hervor, daß
immer die ältere Seite eines Doppelholzstockes mehr beschädigt
ist als die jüngere, die ja doch nur einige Jahrzehnte weniger
alt ist, so daß das Alter nicht gut die Ursache des defekteren
Zustandes sein kann, sondern vielmehr der Umstand, daß man
beim Zurichten für den Druck auf die Erhaltung der älteren
Seite, die man nicht mehr brauchte, wenig Rücksicht nahm.
Die Holzstöcke sind meist 2—3 cm stark; es finden sich aber
auch einzelne von nur halb so großer Stärke, welche offenbar,
um mehr Fläche zu gewinnen und um wiederum Holz zu
sparen, durch das Auseinandersägen von auf beiden Seiten
bereits geschnittenen Holzstöcken gewöhnlicher Stärke gewonnen
wurden, worauf die beiden neuen Flächen ebenfalls geschnitten
wurden. Die meisten dieser ältesten Stöcke haben an den
beiden Seiten runde oder viereckige Vertiefungen, die zur Be-
festigung derselben während des Druckes dienten; größere
Stöcke haben solche auch oben und unten; manchmal sind sie
auch doppelt vorhanden. Die Stöcke sind trotz ihres hohen
Alters größtenteils noch sehr gut erhalten, die Linien, wie
die Abdrücke beweisen, noch ziemlich scharf. Nur wenige
haben durch den Holzwurm gelitten, dagegen ist häufig ein
Teil der Einfassung abgesprungen. Die ältesten Stöcke,
wenigstens die ältere Seite derselben, sind lediglich in Kon-
turen geschnitten und zeigen noch keine Schattierung, noch
keinerlei Schraffierung. Was nochmals die Erhaltung anlangt,
so ist es im allgemeinen überraschend, wie die Stöcke, die doch
schon, wie man wohl wird annehmen dürfen, so manchen
Abdruck ausgehalten haben und so oft in der Presse waren,
noch scharf und wohlerhalten sind, wie verhältnismäßig
wenig von den in Langholz geschnittenen Platten in teil-
weise beträchtlicher Größe weggebrochen ist. Manche freilich
sind mangelhaft aufbewahrt worden und sind teilweise vom
Wurme sogar stark benagt und dann meist brüchig. Gleich-
zeitige noch erhaltene Abdrücke von den Holzstöcken, d. h.
Abdrücke, welche von den Stöcken gleich nach deren Fertigung
noch im 15. Jahrhundert genommen wurden, sind uns keine
bekannt geworden. Im einzelnen sind es nach dem im Kata-
loge enthaltenen Detailverzeichnis folgende ebettdaselbst auch
reproduzierte Darstellungen:
1) Christus am Kreuze (1440—1450) auf der einen,
der hl. Dominikus auf der Kanzel vor der Gemeinde, dar-
über Gott Vater (1510—1520; die sogenannte „Predigt")
auf der andern Seite, lieber letzterer Darstellung die In-
schrift: »Sand: dominicus ain Stifter bredige ordens,« dar-
unter : »Sancte dominice bitt gott vir vns;" 11 cm breit,
153 cm hoch. Die Einfassung der Kreuzigung ist teilweise
absichtlich entfernt, vielleicht um den Druck des späteren Holz-
schnittes auf der Rückseite zu ermöglichen. Die eine Seite,
d. h. die Kreuzigung ist außerdem bereits abgedruckt im „An-
zeiger für Kunde der deutschen Vorzeit" von 1872, Sp. 275 f.;
in „Ausstellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste im
bayerischen Gewerbemuseum zu Nürnberg 1877," S. 69 und
beide Seiten, also auch die „Predigt" in „die Holzschnitte
des 14. und 15. Jahrhunderts im Germanischen Museum"
(Nürnberg, 1874), Tafel 20 und 164; siehe weiter »Marmel
de l’amateur de la gravure sur bois et sur metal au
XV siede par H. L. Schreiber, Berlin, 1891/92; Nr. 481
und 1386.
2) Der Tod des hl. Sebastian auf der einen, die hl.
Dorothea, dem Jesuskinde Blumen reichend , auf der andern
Seite, 1440—1450. Das Gewand der hl. Dorothea zeigt
bereits eine Strichlage, ist also etwas später zu datieren )
als der hl. Sebastian; 6 cm bereit, 7,8 cm hoch. Die Linie, -
die vom Knie des hl. Sebastian zu dem Schützen führt, .hatte
ursprünglich hinter ersterem eine später, wie es scheint, viel-
leicht weil beschädigt, absichtlich entfernte Fortsetzung; sie be-
zeichnet den Hintergrund. Diese Darstellung ist abgedruckt
in „die Holzschnitte im 14. und 15. Jahrhundert im Ger- .
manischen Museum" auf Tafel 28; siehe weiter Schreiber
а. a. O. 1693 („ein alter Abdruck davon, jedoch mit dop-
pelten Einfassnngslinien, liegt in St. Gallen vor; man sieht.
auch an dem Holzstocke ganz deutlich, daß die zweite — äußere
— Einsassungslinie später weggeschnitten wurde") und 1404.
3) Folgt ein einseitiger Holzschnitt: die hl. Helena mit
dem Kreuze in einer offenen Landschaft; die Kontur des)
Heiligenscheines zeigt zwei nicht beabsichtigte Schnitte des sonst
so sicher geführten Messers; aus der Zeit von 1450—1460; j
б, 5 cm breit, 7,9 cm hoch; halbe Stärke. Die Darstellung
ist reproduziert in „die Holzschnitte des 14. und 15. Jahr-)
hunders im Germanischen Museum" auf Tafel 39, im „An-
zeiger für Kunde der deutschen Vorzeit" 1872, Sp. 273 und
in „Ausstellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste im
bayerischen Gewerbemuseum zu Nürnberg 1877", S. 71
(siehe Schreiber a. a. O. 1496).
4) Die hl. Brigitta am Schreibpulte, über diesem die
Erscheinung der hl. Jungfrau mit dem Kinde; 7,7 cm hoch,
6,5 cm breit; ans der Zeit von 1450—1460; halbe Stärke.
Reproduziert in „die Holzschnitte re." auf Tafel 39, int „An-
zeiger für Kunde re.", 1872, Sp. 274 und in „Ausstellung
von Arbeiten re.", S. 71 (Schreiber a. a. O. 1308). Hiezu
im Katalog S. 9 folgende Bemerkung: „Es machte natürlich
gerade das Schneiden von Kreisen in Langholz, nur mit dem
Messer, besondere Schwierigkeiten, weshalb die Heiligenscheine,
wie hier und bei mancher der folgenden Darstellungen zu sehen
ist, etwas eckig ansfallen, wogegen es allerdings dem Form-
schneider vom ersten Holzstock gelungen ist, die Sprödigkeit
des Materials zu überwinden."
5) Der Tod der Maria anf einer und Maria (oder
Dorothea?) unter einem Baume, welcher die hl. Dreifaltigkeit
in Gestalt von drei Knaben Rosen bricht. Der Tod der,
welches das Wappen der eine Zeit lang mit Biberach in Be-
ziehung gestandenen Cistercienserabtei Eberbach (Ebrach) im
Rheingau trägt.
Ans dem nächst Ulm gelegenen Klarissinnenkloster S öf-
lingen stammte eine Reihe von etwa um die Mitte deö
1 5. Jahrhunderts gefertigten Holzstöcken, welche im Jahre
1872 mit der Sammlung des f Oberstudienrats Häßler in
Ulm in das Germanische Museum zu Nürnberg gekommen und
in dem durch dasselbe in eigenem Verlage im Jahre 1892
herausgegebenen „Kataloge der Hvlzstöcke" S. 1 ff. abge-
bildet, beziehungsweise abgedrnckt sind.. Diese Hvlzstöcke (die
ältesten der im Germanischen Museum vorhandenen), beziehungs-
weise Holzschnitte, gehören unzweifelhaft samt und sonders der
schwäbische» Schule an und sind entweder in Söflingen, wo-
selbst das Kloster seinen Bedarf an Heiligen- und Andachts-
bildern mittelst derselben selbst herstellte, oder in dem nahen
Ulm geschnitten worden.
Diese Holzstöcke sind nach der im Kataloge von Direktor
Hans Boesch gegebenen Beschreibung mit dem Messer in Lang-
holz meist sehr tief, oft viel tiefer geschnitten, als notwendig
war und zwar, was bei der Schwierigkeit des Schnittes mit
dem Messer in Langholz besonders anzuerkennen ist, mit einer
erstaunlichen Sicherheit. Manche der Holzstöcke sind, um
Holz zu sparen, ans beiden Seiten geschnitten, einzelne gleich-
zeitig, andere auf der Rückseite erst nach Jahrzehnten, als
vielleicht die erstere Darstellung nicht mehr benötigt wurde,
nicht mehr Mode war. Es geht dies auch daraus hervor, daß
immer die ältere Seite eines Doppelholzstockes mehr beschädigt
ist als die jüngere, die ja doch nur einige Jahrzehnte weniger
alt ist, so daß das Alter nicht gut die Ursache des defekteren
Zustandes sein kann, sondern vielmehr der Umstand, daß man
beim Zurichten für den Druck auf die Erhaltung der älteren
Seite, die man nicht mehr brauchte, wenig Rücksicht nahm.
Die Holzstöcke sind meist 2—3 cm stark; es finden sich aber
auch einzelne von nur halb so großer Stärke, welche offenbar,
um mehr Fläche zu gewinnen und um wiederum Holz zu
sparen, durch das Auseinandersägen von auf beiden Seiten
bereits geschnittenen Holzstöcken gewöhnlicher Stärke gewonnen
wurden, worauf die beiden neuen Flächen ebenfalls geschnitten
wurden. Die meisten dieser ältesten Stöcke haben an den
beiden Seiten runde oder viereckige Vertiefungen, die zur Be-
festigung derselben während des Druckes dienten; größere
Stöcke haben solche auch oben und unten; manchmal sind sie
auch doppelt vorhanden. Die Stöcke sind trotz ihres hohen
Alters größtenteils noch sehr gut erhalten, die Linien, wie
die Abdrücke beweisen, noch ziemlich scharf. Nur wenige
haben durch den Holzwurm gelitten, dagegen ist häufig ein
Teil der Einfassung abgesprungen. Die ältesten Stöcke,
wenigstens die ältere Seite derselben, sind lediglich in Kon-
turen geschnitten und zeigen noch keine Schattierung, noch
keinerlei Schraffierung. Was nochmals die Erhaltung anlangt,
so ist es im allgemeinen überraschend, wie die Stöcke, die doch
schon, wie man wohl wird annehmen dürfen, so manchen
Abdruck ausgehalten haben und so oft in der Presse waren,
noch scharf und wohlerhalten sind, wie verhältnismäßig
wenig von den in Langholz geschnittenen Platten in teil-
weise beträchtlicher Größe weggebrochen ist. Manche freilich
sind mangelhaft aufbewahrt worden und sind teilweise vom
Wurme sogar stark benagt und dann meist brüchig. Gleich-
zeitige noch erhaltene Abdrücke von den Holzstöcken, d. h.
Abdrücke, welche von den Stöcken gleich nach deren Fertigung
noch im 15. Jahrhundert genommen wurden, sind uns keine
bekannt geworden. Im einzelnen sind es nach dem im Kata-
loge enthaltenen Detailverzeichnis folgende ebettdaselbst auch
reproduzierte Darstellungen:
1) Christus am Kreuze (1440—1450) auf der einen,
der hl. Dominikus auf der Kanzel vor der Gemeinde, dar-
über Gott Vater (1510—1520; die sogenannte „Predigt")
auf der andern Seite, lieber letzterer Darstellung die In-
schrift: »Sand: dominicus ain Stifter bredige ordens,« dar-
unter : »Sancte dominice bitt gott vir vns;" 11 cm breit,
153 cm hoch. Die Einfassung der Kreuzigung ist teilweise
absichtlich entfernt, vielleicht um den Druck des späteren Holz-
schnittes auf der Rückseite zu ermöglichen. Die eine Seite,
d. h. die Kreuzigung ist außerdem bereits abgedruckt im „An-
zeiger für Kunde der deutschen Vorzeit" von 1872, Sp. 275 f.;
in „Ausstellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste im
bayerischen Gewerbemuseum zu Nürnberg 1877," S. 69 und
beide Seiten, also auch die „Predigt" in „die Holzschnitte
des 14. und 15. Jahrhunderts im Germanischen Museum"
(Nürnberg, 1874), Tafel 20 und 164; siehe weiter »Marmel
de l’amateur de la gravure sur bois et sur metal au
XV siede par H. L. Schreiber, Berlin, 1891/92; Nr. 481
und 1386.
2) Der Tod des hl. Sebastian auf der einen, die hl.
Dorothea, dem Jesuskinde Blumen reichend , auf der andern
Seite, 1440—1450. Das Gewand der hl. Dorothea zeigt
bereits eine Strichlage, ist also etwas später zu datieren )
als der hl. Sebastian; 6 cm bereit, 7,8 cm hoch. Die Linie, -
die vom Knie des hl. Sebastian zu dem Schützen führt, .hatte
ursprünglich hinter ersterem eine später, wie es scheint, viel-
leicht weil beschädigt, absichtlich entfernte Fortsetzung; sie be-
zeichnet den Hintergrund. Diese Darstellung ist abgedruckt
in „die Holzschnitte im 14. und 15. Jahrhundert im Ger- .
manischen Museum" auf Tafel 28; siehe weiter Schreiber
а. a. O. 1693 („ein alter Abdruck davon, jedoch mit dop-
pelten Einfassnngslinien, liegt in St. Gallen vor; man sieht.
auch an dem Holzstocke ganz deutlich, daß die zweite — äußere
— Einsassungslinie später weggeschnitten wurde") und 1404.
3) Folgt ein einseitiger Holzschnitt: die hl. Helena mit
dem Kreuze in einer offenen Landschaft; die Kontur des)
Heiligenscheines zeigt zwei nicht beabsichtigte Schnitte des sonst
so sicher geführten Messers; aus der Zeit von 1450—1460; j
б, 5 cm breit, 7,9 cm hoch; halbe Stärke. Die Darstellung
ist reproduziert in „die Holzschnitte des 14. und 15. Jahr-)
hunders im Germanischen Museum" auf Tafel 39, im „An-
zeiger für Kunde der deutschen Vorzeit" 1872, Sp. 273 und
in „Ausstellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste im
bayerischen Gewerbemuseum zu Nürnberg 1877", S. 71
(siehe Schreiber a. a. O. 1496).
4) Die hl. Brigitta am Schreibpulte, über diesem die
Erscheinung der hl. Jungfrau mit dem Kinde; 7,7 cm hoch,
6,5 cm breit; ans der Zeit von 1450—1460; halbe Stärke.
Reproduziert in „die Holzschnitte re." auf Tafel 39, int „An-
zeiger für Kunde re.", 1872, Sp. 274 und in „Ausstellung
von Arbeiten re.", S. 71 (Schreiber a. a. O. 1308). Hiezu
im Katalog S. 9 folgende Bemerkung: „Es machte natürlich
gerade das Schneiden von Kreisen in Langholz, nur mit dem
Messer, besondere Schwierigkeiten, weshalb die Heiligenscheine,
wie hier und bei mancher der folgenden Darstellungen zu sehen
ist, etwas eckig ansfallen, wogegen es allerdings dem Form-
schneider vom ersten Holzstock gelungen ist, die Sprödigkeit
des Materials zu überwinden."
5) Der Tod der Maria anf einer und Maria (oder
Dorothea?) unter einem Baume, welcher die hl. Dreifaltigkeit
in Gestalt von drei Knaben Rosen bricht. Der Tod der,