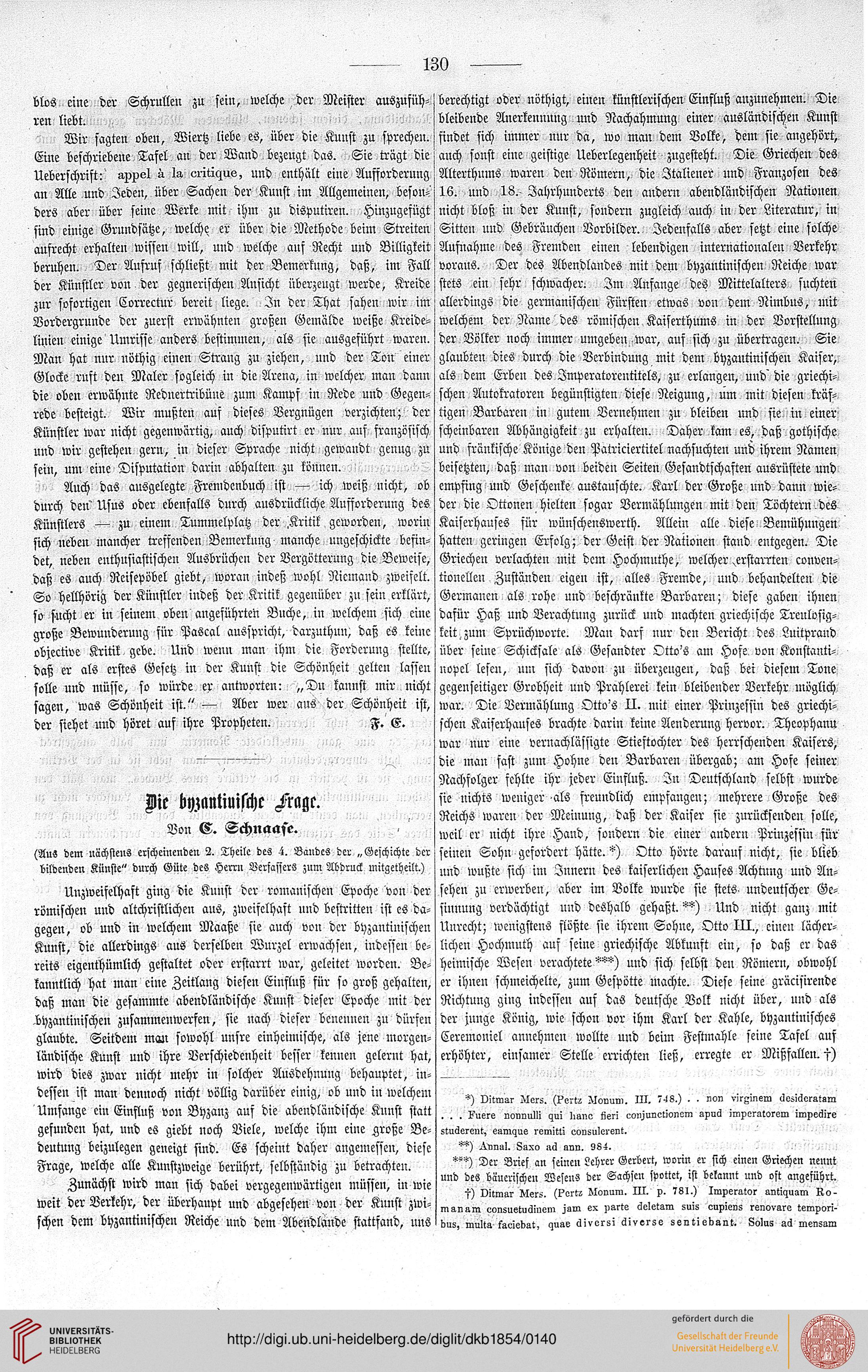130
blos eine der Schrullen zu sein, welche der Meister auszufüh- berechtigt oder nöthigt, einen künstlerischen Einfluß anzunehmen. Die
ren liebt. bleibende Anerkennung und Nachahmung einer ausländischen Kunst
Wir sagten oben, Wiertz liebe es, über die Kunst zu sprechen.! findet sich immer nur da, wo man dem Volke, dem sie angehört,
Eine beschriebene Tasel au der Wand bezeugt das. Sie trägt die i auch sonst eine geistige Überlegenheit zugesteht. Die Griechen des
Überschrift: appel ä la critique, und enthält eine Aufforderung! Alterthums waren den Römern, die Italiener und Franzosen des
an Alle und Jeden, über Sachen der Kunst im Allgemeinen, beson- 16. und 18.- Jahrhunderts den andern abendländischen Nationen
ders aber über seine Werke mit ihm zu disputiren. Hinzugesügt nicht bloß in der Kunst, sondern zugleich auch in der Literatur, in
sind einige Grundsätze, welche er über die Methode beim Streiten! Sitten und Gebräuchen Vorbilder. Jedenfalls aber setzt eine solche
aufrecht erhalten wissen will, und welche auf Recht und Billigkeit! Aufnahme des Fremden einen lebendigen internationalen Verkehr
beruhen. Der Aufruf schließt mit der Bemerkung, daß, im Fall! voraus. Der des Abendlandes mit dem byzantinischen Reiche war
der Künstler von der gegnerischen Ansicht überzeugt werde, Kreide! stets ein sehr schwacher. Im Anfänge des Mittelalters suchten
zur sofortigen Correctur bereit liege. In der That sahen wir im allerdings die germanischen Fürsten etwas von dem Nimbus, mit
Vordergründe der zuerst erwähnten großen Gemälde weiße Kreide-
linien einige Umrisse anders bestimmen, als sie ausgeführt waren.
Man hat nur nöthig einen Sttang zu ziehen, und der Ton einer
Glocke ruft den Maler sogleich in die Arena, in welcher man dann
die oben erwähnte Rednertribüne zum Kampf in Rede und Gegen-
rede besteigt. Wir mußten auf dieses Vergnügen verzichten!; der
Künstler war nicht gegenwärtig, auch disputirt er nur auf französisch
und wir gestehen gern, in dieser Sprache nicht gewandt genug zu
sein, um eine Disputation darin abhalten, zu können.
Auch das ausgelegte Fremdenbuch ist — ich weiß nicht, ob
durch den" Usus oder ebenfalls durch ausdrückliche Aufforderung des
Künstlers — zu einem Tummelplatz der Kritik geworden, worin
sich neben mancher treffenden Bemerkung manche ungeschickte befin-
det, neben enthusiastischen Ausbrüchen der Vergötterung die Beweise,
daß es auch Reisepöbel giebt, woran indeß wohl Niemand zweifelt.
So hellhörig der Künstler indeß der Kritik gegenüber zu sein erklärt,
so sucht er in seinem oben angeführten Buche, in welchem sich eine
große Bewunderung für Pascal ausspricht, darzuthun, daß es keine
objective Kritik gebe. Und wenn man ihm die Forderung stellte,
daß er als erstes Gesetz in der Kunst die Schönheit gelten lassen
solle und müsse, so würde er antworten: „Du kannst mir nicht
sagen, was Schönheit ist." — Aber wer aus der Schönheit ist,
der siehet und höret auf ihre Propheten.
F. E.
Jic byzantiuischc /ragt.
Von C. Schnaase. -
(Aus dem nächstens erscheinenden 2. Theile des 1. Bandes der „Geschichte der
bildenden Künste" durch Güte des Herrn Verfassers zum Abdruck mitgetheilt.)
Unzweifelhaft ging die Kunst der romanischen Epoche von der
römischen und altchristlichen aus, zlveifelhaft und besttitten ist es da-
gegen, ob und in welchem Maaße sie auch von der byzantinischen
Kunst, die allerdings aus derselben Wurzel erwachsen, indessen be-
reits eigenthümlich gestaltet oder erstarrt war, geleitet worden. Be-
kanntlich hat man eine Zeitlang diesen Einfluß für so groß gehalten,
daß man die gesammte abendländische Kunst dieser Epoche mit der
byzantinischen zusammenwerfen, sie nach dieser benennen zu dürfen
glaubte. Seitdem man sowohl unsre einheimische, als jene morgen-
ländische Kunst und ihre Verschiedenheit besser kennen gelernt hat,
wird dies zwar nicht mehr in solcher Ausdehnung behauptet, in-
dessen ist man dennoch nicht völlig darüber einig, ob und in welchem
Umfange ein Einfluß von Byzanz aus die abendländische Kunst statt
gefunden hat, und es giebt noch Viele, welche ihm eine Zroße Be-
deuttmg beizulegen geneigt sind. Es scheint daher angemessen, diese
Frage, welche alle Kunstzweige berührt, selbständig zu betrachten.
Zunächst wird man sich dabei vergegenwärtigen müssen, in wie
weit der Verkehr, der überhaupt und abgesehen von der Kunst zwi-
schen dem byzanttnischen Reiche und dem Abendlande stattfand, uns
welchem der Name des römischen Kaiserthums in der Vorstellung
der Völker noch immer umgeben war, auf sich zu übertragen. Sie
glaubten dies durch die Verbindung mit dem byzantinischen Kaiser,
als dem Erben des Jmperatorentitels, zu erlangen, und' die griechi-
schen Autokratoren begünstigten diese Neigung, um mit diesen kräf-
tigen Barbaren in gutem Vernehmen zu bleiben und sie in einer
scheinbaren Abhängigkeit zu erhalten. Daher kam es, daß gothische
und fränkische Könige den Pairiciertitel nachsuchten und ihrem Namen
beisetzten, daß man von beiden Seiten Gesandtschaften ausrüstete und
empfing und Geschenke austauschte. Karl der Große und dann wie-
der die Ottonen hielten sogar Vermählungen mit den Töchtern.des
Kaiserhauses für wünschenswerth. Allein alle diese Bemühungen
hatten geringen Erfolg; der Geist der Nationen stand entgegen. Die
Griechen verlachten mit dem Hochmuthe, welcher erstarrten conven-
tionellen Zuständen eigen ist, alles Fremde, und behandelten die
Germanen als rohe und beschränkte Barbaren; diese gaben ihnen
dafür Haß und Verachtung zurück und machten griechische Treulosig-
keit zum Sprüchworte. Man darf nur den Bericht des Luitpraud
über seine Schicksale als Gesandter Otto's am Hofe, von Konstanti-
nopel lesen, um sich davon zu überzeugen, daß bei diesem Tone
gegenseitiger Grobheit und Prahlerei kein bleibender Verkehr möglich
war. Die Vermählung Otto's II. mit einer Prinzessin des griechi-
schen Kaiserhauses brachte darin keine Aenderung hervor. Theophanu
war nur eine vernachlässigte Stieftochter des herrschenden Kaisers,
die man fast zum Hohne den Barbaren übergab; am Hofe seiner
Nachfolger fehlte ihr jeder Einfluß. In Deutschland selbst wurde
sie nichts weniger -als freundlich empfangen; mehrere Große des
Reichs waren der Meinung, daß der Kaiser sie zurücksenden solle,
weil er nicht ihre Hand, sondern die einer andern Prinzessin für
seinen Sohn gefordert hätte. *) Otto hörte darauf nicht, sie blieb
imd wußte sich im Innern des kaiserlichen Hauses Achttmg und An-
sehen zu erwerben, aber im Volke wurde sie stets- undeutscher Ge-
sinnung verdächtigt und deshalb gehaßt. **) Und nicht ganz mit
Unrecht; wenigstens flößte sie ihrem Sohne, Otto III., einen lächer-
lichen Hochmuth auf seine griechische Abkunft ein, so daß er das
heimische Wesen verachtete***) und sich selbst den Römern, obwohl
er ihnen schmeichelte, zum Gespötte machte. Diese seine gräcisirende
Richtung ging indessen auf das deutsche Volk nicht über, und als
der junge König, wie schon vor ihm Karl der Kahle, byzantinisches
Ceremoniel annehmen wollte und beim Festmahle seine Tafel auf
erhöhter, einsamer Stelle errichten ließ, erregte er Mißfallen./)
*) Ditmar Mers. (Pertz Monum. III. 745.) . . non virginem desidcratam
. . . Fuere nonnulli qui lmnc fieri conjunctioncm apud imperatorem impedire
studerent, eamque remitti consulerent.
**) Atonal. Saxo ad arm. 984.
***) Der Brief an seinen Lehrer Gerbert, worin er sich einen Griechen nennt
und des Läuerischen Wesens der Sachsen spottet, ist bekannt und oft angeführt.
f) Ditmar Mers. (Pertz Monura. III. p. 781.) Imperator antiquam Ro-
man am consuetudinem jam ex parte deletam suis cupiens renovare tempori-
bus, multa faciebat, quae diversi diverse sentiebant. Solus ad mensam
blos eine der Schrullen zu sein, welche der Meister auszufüh- berechtigt oder nöthigt, einen künstlerischen Einfluß anzunehmen. Die
ren liebt. bleibende Anerkennung und Nachahmung einer ausländischen Kunst
Wir sagten oben, Wiertz liebe es, über die Kunst zu sprechen.! findet sich immer nur da, wo man dem Volke, dem sie angehört,
Eine beschriebene Tasel au der Wand bezeugt das. Sie trägt die i auch sonst eine geistige Überlegenheit zugesteht. Die Griechen des
Überschrift: appel ä la critique, und enthält eine Aufforderung! Alterthums waren den Römern, die Italiener und Franzosen des
an Alle und Jeden, über Sachen der Kunst im Allgemeinen, beson- 16. und 18.- Jahrhunderts den andern abendländischen Nationen
ders aber über seine Werke mit ihm zu disputiren. Hinzugesügt nicht bloß in der Kunst, sondern zugleich auch in der Literatur, in
sind einige Grundsätze, welche er über die Methode beim Streiten! Sitten und Gebräuchen Vorbilder. Jedenfalls aber setzt eine solche
aufrecht erhalten wissen will, und welche auf Recht und Billigkeit! Aufnahme des Fremden einen lebendigen internationalen Verkehr
beruhen. Der Aufruf schließt mit der Bemerkung, daß, im Fall! voraus. Der des Abendlandes mit dem byzantinischen Reiche war
der Künstler von der gegnerischen Ansicht überzeugt werde, Kreide! stets ein sehr schwacher. Im Anfänge des Mittelalters suchten
zur sofortigen Correctur bereit liege. In der That sahen wir im allerdings die germanischen Fürsten etwas von dem Nimbus, mit
Vordergründe der zuerst erwähnten großen Gemälde weiße Kreide-
linien einige Umrisse anders bestimmen, als sie ausgeführt waren.
Man hat nur nöthig einen Sttang zu ziehen, und der Ton einer
Glocke ruft den Maler sogleich in die Arena, in welcher man dann
die oben erwähnte Rednertribüne zum Kampf in Rede und Gegen-
rede besteigt. Wir mußten auf dieses Vergnügen verzichten!; der
Künstler war nicht gegenwärtig, auch disputirt er nur auf französisch
und wir gestehen gern, in dieser Sprache nicht gewandt genug zu
sein, um eine Disputation darin abhalten, zu können.
Auch das ausgelegte Fremdenbuch ist — ich weiß nicht, ob
durch den" Usus oder ebenfalls durch ausdrückliche Aufforderung des
Künstlers — zu einem Tummelplatz der Kritik geworden, worin
sich neben mancher treffenden Bemerkung manche ungeschickte befin-
det, neben enthusiastischen Ausbrüchen der Vergötterung die Beweise,
daß es auch Reisepöbel giebt, woran indeß wohl Niemand zweifelt.
So hellhörig der Künstler indeß der Kritik gegenüber zu sein erklärt,
so sucht er in seinem oben angeführten Buche, in welchem sich eine
große Bewunderung für Pascal ausspricht, darzuthun, daß es keine
objective Kritik gebe. Und wenn man ihm die Forderung stellte,
daß er als erstes Gesetz in der Kunst die Schönheit gelten lassen
solle und müsse, so würde er antworten: „Du kannst mir nicht
sagen, was Schönheit ist." — Aber wer aus der Schönheit ist,
der siehet und höret auf ihre Propheten.
F. E.
Jic byzantiuischc /ragt.
Von C. Schnaase. -
(Aus dem nächstens erscheinenden 2. Theile des 1. Bandes der „Geschichte der
bildenden Künste" durch Güte des Herrn Verfassers zum Abdruck mitgetheilt.)
Unzweifelhaft ging die Kunst der romanischen Epoche von der
römischen und altchristlichen aus, zlveifelhaft und besttitten ist es da-
gegen, ob und in welchem Maaße sie auch von der byzantinischen
Kunst, die allerdings aus derselben Wurzel erwachsen, indessen be-
reits eigenthümlich gestaltet oder erstarrt war, geleitet worden. Be-
kanntlich hat man eine Zeitlang diesen Einfluß für so groß gehalten,
daß man die gesammte abendländische Kunst dieser Epoche mit der
byzantinischen zusammenwerfen, sie nach dieser benennen zu dürfen
glaubte. Seitdem man sowohl unsre einheimische, als jene morgen-
ländische Kunst und ihre Verschiedenheit besser kennen gelernt hat,
wird dies zwar nicht mehr in solcher Ausdehnung behauptet, in-
dessen ist man dennoch nicht völlig darüber einig, ob und in welchem
Umfange ein Einfluß von Byzanz aus die abendländische Kunst statt
gefunden hat, und es giebt noch Viele, welche ihm eine Zroße Be-
deuttmg beizulegen geneigt sind. Es scheint daher angemessen, diese
Frage, welche alle Kunstzweige berührt, selbständig zu betrachten.
Zunächst wird man sich dabei vergegenwärtigen müssen, in wie
weit der Verkehr, der überhaupt und abgesehen von der Kunst zwi-
schen dem byzanttnischen Reiche und dem Abendlande stattfand, uns
welchem der Name des römischen Kaiserthums in der Vorstellung
der Völker noch immer umgeben war, auf sich zu übertragen. Sie
glaubten dies durch die Verbindung mit dem byzantinischen Kaiser,
als dem Erben des Jmperatorentitels, zu erlangen, und' die griechi-
schen Autokratoren begünstigten diese Neigung, um mit diesen kräf-
tigen Barbaren in gutem Vernehmen zu bleiben und sie in einer
scheinbaren Abhängigkeit zu erhalten. Daher kam es, daß gothische
und fränkische Könige den Pairiciertitel nachsuchten und ihrem Namen
beisetzten, daß man von beiden Seiten Gesandtschaften ausrüstete und
empfing und Geschenke austauschte. Karl der Große und dann wie-
der die Ottonen hielten sogar Vermählungen mit den Töchtern.des
Kaiserhauses für wünschenswerth. Allein alle diese Bemühungen
hatten geringen Erfolg; der Geist der Nationen stand entgegen. Die
Griechen verlachten mit dem Hochmuthe, welcher erstarrten conven-
tionellen Zuständen eigen ist, alles Fremde, und behandelten die
Germanen als rohe und beschränkte Barbaren; diese gaben ihnen
dafür Haß und Verachtung zurück und machten griechische Treulosig-
keit zum Sprüchworte. Man darf nur den Bericht des Luitpraud
über seine Schicksale als Gesandter Otto's am Hofe, von Konstanti-
nopel lesen, um sich davon zu überzeugen, daß bei diesem Tone
gegenseitiger Grobheit und Prahlerei kein bleibender Verkehr möglich
war. Die Vermählung Otto's II. mit einer Prinzessin des griechi-
schen Kaiserhauses brachte darin keine Aenderung hervor. Theophanu
war nur eine vernachlässigte Stieftochter des herrschenden Kaisers,
die man fast zum Hohne den Barbaren übergab; am Hofe seiner
Nachfolger fehlte ihr jeder Einfluß. In Deutschland selbst wurde
sie nichts weniger -als freundlich empfangen; mehrere Große des
Reichs waren der Meinung, daß der Kaiser sie zurücksenden solle,
weil er nicht ihre Hand, sondern die einer andern Prinzessin für
seinen Sohn gefordert hätte. *) Otto hörte darauf nicht, sie blieb
imd wußte sich im Innern des kaiserlichen Hauses Achttmg und An-
sehen zu erwerben, aber im Volke wurde sie stets- undeutscher Ge-
sinnung verdächtigt und deshalb gehaßt. **) Und nicht ganz mit
Unrecht; wenigstens flößte sie ihrem Sohne, Otto III., einen lächer-
lichen Hochmuth auf seine griechische Abkunft ein, so daß er das
heimische Wesen verachtete***) und sich selbst den Römern, obwohl
er ihnen schmeichelte, zum Gespötte machte. Diese seine gräcisirende
Richtung ging indessen auf das deutsche Volk nicht über, und als
der junge König, wie schon vor ihm Karl der Kahle, byzantinisches
Ceremoniel annehmen wollte und beim Festmahle seine Tafel auf
erhöhter, einsamer Stelle errichten ließ, erregte er Mißfallen./)
*) Ditmar Mers. (Pertz Monum. III. 745.) . . non virginem desidcratam
. . . Fuere nonnulli qui lmnc fieri conjunctioncm apud imperatorem impedire
studerent, eamque remitti consulerent.
**) Atonal. Saxo ad arm. 984.
***) Der Brief an seinen Lehrer Gerbert, worin er sich einen Griechen nennt
und des Läuerischen Wesens der Sachsen spottet, ist bekannt und oft angeführt.
f) Ditmar Mers. (Pertz Monura. III. p. 781.) Imperator antiquam Ro-
man am consuetudinem jam ex parte deletam suis cupiens renovare tempori-
bus, multa faciebat, quae diversi diverse sentiebant. Solus ad mensam