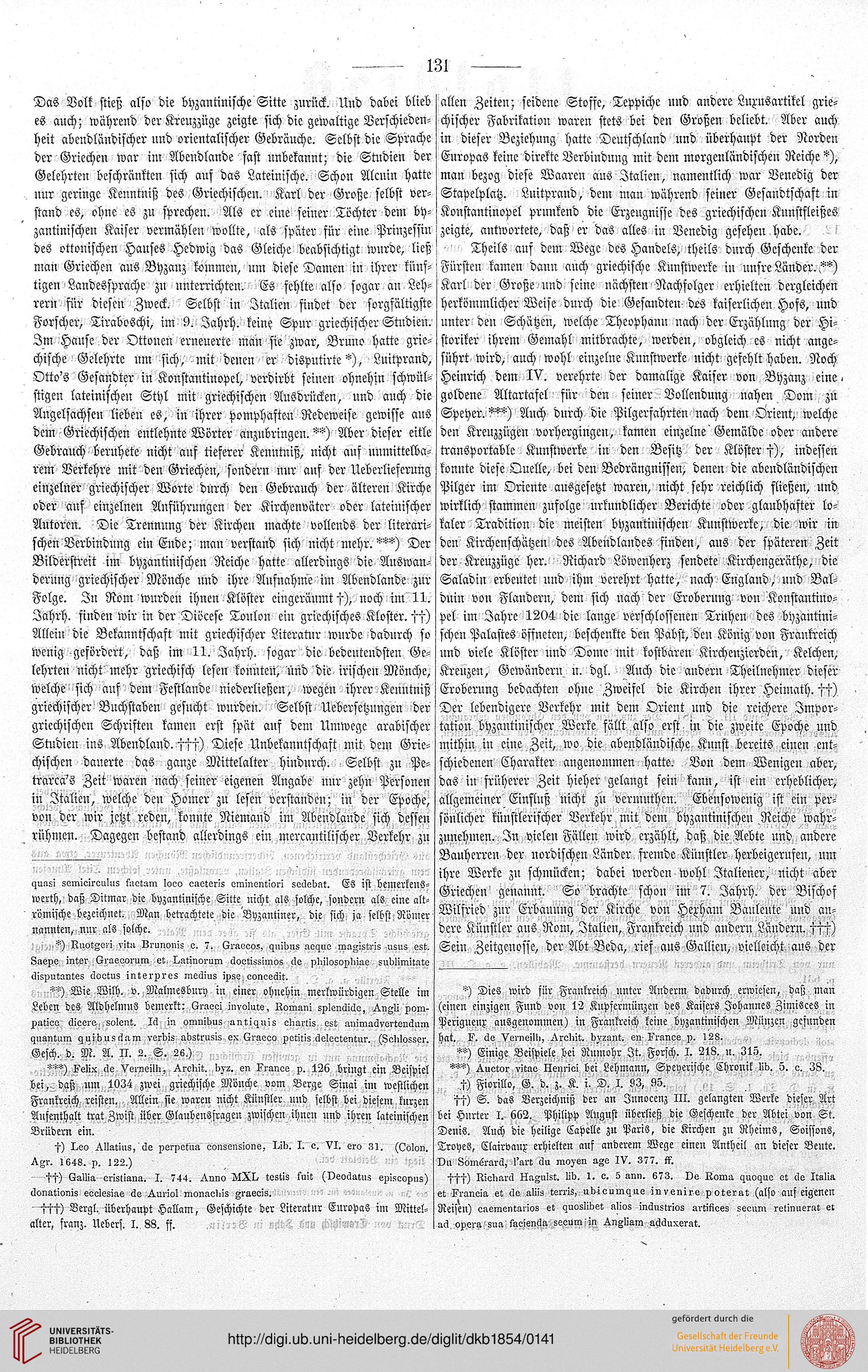131
Das Volk stieß also die byzantinische Sitte zurück. Und dabei blieb
es auch; während der Kreuzzüge zeigte, sich die gewaltige Verschieden-
heit abendländischer und orientalischer Gebräuche. Selbst die Sprache
der Griechen war im Abendlande fast unbekannt; die Studien der
Gelehrten beschränkten sich aus das Lateinische. Schon Alcnin hatte
nur geringe Kenntniß des Griechischen. Karl der Große selbst ver-
stand es, ohne es zu sprechen. Als er eine seiner Töchter dem by-
zantinischen Kaiser vermählen wollte, als später für eine Prinzessin
des ottonischen Hauses Hedwig das Gleiche beabsichtigt wurde, ließ
man Griechen aus Byzanz kommen, um diese Damen in ihrer künf-
tigen Landessprache zu unterrichten. Es fehlte also sogar an Leh-
rern für diesen Zweck. Selbst in Italien findet der sorgfältigste
Forscher, Tiraboschi, im 9. Jahrh. keine Spur griechischer Studien.
2m Hanse der Ottonen erneuerte man sie zwar, Bruno hatte grie-
chische Gelehrte um sich, mit denen er dispntirte *), Luitprand,
Otto's Gesandter in Konstantinopel, verdirbt seinen ohnehin schwül-
stigen lateinischen Styl mit griechischen Ausdrücken, und auch die
Angelsachsen lieben es, in ihrer pomphaften Redeweise gewisse aus
dem Griechischen entlehnte Wörter anzubringen. **) Aber dies er eitle
Gebrauch beruhete nicht auf tieferer Kenntniß, nicht auf unmittelba-
rem Verkehre mit den Griechen, sondern nur auf der Ueberlieferung
einzelner griechischer Worte durch den Gebrauch der älteren Kirche
oder auf einzelnen Anfi'chrungen der Kirchenväter oder lateinischer
Autoren. Die Trennung der Kirchen machte vollends der literari-
schen Verbindung ein Ende; man verstand sich nicht mehr. ***) Der
Bilderstreit im byzantinischen Reiche hatte allerdings die Auswan-
derung griechischer Mönche und ihre Aufnahme im Abendlande zur
Folge. In Rom wurden ihnen Klöster eingeräumt st), noch im 11.
Jahrh. finden wir in der Diöeese Toulon ein griechisches Kloster, stst)
Allein die Bekanntschaft mit griechischer Literatur wurde dadurch so
wenig gefördert, daß im 11. Jahrh. sogar die bedeutendsten Ge-
lehrten nicht mehr griechisch lesen konnten, und die irischen Mönche,
welche sich auf dem Festlande niederließen, wegen ihrer Kenntniß
griechischer Buchstaben gesucht wurden. Selbst Uebersetzungen der
griechischen Schriften kamen erst spät aus dem Umwege arabischer
Studien ins Abendland, ststst) Diese Unbekanntschaft mit dem Grie-
chischen dauerte das ganze Mittelalter hindurch. Selbst zu Pe-
trarcas Zeit waren nach seiner eigenen Angabe nur zehn Personen
in Italien, welche den Homer zu lesen verstanden; in der Epoche,
von der wir jetzt reden, konnte Niemand im Abendlande sich dessen
rühmen. Dagegen bestand allerdings ein mercantilischer Verkehr zu
quasi semicirculiis factam loco caeteris cminentiori scclebat. Es ist bemerkens-
werth, daß Ditmar die byzantinische Sitte nicht a!s solche, sondern als eine alt-
römische bezeichnet. Man betrachtete die Byzantiner, die sich ja selbst Römer
nannten, nur als solche.
•*) Ruotgeri vita Brunonis c. 7. Graecos, quibus aeque magistris usus est.
Saepe inter Graecorum et. Latinorum doctissimos de philosopliiae sublimitate
disputantes doctus interpres medius ipse concedit.
**) Wie Wilh. v. Malmesbnry in einer ohnehin merkwürdigen Stelle im
Leben des Aldhelmus bemerkt: Graeci involute, Romani splendide, Angli pom-
patice dicere solent. Id in omnibus antiquis chartis est auimadvertendum
quantum qui bus dam verbis abstrusis ex Gracco petitis delectentur. (Schlosser.
Gesch. d. M. A. II. 2. S. 26.)
'f;'??) Felix de Verneilh, Arcliit. byz. en France p. 126 bringt ein Beispiel
bei, daß um 1034 zwei griechische Mönche vom Berge Sinai im westlichen
Frankreich reisten. Allein sie waren nicht Künstler und selbst bei diesem kurzen
Aufenthalt trat Zwist über Glanbensfragen zwischen ihnen und ihren lateinischen
Brüdern ein.
t) Reo Allatius, de perpetua consensione, Lib. I. c. VI. ero 31. (Colon.
Agr. 1648. p. 122.)
ff) Gallia cristiana. I. 744. Anno MXL testis fuit (Deodatus episcopus)
donationis ecclesiae de Auriol monachis graecis.
ttt) Bergt, überhaupt Hallam, Geschichte der Literatur Europas im Mittel-
alter, franz. Uebers. I. 88. sf.
allen Zeiten; seidene Stoffe, Teppiche und andere Luxusartikel grie-
chischer Fabrikation waren stets bei den Großen beliebt. Aber auch
in dieser Beziehung hatte Deutschland und überhaupt der Norden
Europas keine direkte Verbindung mit dem morgenländischen Reiche *),
man bezog diese Waaren aus Italien, namentlich war Venedig der
Stapelplatz. Luitprand, dem man während seiner Gesandtschaft in
Konstantinopel prunkend die Erzeugnisse des griechischen Kunstfleißes
zeigte, antwortete, daß er das alles in Venedig gesehen habe.
Theils auf dem Wege des Handels, theils durch Geschenke der
Fürsten kamen dann auch griechische Kunstwerke in unsre Länder. **)
Karl der Große und seine nächsten' Nachfolger erhielten dergleichen
herkömmlicher Weise durch die Gesandten dos kaiserlichen Hofs, und
unter den Schätzen, welche Theophann nach der Erzählung der Hi-
storiker ihrem Gemahl mitbrachte, werden, obgleich es nicht ange-
führt wird, auch wohl einzelne Kunstwerke nicht gefehlt haben. Noch
Heinrich dem IV. verehrte der damalige Kaiser von Byzanz eine
goldene Altartafel für den seiner Vollendung nahen Dom zu
Speyer. ***) Auch durch die Pilgerfahrten nach dem Orient, welche
den Kreuzzügen vorhergingen, kamen einzelne'Gemälde oder andere
ttansportable Kunstwerke in den Besitz der Klöster st), indessen
konnte diese Quelle, bei den Bedrängnissen, denen die abendländischen
Pilger im Oriente ausgesetzt waren, nicht sehr reichlich fließen, und
wirklich stammen zufolge urkundlicher Berichte oder glaubhafter lo-
kaler Tradition die meisten byzantinischen Kunstwerke, die wir in
den Kirchenschätzen des Abendlandes finden, aus der späteren Zeit
der Kreuzzügc her. Richard Löwenherz sendete Kirchengeräthe, die
Saladin erbeutet und ihm verehrt hatte, nach England, und Bal-
duin von Flandern, dem sich nach der Eroberung von Konstantino-
pel im Jahre 1204 die lange verschlossenen Truhen des byzantini-
schen Palastes öffneten, beschenkte den Pabst, den König von Frankreich
und viele Klöster und Dome mit kostbaren Kirchenzierden, Kelchen,
Kreuzen, Gewändern u. dgl. Auch die andern Teilnehmer dieser
Eroberung bedachten ohne Zweifel die Kirchen ihrer Heimath. stst)
Der lebendigere Verkehr mit dem Orient und die reichere Jmpor-
tation byzantinischer Werke fällt also erst in die zweite Epoche und
mithin in eine Zeit, wo die abendländische Kunst bereits einen ent-
schiedenen Charakter angenommen hatte. Von dem Wenigen aber,
das in früherer Zeit hieher gelangt sein kann, ist ein erheblicher,
allgemeiner Einfluß nicht zu vermuthcn. Ebensowenig ist ein per-
sönlicher künstlerischer Verkehr mit dem byzantinischen Reiche wahr-
zunehmen. In vielen Fällen wird erzählt, daß die Achte und andere
Bauherren der nordischen Länder fremde Künstler herbeigerufen, um
ihre Werke zu schmücken; dabei werden wohl Italiener, nicht aber
Griechen genannt. So brachte schon im 7. Jahrh. der Bischof
Wilfried zur Erbauung der Kirche von Hexham Bauleute und an-
dere Künstler aus Rom, Italien, Frankreich und andern Ländern, ststst)
Sein Zeitgenosse, der Abt Beda, ries aus Gallieu, vielleicht aus der
*) Dies wird für Frankreich unter Andern: dadurch erwiesen, daß man
(einen einzigen Fund von 12 Kupfermünzen des Kaisers Johannes Zimisces in
Periguenx ausgenommen) in Frankreich keine byzanünischen Münzen gefunden
hat. F. de Verneilh, Arcliit. byzant. en-France p. 128.
**) Einige Beispiele bei Rninohr Jt. Forsch. I. 218. n. 315.
***) Auctor vitac Henrici bei Lehmann, Speyerische Chronik lib. 5. c. 38.
j) Fiorillo, G. d. z. K. i. D. I. 93, 95.
1f) S. das Verzeichniß der an Jnnocenz III. gelangten Werke dieser Art
bei Hnrter I. 662. Philipp August überließ die Geschenke der Abtei von St.
Denis. Auch die heilige Capelle zu Paris, die Kirchen zu Rheims, Soisfons,
Troyes, Clairvaux erhielten auf anderem Wege einen Antheil an dieser Beute.
Du Somerard, l’art du moyen age IV. 377. ff.
fff) Richard Hagulst. lib. 1. c. 5 arm. 673. De Roma quoque et de Italia
et Francia et de aliis terris, ub-icumque in venire p oterat (also ans eigenen
Reisen) caementarios et quoslibet alios indnstrios artifices secum retinuerat et
ad opera sua facienda secum in Angliam adduxerat.
Das Volk stieß also die byzantinische Sitte zurück. Und dabei blieb
es auch; während der Kreuzzüge zeigte, sich die gewaltige Verschieden-
heit abendländischer und orientalischer Gebräuche. Selbst die Sprache
der Griechen war im Abendlande fast unbekannt; die Studien der
Gelehrten beschränkten sich aus das Lateinische. Schon Alcnin hatte
nur geringe Kenntniß des Griechischen. Karl der Große selbst ver-
stand es, ohne es zu sprechen. Als er eine seiner Töchter dem by-
zantinischen Kaiser vermählen wollte, als später für eine Prinzessin
des ottonischen Hauses Hedwig das Gleiche beabsichtigt wurde, ließ
man Griechen aus Byzanz kommen, um diese Damen in ihrer künf-
tigen Landessprache zu unterrichten. Es fehlte also sogar an Leh-
rern für diesen Zweck. Selbst in Italien findet der sorgfältigste
Forscher, Tiraboschi, im 9. Jahrh. keine Spur griechischer Studien.
2m Hanse der Ottonen erneuerte man sie zwar, Bruno hatte grie-
chische Gelehrte um sich, mit denen er dispntirte *), Luitprand,
Otto's Gesandter in Konstantinopel, verdirbt seinen ohnehin schwül-
stigen lateinischen Styl mit griechischen Ausdrücken, und auch die
Angelsachsen lieben es, in ihrer pomphaften Redeweise gewisse aus
dem Griechischen entlehnte Wörter anzubringen. **) Aber dies er eitle
Gebrauch beruhete nicht auf tieferer Kenntniß, nicht auf unmittelba-
rem Verkehre mit den Griechen, sondern nur auf der Ueberlieferung
einzelner griechischer Worte durch den Gebrauch der älteren Kirche
oder auf einzelnen Anfi'chrungen der Kirchenväter oder lateinischer
Autoren. Die Trennung der Kirchen machte vollends der literari-
schen Verbindung ein Ende; man verstand sich nicht mehr. ***) Der
Bilderstreit im byzantinischen Reiche hatte allerdings die Auswan-
derung griechischer Mönche und ihre Aufnahme im Abendlande zur
Folge. In Rom wurden ihnen Klöster eingeräumt st), noch im 11.
Jahrh. finden wir in der Diöeese Toulon ein griechisches Kloster, stst)
Allein die Bekanntschaft mit griechischer Literatur wurde dadurch so
wenig gefördert, daß im 11. Jahrh. sogar die bedeutendsten Ge-
lehrten nicht mehr griechisch lesen konnten, und die irischen Mönche,
welche sich auf dem Festlande niederließen, wegen ihrer Kenntniß
griechischer Buchstaben gesucht wurden. Selbst Uebersetzungen der
griechischen Schriften kamen erst spät aus dem Umwege arabischer
Studien ins Abendland, ststst) Diese Unbekanntschaft mit dem Grie-
chischen dauerte das ganze Mittelalter hindurch. Selbst zu Pe-
trarcas Zeit waren nach seiner eigenen Angabe nur zehn Personen
in Italien, welche den Homer zu lesen verstanden; in der Epoche,
von der wir jetzt reden, konnte Niemand im Abendlande sich dessen
rühmen. Dagegen bestand allerdings ein mercantilischer Verkehr zu
quasi semicirculiis factam loco caeteris cminentiori scclebat. Es ist bemerkens-
werth, daß Ditmar die byzantinische Sitte nicht a!s solche, sondern als eine alt-
römische bezeichnet. Man betrachtete die Byzantiner, die sich ja selbst Römer
nannten, nur als solche.
•*) Ruotgeri vita Brunonis c. 7. Graecos, quibus aeque magistris usus est.
Saepe inter Graecorum et. Latinorum doctissimos de philosopliiae sublimitate
disputantes doctus interpres medius ipse concedit.
**) Wie Wilh. v. Malmesbnry in einer ohnehin merkwürdigen Stelle im
Leben des Aldhelmus bemerkt: Graeci involute, Romani splendide, Angli pom-
patice dicere solent. Id in omnibus antiquis chartis est auimadvertendum
quantum qui bus dam verbis abstrusis ex Gracco petitis delectentur. (Schlosser.
Gesch. d. M. A. II. 2. S. 26.)
'f;'??) Felix de Verneilh, Arcliit. byz. en France p. 126 bringt ein Beispiel
bei, daß um 1034 zwei griechische Mönche vom Berge Sinai im westlichen
Frankreich reisten. Allein sie waren nicht Künstler und selbst bei diesem kurzen
Aufenthalt trat Zwist über Glanbensfragen zwischen ihnen und ihren lateinischen
Brüdern ein.
t) Reo Allatius, de perpetua consensione, Lib. I. c. VI. ero 31. (Colon.
Agr. 1648. p. 122.)
ff) Gallia cristiana. I. 744. Anno MXL testis fuit (Deodatus episcopus)
donationis ecclesiae de Auriol monachis graecis.
ttt) Bergt, überhaupt Hallam, Geschichte der Literatur Europas im Mittel-
alter, franz. Uebers. I. 88. sf.
allen Zeiten; seidene Stoffe, Teppiche und andere Luxusartikel grie-
chischer Fabrikation waren stets bei den Großen beliebt. Aber auch
in dieser Beziehung hatte Deutschland und überhaupt der Norden
Europas keine direkte Verbindung mit dem morgenländischen Reiche *),
man bezog diese Waaren aus Italien, namentlich war Venedig der
Stapelplatz. Luitprand, dem man während seiner Gesandtschaft in
Konstantinopel prunkend die Erzeugnisse des griechischen Kunstfleißes
zeigte, antwortete, daß er das alles in Venedig gesehen habe.
Theils auf dem Wege des Handels, theils durch Geschenke der
Fürsten kamen dann auch griechische Kunstwerke in unsre Länder. **)
Karl der Große und seine nächsten' Nachfolger erhielten dergleichen
herkömmlicher Weise durch die Gesandten dos kaiserlichen Hofs, und
unter den Schätzen, welche Theophann nach der Erzählung der Hi-
storiker ihrem Gemahl mitbrachte, werden, obgleich es nicht ange-
führt wird, auch wohl einzelne Kunstwerke nicht gefehlt haben. Noch
Heinrich dem IV. verehrte der damalige Kaiser von Byzanz eine
goldene Altartafel für den seiner Vollendung nahen Dom zu
Speyer. ***) Auch durch die Pilgerfahrten nach dem Orient, welche
den Kreuzzügen vorhergingen, kamen einzelne'Gemälde oder andere
ttansportable Kunstwerke in den Besitz der Klöster st), indessen
konnte diese Quelle, bei den Bedrängnissen, denen die abendländischen
Pilger im Oriente ausgesetzt waren, nicht sehr reichlich fließen, und
wirklich stammen zufolge urkundlicher Berichte oder glaubhafter lo-
kaler Tradition die meisten byzantinischen Kunstwerke, die wir in
den Kirchenschätzen des Abendlandes finden, aus der späteren Zeit
der Kreuzzügc her. Richard Löwenherz sendete Kirchengeräthe, die
Saladin erbeutet und ihm verehrt hatte, nach England, und Bal-
duin von Flandern, dem sich nach der Eroberung von Konstantino-
pel im Jahre 1204 die lange verschlossenen Truhen des byzantini-
schen Palastes öffneten, beschenkte den Pabst, den König von Frankreich
und viele Klöster und Dome mit kostbaren Kirchenzierden, Kelchen,
Kreuzen, Gewändern u. dgl. Auch die andern Teilnehmer dieser
Eroberung bedachten ohne Zweifel die Kirchen ihrer Heimath. stst)
Der lebendigere Verkehr mit dem Orient und die reichere Jmpor-
tation byzantinischer Werke fällt also erst in die zweite Epoche und
mithin in eine Zeit, wo die abendländische Kunst bereits einen ent-
schiedenen Charakter angenommen hatte. Von dem Wenigen aber,
das in früherer Zeit hieher gelangt sein kann, ist ein erheblicher,
allgemeiner Einfluß nicht zu vermuthcn. Ebensowenig ist ein per-
sönlicher künstlerischer Verkehr mit dem byzantinischen Reiche wahr-
zunehmen. In vielen Fällen wird erzählt, daß die Achte und andere
Bauherren der nordischen Länder fremde Künstler herbeigerufen, um
ihre Werke zu schmücken; dabei werden wohl Italiener, nicht aber
Griechen genannt. So brachte schon im 7. Jahrh. der Bischof
Wilfried zur Erbauung der Kirche von Hexham Bauleute und an-
dere Künstler aus Rom, Italien, Frankreich und andern Ländern, ststst)
Sein Zeitgenosse, der Abt Beda, ries aus Gallieu, vielleicht aus der
*) Dies wird für Frankreich unter Andern: dadurch erwiesen, daß man
(einen einzigen Fund von 12 Kupfermünzen des Kaisers Johannes Zimisces in
Periguenx ausgenommen) in Frankreich keine byzanünischen Münzen gefunden
hat. F. de Verneilh, Arcliit. byzant. en-France p. 128.
**) Einige Beispiele bei Rninohr Jt. Forsch. I. 218. n. 315.
***) Auctor vitac Henrici bei Lehmann, Speyerische Chronik lib. 5. c. 38.
j) Fiorillo, G. d. z. K. i. D. I. 93, 95.
1f) S. das Verzeichniß der an Jnnocenz III. gelangten Werke dieser Art
bei Hnrter I. 662. Philipp August überließ die Geschenke der Abtei von St.
Denis. Auch die heilige Capelle zu Paris, die Kirchen zu Rheims, Soisfons,
Troyes, Clairvaux erhielten auf anderem Wege einen Antheil an dieser Beute.
Du Somerard, l’art du moyen age IV. 377. ff.
fff) Richard Hagulst. lib. 1. c. 5 arm. 673. De Roma quoque et de Italia
et Francia et de aliis terris, ub-icumque in venire p oterat (also ans eigenen
Reisen) caementarios et quoslibet alios indnstrios artifices secum retinuerat et
ad opera sua facienda secum in Angliam adduxerat.