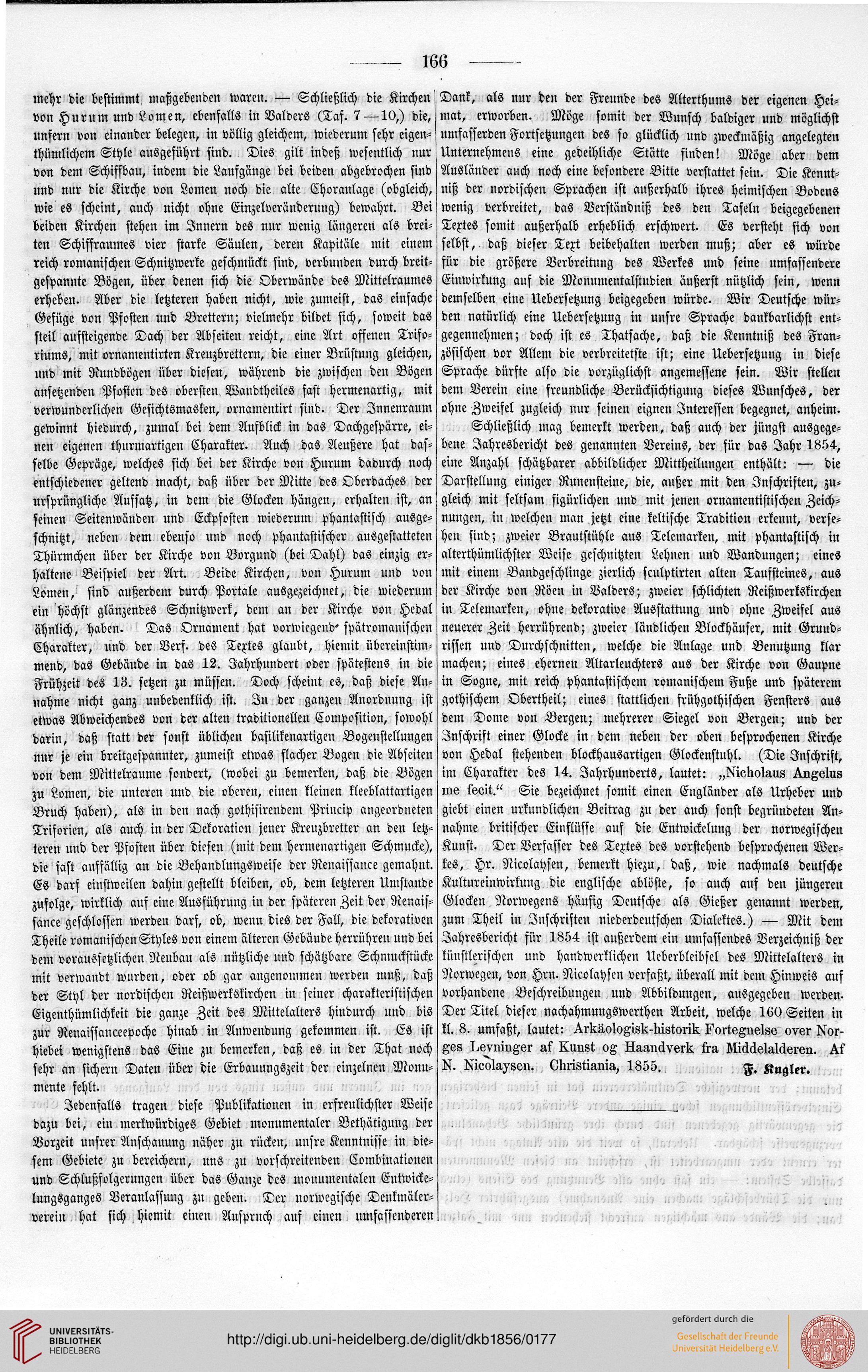166
mehr die bestimmt maßgebenden waren. — Schließlich die Kirchen
von Hu rum und Lomen, ebenfalls in Balders (Tas. 7—10,) die,!
unfern von einander belegen, in völlig gleichem, wiederum sehr eigen- 1
thümlichem Style ausgeführt sind. Dies gilt indeß wesentlich nur
von dem Schiffbau, indem die Laufgänge bei beiden abgebrochen sind
und nur die Kirche von Lomen noch die alte Choranlage (obgleich,
wie es scheint, auch nicht ohne Einzelveränderung) bewahrt. Bei
beiden Kirchen stehen im Innern des nur wenig längeren als brei-
ten Schiffraumes vier starke Säulen, deren Kapitäle mit einem
reich romanischen Schnitzwerke geschmückt sind, verbunden durch breit-
gespannte Bögen, über denen sich die Oberwände des Mittelraumes
erheben. Aber die letzteren haben nicht, wie zumeist, das einfache
Gefüge von Pfosten und Brettern; vielmehr bildet sich, soweit das
steil aussteigende Dach der Abseiten reicht, eine Art offenen Trifo-
riums, mit ornamentirten Kreuzbrettern, die einer Brüstung gleichen,
und mit Rundbögen über diesen, während die zwischen den Bögen
ansetzenden Pfosten des obersten Wandtheiles fast hermenartig, mit
verwunderlichen Gesichtsmasken, ornamentirt sind. Der Innenraum
gewinnt hiedurch, zumal bei dem Aufblick in das Dachgespärre, ei-
nen eigenen thurmartigen Charakter. Auch das Aeußere hat das-
selbe Gepräge, welches sich bei der Kirche von Hurum dadurch nock-
entschiedener geltend macht, daß über der Mitte des Oberdaches der
ursprüngliche Aufsatz, in dem die Glocken hängen, erhalten ist, an
seinen Seitenwänden und Eckpfosten wiederum phantastisch ausge-
schnitzt, neben dem ebenso und noch phantastischer ausgestatteten
Thürmchen über der Kirche von Borgund (bei Dahl) das einzig er-
haltene Beispiel der Art. Beide Kirchen, von Hurum und von
Lomen, sind außerdem durch Portale ausgezeichnet, die wiederum
ein höchst glänzendes Schnitzwerk, dem an der Kirche von Hedal
ähnlich, haben. Das Ornament hat vorwiegend' spätromanischen
Charakter, und der Verf. des Textes glaubt, hiemit übereinstim-
mend, das Gebäude in das 12. Jahrhundert oder spätestens in die
Frühzeit des 13. setzen zu müssen. Doch scheint es, daß diese An-
nahme nicht ganz unbedenklich ist. In der ganzen Anordnung ist
etwas Abweichendes von der alten traditionellen Composition, sowohl
darin, daß statt der sonst üblichen basilikenartigen Bogenstellungen
nur je ein breitgespannter, zumeist etwas flacher Bogen die Abseiten
von dem Mittelraume sondert, (wobei zu bemerken, daß die Bögen
zu Lomen, die unteren und die oberen, einen kleinen kleeblattartigen
Bruch haben), als in den nach gothisirendem Princip angeordneten
Triforien, als auch in der Dekoration jener Kreuzbretter an den letz-
teren und der Pfosten über diesen (mit dem hermenartigen Schmucke),
die fast auffällig an die Behandlungsweise der Renaissance gemahnt.
Es darf einstweilen dahin gestellt bleiben, ob, dem letzteren Umstande
zufolge, wirklich auf eine Ausführung in der späteren Zeit der Renais-
sance geschlossen werden darf, ob, wenn dies der Fall, die dekorativen
Theile romanischen Styles von einem älteren Gebäude herrühren und bei
dem voraussetzlichen Neubau als nützliche und schätzbare Schmuckstücke
mit verwandt wurden, oder ob gar angenommen werden muß, daß
der Styl der nordischen Reißwerkskirchen in seiner charakteristischen
Eigenthümlichkeit die ganze Zeit des Mittelalters hindurch und bis
zur Renaissanceepoche hinab in Anwendung gekommen ist. Es ist
hiebei wenigstens das Eine zu bemerken, daß es in der That noch
sehr an sichern Daten über die Erbauungszeit der einzelnen Monu-
mente fehlt.
Jedenfalls tragen diese Publikationen in erfreulichster Weise
dazu bei, ein merkwürdiges Gebiet monumentaler Bethätigung der
Borzeit unsrer Anschauung näher zu rücken, unsre Kenntnisse in die-
sem Gebiete zu bereichern, uns zu vorschreitenden Combinationen
und Schlußfolgerungen über das Ganze des monumentalen Entwicke-
lungsganges Veranlassung zu geben. Der norwegische Denkmäler-
verein hat sich hiemit einen Anspruch auf einen umfassenderen
Dank, als nur den der Freunde des Alterthums der eigenen Hei-
mat, erworben. Möge somit der Wunsch baldiger und möglichst
umsasserden Fortsetzungen des so glücklich und zweckmäßig angelegten
Unternehmens eine gedeihliche Stätte finden! Möge aber dem
Ausländer auch noch eine besondere Bitte verstattet sein. Die Kennt-
niß der nordischen Sprachen ist außerhalb ihres heimischen Bodens
wenig verbreitet, das Berständniß des den Tafeln beigegebenen
Textes somit außerhalb erheblich erschwert. Es versteht sich von
selbst, daß dieser Text beibehalten werden muß; aber es würde
für die größere Verbreitung des Werkes und seine umfassendere
Einwirkung auf die Monumentalstudien äußerst nützlich sein, wenn
demselben eine Uebersetzung beigegeben würde. Wir Deutsche wür-
den natürlich eine Uebersetzung in unsre Sprache dankbarlichst ent-
gegennehmen; doch ist es Thatsache, daß die Kenntniß des Fran-
zösischen vor Allem die verbreitetste ist; eine Uebersetzung in diese
Sprache dürste also die vorzüglichst angemessene sein. Wir stellen
dem Verein eine freundliche Berücksichtigung dieses Wunsches, der
ohne Zweifel zugleich nur seinen eignen Interessen begegnet, anheim.
Schließlich mag bemerkt werden, daß auch der jüngst ausgege-
bene Jahresbericht des genannten Vereins, der für das Jahr 1854,
eine Anzahl schätzbarer abbildlicher Mittheilungen enthält: — die
Darstellung einiger Runensteine, die, außer mit den Inschriften, zu-
gleich mit seltsam figürlichen und mit jenen ornamentistischen Zeich-
nungen, in welchen man jetzt eine keltische Tradition erkennt, verse-
hen sind; zweier Brautstühle aus Telemarken, mit phantastisch in
alterthümlichster Weise geschnitzten Lehnen und Wandungen; eines
mit einem Bandgeschlinge zierlich sculptirten alten Taufsteines, aus
der Kirche von Röen in Balders; zweier schlichten Reißwerkskirchen
in Telemarken, ohne dekorative Ausstattung und ohne Zweifel aus
neuerer Zeit herrührend; zweier ländlichen Blockhäuser, mit Grund-
rissen und Durchschnitten, welche die Anlage und Benutzung klar
machen; eines ehernen Altarleuchters aus der Kirche von Gaupne
in Sogne, mit reich phantastischem romanischem Fuße und späterem
gothischem Obertheil; eines stattlichen srühgothischen Fensters aus
dem Dome von Bergen; mehrerer Siegel von Bergen; und der
Inschrift einer Glocke in dem neben der oben besprochenen Kirche
von Hedal stehenden blockhausartigen Glockenstuhl. (Die Inschrift,
im Charakter des 14. Jahrhunderts, lautet: „Niclwlaus Angelus
me fecit.“ Sie bezeichnet somit einen Engländer als Urheber und
giebt einen urkundlichen Beitrag zu der auch sonst begründeten An-
nahme britischer Einflüsse auf die Entwickelung der norwegischen
Kunst. Der Verfasser des Textes des vorstehend besprochenen Wer-
kes, Hr. Nicolaysen, bemerkt hiezu, daß, wie nachmals deutsche
Kultureinwirkung die englische ablöste, so auch auf den jüngeren
Glocken Norwegens häufig Deutsche als Gießer genannt werden,
zum Theil in Inschristen niederdeutschen Dialektes.) — Mit dem
Jahresbericht für 1854 ist außerdem ein umfassendes Verzeichniß der
künstlerischen und handwerklichen Ueberbleibsel des Mittelalters in
Norwegen, von Hrn. Nicolaysen verfaßt, überall mit dem Hinweis auf
vorhandene Beschreibungen und Abbildungen, ausgegeben werden.
Der Titel dieser nachahmungswerthen Arbeit, welche 160 Seiten in
kl. 8. umfaßt, lautet: Arkäologisk-historik Fortegneise over Nor-
ges Levninger af Kunst og Haandverk fra Middelalderen. Af
N. Nicolaysen. Christiania, 1855. F. ftugler.
mehr die bestimmt maßgebenden waren. — Schließlich die Kirchen
von Hu rum und Lomen, ebenfalls in Balders (Tas. 7—10,) die,!
unfern von einander belegen, in völlig gleichem, wiederum sehr eigen- 1
thümlichem Style ausgeführt sind. Dies gilt indeß wesentlich nur
von dem Schiffbau, indem die Laufgänge bei beiden abgebrochen sind
und nur die Kirche von Lomen noch die alte Choranlage (obgleich,
wie es scheint, auch nicht ohne Einzelveränderung) bewahrt. Bei
beiden Kirchen stehen im Innern des nur wenig längeren als brei-
ten Schiffraumes vier starke Säulen, deren Kapitäle mit einem
reich romanischen Schnitzwerke geschmückt sind, verbunden durch breit-
gespannte Bögen, über denen sich die Oberwände des Mittelraumes
erheben. Aber die letzteren haben nicht, wie zumeist, das einfache
Gefüge von Pfosten und Brettern; vielmehr bildet sich, soweit das
steil aussteigende Dach der Abseiten reicht, eine Art offenen Trifo-
riums, mit ornamentirten Kreuzbrettern, die einer Brüstung gleichen,
und mit Rundbögen über diesen, während die zwischen den Bögen
ansetzenden Pfosten des obersten Wandtheiles fast hermenartig, mit
verwunderlichen Gesichtsmasken, ornamentirt sind. Der Innenraum
gewinnt hiedurch, zumal bei dem Aufblick in das Dachgespärre, ei-
nen eigenen thurmartigen Charakter. Auch das Aeußere hat das-
selbe Gepräge, welches sich bei der Kirche von Hurum dadurch nock-
entschiedener geltend macht, daß über der Mitte des Oberdaches der
ursprüngliche Aufsatz, in dem die Glocken hängen, erhalten ist, an
seinen Seitenwänden und Eckpfosten wiederum phantastisch ausge-
schnitzt, neben dem ebenso und noch phantastischer ausgestatteten
Thürmchen über der Kirche von Borgund (bei Dahl) das einzig er-
haltene Beispiel der Art. Beide Kirchen, von Hurum und von
Lomen, sind außerdem durch Portale ausgezeichnet, die wiederum
ein höchst glänzendes Schnitzwerk, dem an der Kirche von Hedal
ähnlich, haben. Das Ornament hat vorwiegend' spätromanischen
Charakter, und der Verf. des Textes glaubt, hiemit übereinstim-
mend, das Gebäude in das 12. Jahrhundert oder spätestens in die
Frühzeit des 13. setzen zu müssen. Doch scheint es, daß diese An-
nahme nicht ganz unbedenklich ist. In der ganzen Anordnung ist
etwas Abweichendes von der alten traditionellen Composition, sowohl
darin, daß statt der sonst üblichen basilikenartigen Bogenstellungen
nur je ein breitgespannter, zumeist etwas flacher Bogen die Abseiten
von dem Mittelraume sondert, (wobei zu bemerken, daß die Bögen
zu Lomen, die unteren und die oberen, einen kleinen kleeblattartigen
Bruch haben), als in den nach gothisirendem Princip angeordneten
Triforien, als auch in der Dekoration jener Kreuzbretter an den letz-
teren und der Pfosten über diesen (mit dem hermenartigen Schmucke),
die fast auffällig an die Behandlungsweise der Renaissance gemahnt.
Es darf einstweilen dahin gestellt bleiben, ob, dem letzteren Umstande
zufolge, wirklich auf eine Ausführung in der späteren Zeit der Renais-
sance geschlossen werden darf, ob, wenn dies der Fall, die dekorativen
Theile romanischen Styles von einem älteren Gebäude herrühren und bei
dem voraussetzlichen Neubau als nützliche und schätzbare Schmuckstücke
mit verwandt wurden, oder ob gar angenommen werden muß, daß
der Styl der nordischen Reißwerkskirchen in seiner charakteristischen
Eigenthümlichkeit die ganze Zeit des Mittelalters hindurch und bis
zur Renaissanceepoche hinab in Anwendung gekommen ist. Es ist
hiebei wenigstens das Eine zu bemerken, daß es in der That noch
sehr an sichern Daten über die Erbauungszeit der einzelnen Monu-
mente fehlt.
Jedenfalls tragen diese Publikationen in erfreulichster Weise
dazu bei, ein merkwürdiges Gebiet monumentaler Bethätigung der
Borzeit unsrer Anschauung näher zu rücken, unsre Kenntnisse in die-
sem Gebiete zu bereichern, uns zu vorschreitenden Combinationen
und Schlußfolgerungen über das Ganze des monumentalen Entwicke-
lungsganges Veranlassung zu geben. Der norwegische Denkmäler-
verein hat sich hiemit einen Anspruch auf einen umfassenderen
Dank, als nur den der Freunde des Alterthums der eigenen Hei-
mat, erworben. Möge somit der Wunsch baldiger und möglichst
umsasserden Fortsetzungen des so glücklich und zweckmäßig angelegten
Unternehmens eine gedeihliche Stätte finden! Möge aber dem
Ausländer auch noch eine besondere Bitte verstattet sein. Die Kennt-
niß der nordischen Sprachen ist außerhalb ihres heimischen Bodens
wenig verbreitet, das Berständniß des den Tafeln beigegebenen
Textes somit außerhalb erheblich erschwert. Es versteht sich von
selbst, daß dieser Text beibehalten werden muß; aber es würde
für die größere Verbreitung des Werkes und seine umfassendere
Einwirkung auf die Monumentalstudien äußerst nützlich sein, wenn
demselben eine Uebersetzung beigegeben würde. Wir Deutsche wür-
den natürlich eine Uebersetzung in unsre Sprache dankbarlichst ent-
gegennehmen; doch ist es Thatsache, daß die Kenntniß des Fran-
zösischen vor Allem die verbreitetste ist; eine Uebersetzung in diese
Sprache dürste also die vorzüglichst angemessene sein. Wir stellen
dem Verein eine freundliche Berücksichtigung dieses Wunsches, der
ohne Zweifel zugleich nur seinen eignen Interessen begegnet, anheim.
Schließlich mag bemerkt werden, daß auch der jüngst ausgege-
bene Jahresbericht des genannten Vereins, der für das Jahr 1854,
eine Anzahl schätzbarer abbildlicher Mittheilungen enthält: — die
Darstellung einiger Runensteine, die, außer mit den Inschriften, zu-
gleich mit seltsam figürlichen und mit jenen ornamentistischen Zeich-
nungen, in welchen man jetzt eine keltische Tradition erkennt, verse-
hen sind; zweier Brautstühle aus Telemarken, mit phantastisch in
alterthümlichster Weise geschnitzten Lehnen und Wandungen; eines
mit einem Bandgeschlinge zierlich sculptirten alten Taufsteines, aus
der Kirche von Röen in Balders; zweier schlichten Reißwerkskirchen
in Telemarken, ohne dekorative Ausstattung und ohne Zweifel aus
neuerer Zeit herrührend; zweier ländlichen Blockhäuser, mit Grund-
rissen und Durchschnitten, welche die Anlage und Benutzung klar
machen; eines ehernen Altarleuchters aus der Kirche von Gaupne
in Sogne, mit reich phantastischem romanischem Fuße und späterem
gothischem Obertheil; eines stattlichen srühgothischen Fensters aus
dem Dome von Bergen; mehrerer Siegel von Bergen; und der
Inschrift einer Glocke in dem neben der oben besprochenen Kirche
von Hedal stehenden blockhausartigen Glockenstuhl. (Die Inschrift,
im Charakter des 14. Jahrhunderts, lautet: „Niclwlaus Angelus
me fecit.“ Sie bezeichnet somit einen Engländer als Urheber und
giebt einen urkundlichen Beitrag zu der auch sonst begründeten An-
nahme britischer Einflüsse auf die Entwickelung der norwegischen
Kunst. Der Verfasser des Textes des vorstehend besprochenen Wer-
kes, Hr. Nicolaysen, bemerkt hiezu, daß, wie nachmals deutsche
Kultureinwirkung die englische ablöste, so auch auf den jüngeren
Glocken Norwegens häufig Deutsche als Gießer genannt werden,
zum Theil in Inschristen niederdeutschen Dialektes.) — Mit dem
Jahresbericht für 1854 ist außerdem ein umfassendes Verzeichniß der
künstlerischen und handwerklichen Ueberbleibsel des Mittelalters in
Norwegen, von Hrn. Nicolaysen verfaßt, überall mit dem Hinweis auf
vorhandene Beschreibungen und Abbildungen, ausgegeben werden.
Der Titel dieser nachahmungswerthen Arbeit, welche 160 Seiten in
kl. 8. umfaßt, lautet: Arkäologisk-historik Fortegneise over Nor-
ges Levninger af Kunst og Haandverk fra Middelalderen. Af
N. Nicolaysen. Christiania, 1855. F. ftugler.