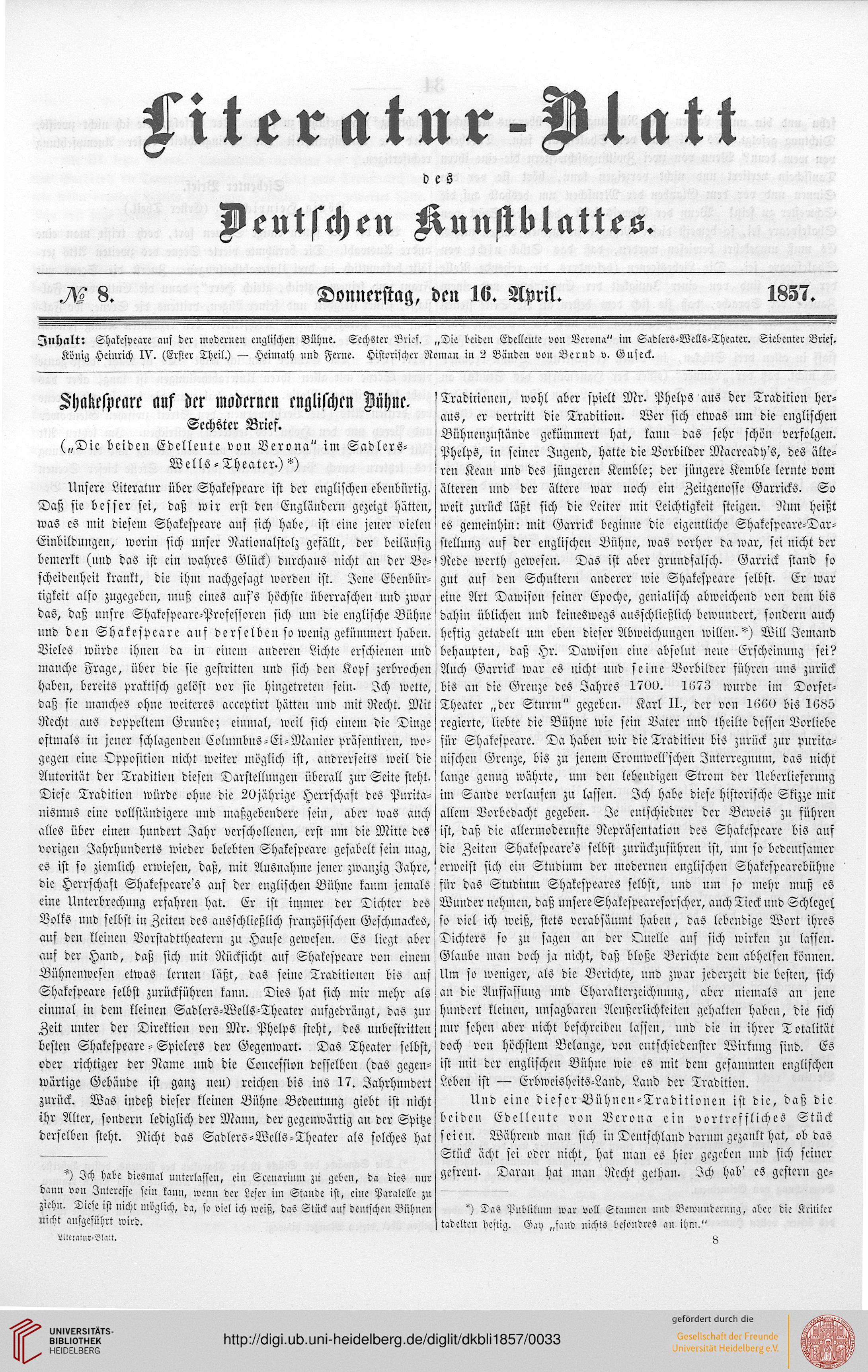Literatur
Blatt
d e s
Deutschen Kunstblattes.
M 8.
Donnerstag, den 16. April.
1837.
Inhalt: Shakespeare auf der modernen englischen Bühne. Sechster Brief. „Die beiden Edelleute von Verona" im Sadlers-Wells-Theater. Siebenter Brief.
König Heinrich IV. (Erster Theil.) — Heimath und Ferne. Historischer Roman in 2 Bänden von Bernd v. Gnseck.
Shlikchnire aus dcr modernen englischen Dühnc.
Sechster Brief.
(„Die beiden Edelleute von Verona" im Sadlers-
Wells - Theater.) *)
Unsere Literatur über Shakespeare ist der englischen ebenbürtig.
Daß sie besser sei, daß wir erst den Engländern gezeigt hätten,
was cs mit diesem Shakespeare aus sich habe, ist eine jener vielen
Einbildungen, worin sich unser Nationalstol; gefällt, der beiläufig
bemerkt (und das ist ein wahres Glück) durchaus nicht an der Be-
scheidenheit krankt, die ihm nachgesagt worden ist. Jene Ebenbür-
tigkeit also zugegeben, nruß eines auf's höchste überraschen und zwar
das, daß unsre Shakespeare-Professoren sich um die englische Bühne
und den Shakespeare auf d e rs e lb e n so wenig gekümmert haben.
Vieles würde ihnen da in einem anderen Lichte erschienen und
manche Frage, über die sie gestritten und sich den Kopf zerbrochen
haben, bereits praktisch gelöst vor sie hingetreten sein. Ich wette,
daß sie manches ohne weiteres aceeptirt hätten und mit Recht. Mit
Recht aus doppeltem Grunde; einmal, weil sich einem die Dinge
oftmals in jener schlagenden Cotumbus-Ei-Manier präsentiren, wo-
gegen eine Opposition nicht weiter möglich ist, andrerseits weil die
Autorität der Tradition diesen Darstellungen überall zur Seite steht.
Diese Tradition würde ohne die 20jährige Herrschaft des Purita-
nismus eine vollständigere und maßgebendere fein, aber was auch
alles über einen hundert Jahr verschollenen, erst um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts wieder belebten Shakespeare gefabelt sein mag,
es ist so ziemlich erwiesen, daß, mit Ausnahme jener zwanzig Jahre,'
die Herrschaft Shakespeare's auf der englischen Bühne kaum jemals
eine Unterbrechung erfahren hat. Er ist immer der Dichter des
Volks und selbst in Zeiten des ausschließlich französischen Geschmackes,
auf den kleinen Vorstadttheatern zu Hause gewcseu. Es liegt aber
aus der Hand, daß sich mit Rücksicht auf Shakespeare von einem
Bühnenwesen etwas lernen läßt, das seine Traditionen bis auf
Shakespeare selbst zurückführeu kann. Dies hat sich mir mehr als
einmal in dem kleinen Sadlers-Wells-Theater ausgedrängt, das zur
Zeit unter der Direktion von Mr. Phelps steht, des unbestritten
besten Shakespeare - Spielers der Gegenwart. Das Theater selbst,
oder richtiger der Name und die Eoncession desselben (das gegen-
wärtige Gebäude ist ganz neu) reichen bis ins 17. Jahrhundert
zurück. Was indeß dieser kleinen Bühne Bedeutung giebt ist nicht
ihr Alter, sondern lediglich dcr Mann, der gegenwärtig an der Spitze
derselben steht. Nicht das Sadlers-Wells-Theater als solches hat
*) 3ch habe diesmal unterlassen, ein Scenarinm ZN geben, da dies nur
dann von Interesse sein kann, wenn dcr Leser im Stande ist, eine Paralelle zu
ziehn. Diese ist nicht möglich, da, so viel ich weiß, das Stück ans deutschen Bühnen
nicht aufgeführt wird.
Traditionen, wohl aber spielt Mr. Phelps aus der Tradition her-
aus, er vertritt die Tradition. Wer sich etwas um die englischen
Bühnenzustände gekümmert hat, kann das sehr schön verfolgen.
Phelps, in seiner Jugend, hatte die Vorbilder Macready's, des älte-
ren Kean und des jüngeren Kemble; der jüngere Kemble lernte vom
älteren und der ältere war noch ein Zeitgenosse Garricks. So
weit zurück läßt sich die Leiter mit Leichtigkeit steigen. Nun heißt
es gemeinhin: mit Garrick beginne die eigentliche Shakespeare-Dar-
stellung auf der englischen Bühne, was vorher da war, sei nicht der
Rede werth gewesen. Das ist aber grundfalsch. Garrick stand so
gut auf den Schultern anderer wie Shakespeare selbst. Er war
eine Art Dawison seiner Epoche, genialisch abweichend von dem bis
dahin üblichen und keineswegs ausschließlich bewundert, sondern auch
heftig getadelt um eben dieser Abweichungen willen.*) Will Jemand
behaupten, daß Hr. Dawison eine absolut neue Erscheinung sei?
Auch Garrick war cs nicht und seine Vorbilder führen uns zurück
bis an die Grenze des Jahres 1700. 1673 wurde im Dorset-
Theater „der Sturm" gegeben. Karl II., der von 1660 bis 1683
regierte, liebte die Bühne wie sein Vater und theilte dessen Vorliebe
für Shakespeare. Da haben wir die Tradition bis zurück zur purita-
nischen Grenze, bis zu jenem Cromwell'schen Interregnum, das nicht
lange genug währte, um den lebendigen Strom der Ueberlieferung
im Sande verlaufen zu lassen. Ich habe diese historische Skizze mit
allem Vorbedacht gegeben. Je entschiedner der Beweis zu führen
ist, daß die allermodernste Repräsentation des Shakespeare bis auf
die Zeiten Shakespeare's selbst zurückzuführen ist, um so bedeutsamer
erweist sich ein Studium der modernen englischen Shakespearebühne
für das Studium Shakespeares selbst, und um so mehr muß es
Wunder nehmen, daß unsereShakespeareforscher, auch Tieck und Schlegel
so viel ich weiß, stets verabsäumt haben, das lebendige Wort ihres
Dichters so zu sagen an der Quelle aus sich wirken zu lassen.
Glaube man doch ja nicht, daß bloße Berichte dem abhelfen können.
Um so weniger, als die Berichte, und zwar jederzeit die besten, sich
an die Auffassung und Charakterzeichuuug, aber niemals an jene
hundert kleinen, unsagbaren Aeußerlichkeiten gehalten haben, die sich
nur sehen aber nicht beschreiben lassen, und die in ihrer Totalität
doch von höchstem Belange, von entschiedenster Wirkung sind. Es
ist mit der englischen Bühne wie cs mit dem gesammten englischen
Leben ist — Erbweisheits-Land, Land der Tradition.
Und eine dieser Bühnen-Traditionen ist die, daß die
beiden E d e l l e u t e von Verona ein vortreffliches Stück
seien. Während man sich in Deutschland darum gezankt hat, ob das
Stück ächt sei oder nicht, hat man es hier gegeben und sich seiner
gefreut. Daran hat man Recht gethan. Ich Hab' es gestern ge-
*) Das Publikum war voll Staunen und Bewunderung, aber die Kritiker
tadelten deftig. Gay „fand nichts besondres an ihm."
Litcralnr-Vlait.
8
Blatt
d e s
Deutschen Kunstblattes.
M 8.
Donnerstag, den 16. April.
1837.
Inhalt: Shakespeare auf der modernen englischen Bühne. Sechster Brief. „Die beiden Edelleute von Verona" im Sadlers-Wells-Theater. Siebenter Brief.
König Heinrich IV. (Erster Theil.) — Heimath und Ferne. Historischer Roman in 2 Bänden von Bernd v. Gnseck.
Shlikchnire aus dcr modernen englischen Dühnc.
Sechster Brief.
(„Die beiden Edelleute von Verona" im Sadlers-
Wells - Theater.) *)
Unsere Literatur über Shakespeare ist der englischen ebenbürtig.
Daß sie besser sei, daß wir erst den Engländern gezeigt hätten,
was cs mit diesem Shakespeare aus sich habe, ist eine jener vielen
Einbildungen, worin sich unser Nationalstol; gefällt, der beiläufig
bemerkt (und das ist ein wahres Glück) durchaus nicht an der Be-
scheidenheit krankt, die ihm nachgesagt worden ist. Jene Ebenbür-
tigkeit also zugegeben, nruß eines auf's höchste überraschen und zwar
das, daß unsre Shakespeare-Professoren sich um die englische Bühne
und den Shakespeare auf d e rs e lb e n so wenig gekümmert haben.
Vieles würde ihnen da in einem anderen Lichte erschienen und
manche Frage, über die sie gestritten und sich den Kopf zerbrochen
haben, bereits praktisch gelöst vor sie hingetreten sein. Ich wette,
daß sie manches ohne weiteres aceeptirt hätten und mit Recht. Mit
Recht aus doppeltem Grunde; einmal, weil sich einem die Dinge
oftmals in jener schlagenden Cotumbus-Ei-Manier präsentiren, wo-
gegen eine Opposition nicht weiter möglich ist, andrerseits weil die
Autorität der Tradition diesen Darstellungen überall zur Seite steht.
Diese Tradition würde ohne die 20jährige Herrschaft des Purita-
nismus eine vollständigere und maßgebendere fein, aber was auch
alles über einen hundert Jahr verschollenen, erst um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts wieder belebten Shakespeare gefabelt sein mag,
es ist so ziemlich erwiesen, daß, mit Ausnahme jener zwanzig Jahre,'
die Herrschaft Shakespeare's auf der englischen Bühne kaum jemals
eine Unterbrechung erfahren hat. Er ist immer der Dichter des
Volks und selbst in Zeiten des ausschließlich französischen Geschmackes,
auf den kleinen Vorstadttheatern zu Hause gewcseu. Es liegt aber
aus der Hand, daß sich mit Rücksicht auf Shakespeare von einem
Bühnenwesen etwas lernen läßt, das seine Traditionen bis auf
Shakespeare selbst zurückführeu kann. Dies hat sich mir mehr als
einmal in dem kleinen Sadlers-Wells-Theater ausgedrängt, das zur
Zeit unter der Direktion von Mr. Phelps steht, des unbestritten
besten Shakespeare - Spielers der Gegenwart. Das Theater selbst,
oder richtiger der Name und die Eoncession desselben (das gegen-
wärtige Gebäude ist ganz neu) reichen bis ins 17. Jahrhundert
zurück. Was indeß dieser kleinen Bühne Bedeutung giebt ist nicht
ihr Alter, sondern lediglich dcr Mann, der gegenwärtig an der Spitze
derselben steht. Nicht das Sadlers-Wells-Theater als solches hat
*) 3ch habe diesmal unterlassen, ein Scenarinm ZN geben, da dies nur
dann von Interesse sein kann, wenn dcr Leser im Stande ist, eine Paralelle zu
ziehn. Diese ist nicht möglich, da, so viel ich weiß, das Stück ans deutschen Bühnen
nicht aufgeführt wird.
Traditionen, wohl aber spielt Mr. Phelps aus der Tradition her-
aus, er vertritt die Tradition. Wer sich etwas um die englischen
Bühnenzustände gekümmert hat, kann das sehr schön verfolgen.
Phelps, in seiner Jugend, hatte die Vorbilder Macready's, des älte-
ren Kean und des jüngeren Kemble; der jüngere Kemble lernte vom
älteren und der ältere war noch ein Zeitgenosse Garricks. So
weit zurück läßt sich die Leiter mit Leichtigkeit steigen. Nun heißt
es gemeinhin: mit Garrick beginne die eigentliche Shakespeare-Dar-
stellung auf der englischen Bühne, was vorher da war, sei nicht der
Rede werth gewesen. Das ist aber grundfalsch. Garrick stand so
gut auf den Schultern anderer wie Shakespeare selbst. Er war
eine Art Dawison seiner Epoche, genialisch abweichend von dem bis
dahin üblichen und keineswegs ausschließlich bewundert, sondern auch
heftig getadelt um eben dieser Abweichungen willen.*) Will Jemand
behaupten, daß Hr. Dawison eine absolut neue Erscheinung sei?
Auch Garrick war cs nicht und seine Vorbilder führen uns zurück
bis an die Grenze des Jahres 1700. 1673 wurde im Dorset-
Theater „der Sturm" gegeben. Karl II., der von 1660 bis 1683
regierte, liebte die Bühne wie sein Vater und theilte dessen Vorliebe
für Shakespeare. Da haben wir die Tradition bis zurück zur purita-
nischen Grenze, bis zu jenem Cromwell'schen Interregnum, das nicht
lange genug währte, um den lebendigen Strom der Ueberlieferung
im Sande verlaufen zu lassen. Ich habe diese historische Skizze mit
allem Vorbedacht gegeben. Je entschiedner der Beweis zu führen
ist, daß die allermodernste Repräsentation des Shakespeare bis auf
die Zeiten Shakespeare's selbst zurückzuführen ist, um so bedeutsamer
erweist sich ein Studium der modernen englischen Shakespearebühne
für das Studium Shakespeares selbst, und um so mehr muß es
Wunder nehmen, daß unsereShakespeareforscher, auch Tieck und Schlegel
so viel ich weiß, stets verabsäumt haben, das lebendige Wort ihres
Dichters so zu sagen an der Quelle aus sich wirken zu lassen.
Glaube man doch ja nicht, daß bloße Berichte dem abhelfen können.
Um so weniger, als die Berichte, und zwar jederzeit die besten, sich
an die Auffassung und Charakterzeichuuug, aber niemals an jene
hundert kleinen, unsagbaren Aeußerlichkeiten gehalten haben, die sich
nur sehen aber nicht beschreiben lassen, und die in ihrer Totalität
doch von höchstem Belange, von entschiedenster Wirkung sind. Es
ist mit der englischen Bühne wie cs mit dem gesammten englischen
Leben ist — Erbweisheits-Land, Land der Tradition.
Und eine dieser Bühnen-Traditionen ist die, daß die
beiden E d e l l e u t e von Verona ein vortreffliches Stück
seien. Während man sich in Deutschland darum gezankt hat, ob das
Stück ächt sei oder nicht, hat man es hier gegeben und sich seiner
gefreut. Daran hat man Recht gethan. Ich Hab' es gestern ge-
*) Das Publikum war voll Staunen und Bewunderung, aber die Kritiker
tadelten deftig. Gay „fand nichts besondres an ihm."
Litcralnr-Vlait.
8