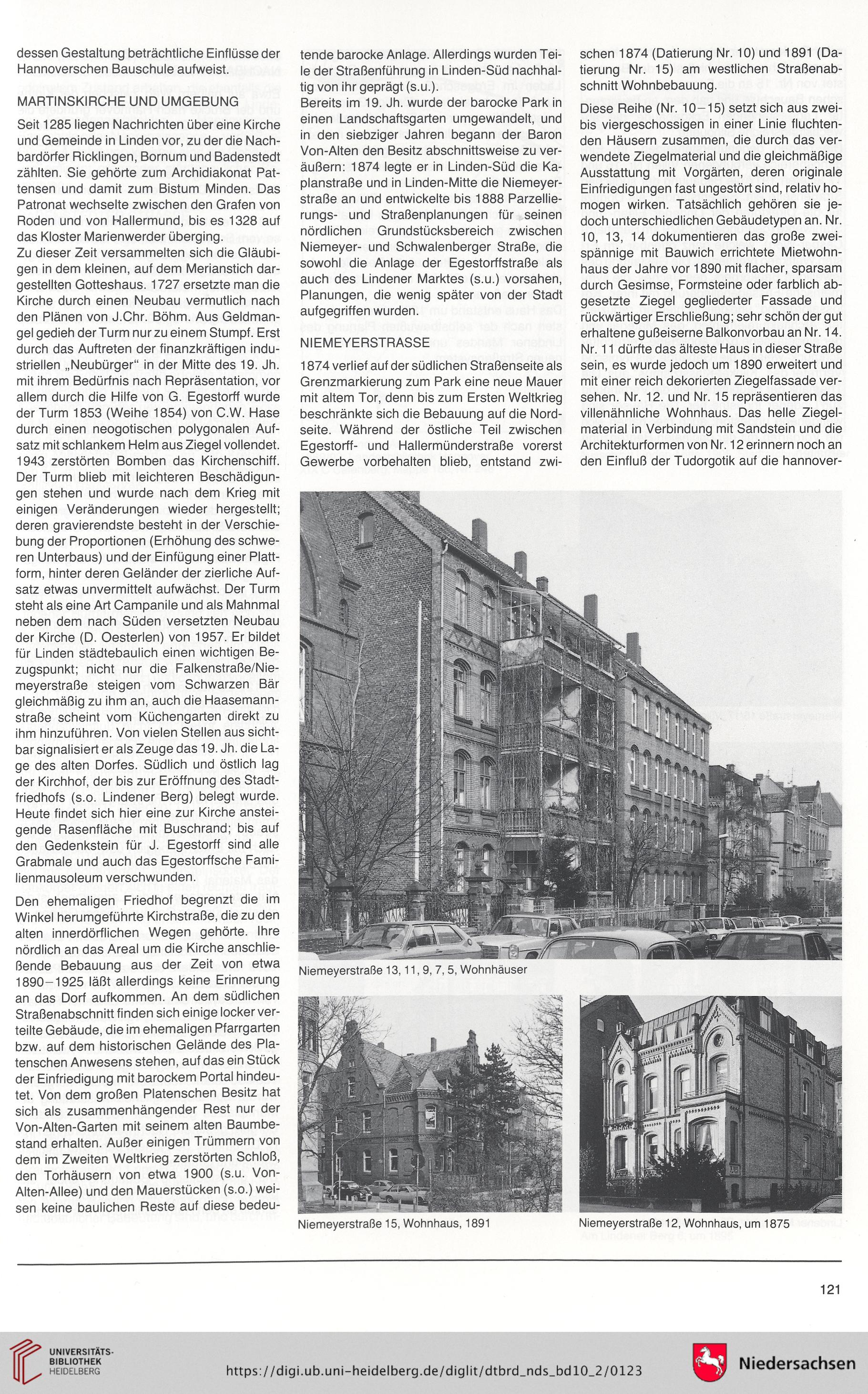dessen Gestaltung beträchtliche Einflüsse der
Hannoverschen Bauschule aufweist.
MARTINSKIRCHE UND UMGEBUNG
Seit 1285 liegen Nachrichten über eine Kirche
und Gemeinde in Linden vor, zu der die Nach-
bardörfer Ricklingen, Bornum und Badenstedt
zählten. Sie gehörte zum Archidiakonat Pat-
tensen und damit zum Bistum Minden. Das
Patronat wechselte zwischen den Grafen von
Roden und von Hallermund, bis es 1328 auf
das Kloster Marienwerder überging.
Zu dieser Zeit versammelten sich die Gläubi-
gen in dem kleinen, auf dem Merianstich dar-
gestellten Gotteshaus. 1727 ersetzte man die
Kirche durch einen Neubau vermutlich nach
den Plänen von J.Chr. Böhm. Aus Geldman-
gel gedieh der Turm nur zu einem Stumpf. Erst
durch das Auftreten der finanzkräftigen indu-
striellen „Neubürger“ in der Mitte des 19. Jh.
mit ihrem Bedürfnis nach Repräsentation, vor
allem durch die Hilfe von G. Egestorff wurde
der Turm 1853 (Weihe 1854) von C.W. Hase
durch einen neogotischen polygonalen Auf-
satz mit schlankem Helm aus Ziegel vollendet.
1943 zerstörten Bomben das Kirchenschiff.
Der Turm blieb mit leichteren Beschädigun-
gen stehen und wurde nach dem Krieg mit
einigen Veränderungen wieder hergestellt;
deren gravierendste besteht in der Verschie-
bung der Proportionen (Erhöhung des schwe-
ren Unterbaus) und der Einfügung einer Platt-
form, hinter deren Geländer der zierliche Auf-
satz etwas unvermittelt aufwächst. Der Turm
steht als eine Art Campanile und als Mahnmal
neben dem nach Süden versetzten Neubau
der Kirche (D. Oesterlen) von 1957. Er bildet
für Linden städtebaulich einen wichtigen Be-
zugspunkt; nicht nur die Falkenstraße/Nie-
meyerstraße steigen vom Schwarzen Bär
gleichmäßig zu ihm an, auch die Haasemann-
straße scheint vom Küchengarten direkt zu
ihm hinzuführen. Von vielen Stellen aus sicht-
bar signalisiert er als Zeuge das 19. Jh. die La-
ge des alten Dorfes. Südlich und östlich lag
der Kirchhof, der bis zur Eröffnung des Stadt-
friedhofs (s.o. Lindener Berg) belegt wurde.
Heute findet sich hier eine zur Kirche anstei-
gende Rasenfläche mit Buschrand; bis auf
den Gedenkstein für J. Egestorff sind alle
Grabmale und auch das Egestorffsche Fami-
lienmausoleum verschwunden.
Den ehemaligen Friedhof begrenzt die im
Winkel herumgeführte Kirchstraße, die zu den
alten innerdörflichen Wegen gehörte. Ihre
nördlich an das Areal um die Kirche anschlie-
ßende Bebauung aus der Zeit von etwa
1890-1925 läßt allerdings keine Erinnerung
an das Dorf aufkommen. An dem südlichen
Straßenabschnitt finden sich einige locker ver-
teilte Gebäude, die im ehemaligen Pfarrgarten
bzw. auf dem historischen Gelände des Pla-
tenschen Anwesens stehen, auf das ein Stück
der Einfriedigung mit barockem Portal hindeu-
tet. Von dem großen Platenschen Besitz hat
sich als zusammenhängender Rest nur der
Von-Alten-Garten mit seinem alten Baumbe-
stand erhalten. Außer einigen Trümmern von
dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schloß,
den Torhäusern von etwa 1900 (s.u. Von-
Alten-Allee) und den Mauerstücken (s.o.) wei-
sen keine baulichen Reste auf diese bedeu-
tende barocke Anlage. Allerdings wurden Tei-
le der Straßenführung in Linden-Süd nachhal-
tig von ihr geprägt (s.u.).
Bereits im 19. Jh. wurde der barocke Park in
einen Landschaftsgarten umgewandelt, und
in den siebziger Jahren begann der Baron
Von-Alten den Besitz abschnittsweise zu ver-
äußern: 1874 legte er in Linden-Süd die Ka-
planstraße und in Linden-Mitte die Niemeyer-
straße an und entwickelte bis 1888 Parzellie-
rungs- und Straßenplanungen für seinen
nördlichen Grundstücksbereich zwischen
Niemeyer- und Schwalenberger Straße, die
sowohl die Anlage der Egestorffstraße als
auch des Lindener Marktes (s.u.) vorsahen,
Planungen, die wenig später von der Stadt
aufgegriffen wurden.
NIEMEYERSTRASSE
1874 verlief auf der südlichen Straßenseite als
Grenzmarkierung zum Park eine neue Mauer
mit altem Tor, denn bis zum Ersten Weltkrieg
beschränkte sich die Bebauung auf die Nord-
seite. Während der östliche Teil zwischen
Egestorff- und Hallermünderstraße vorerst
Gewerbe vorbehalten blieb, entstand zwi¬
schen 1874 (Datierung Nr. 10) und 1891 (Da-
tierung Nr. 15) am westlichen Straßenab-
schnitt Wohnbebauung.
Diese Reihe (Nr. 10-15) setzt sich aus zwei-
bis viergeschossigen in einer Linie fluchten-
den Häusern zusammen, die durch das ver-
wendete Ziegelmaterial und die gleichmäßige
Ausstattung mit Vorgärten, deren originale
Einfriedigungen fast ungestört sind, relativ ho-
mogen wirken. Tatsächlich gehören sie je-
doch unterschiedlichen Gebäudetypen an. Nr.
10, 13, 14 dokumentieren das große zwei-
spännige mit Bauwich errichtete Mietwohn-
haus der Jahre vor 1890 mit flacher, sparsam
durch Gesimse, Formsteine oder farblich ab-
gesetzte Ziegel gegliederter Fassade und
rückwärtiger Erschließung; sehr schön der gut
erhaltene gußeiserne Balkonvorbau an Nr. 14.
Nr. 11 dürfte das älteste Haus in dieser Straße
sein, es wurde jedoch um 1890 erweitert und
mit einer reich dekorierten Ziegelfassade ver-
sehen. Nr. 12. und Nr. 15 repräsentieren das
villenähnliche Wohnhaus. Das helle Ziegel-
material in Verbindung mit Sandstein und die
Architekturformen von Nr. 12 erinnern noch an
den Einfluß der Tudorgotik auf die hannover-
Niemeyerstraße 13,11,9, 7, 5, Wohnhäuser
Niemeyerstraße 15, Wohnhaus, 1891
Niemeyerstraße 12, Wohnhaus, um 1875
121
Hannoverschen Bauschule aufweist.
MARTINSKIRCHE UND UMGEBUNG
Seit 1285 liegen Nachrichten über eine Kirche
und Gemeinde in Linden vor, zu der die Nach-
bardörfer Ricklingen, Bornum und Badenstedt
zählten. Sie gehörte zum Archidiakonat Pat-
tensen und damit zum Bistum Minden. Das
Patronat wechselte zwischen den Grafen von
Roden und von Hallermund, bis es 1328 auf
das Kloster Marienwerder überging.
Zu dieser Zeit versammelten sich die Gläubi-
gen in dem kleinen, auf dem Merianstich dar-
gestellten Gotteshaus. 1727 ersetzte man die
Kirche durch einen Neubau vermutlich nach
den Plänen von J.Chr. Böhm. Aus Geldman-
gel gedieh der Turm nur zu einem Stumpf. Erst
durch das Auftreten der finanzkräftigen indu-
striellen „Neubürger“ in der Mitte des 19. Jh.
mit ihrem Bedürfnis nach Repräsentation, vor
allem durch die Hilfe von G. Egestorff wurde
der Turm 1853 (Weihe 1854) von C.W. Hase
durch einen neogotischen polygonalen Auf-
satz mit schlankem Helm aus Ziegel vollendet.
1943 zerstörten Bomben das Kirchenschiff.
Der Turm blieb mit leichteren Beschädigun-
gen stehen und wurde nach dem Krieg mit
einigen Veränderungen wieder hergestellt;
deren gravierendste besteht in der Verschie-
bung der Proportionen (Erhöhung des schwe-
ren Unterbaus) und der Einfügung einer Platt-
form, hinter deren Geländer der zierliche Auf-
satz etwas unvermittelt aufwächst. Der Turm
steht als eine Art Campanile und als Mahnmal
neben dem nach Süden versetzten Neubau
der Kirche (D. Oesterlen) von 1957. Er bildet
für Linden städtebaulich einen wichtigen Be-
zugspunkt; nicht nur die Falkenstraße/Nie-
meyerstraße steigen vom Schwarzen Bär
gleichmäßig zu ihm an, auch die Haasemann-
straße scheint vom Küchengarten direkt zu
ihm hinzuführen. Von vielen Stellen aus sicht-
bar signalisiert er als Zeuge das 19. Jh. die La-
ge des alten Dorfes. Südlich und östlich lag
der Kirchhof, der bis zur Eröffnung des Stadt-
friedhofs (s.o. Lindener Berg) belegt wurde.
Heute findet sich hier eine zur Kirche anstei-
gende Rasenfläche mit Buschrand; bis auf
den Gedenkstein für J. Egestorff sind alle
Grabmale und auch das Egestorffsche Fami-
lienmausoleum verschwunden.
Den ehemaligen Friedhof begrenzt die im
Winkel herumgeführte Kirchstraße, die zu den
alten innerdörflichen Wegen gehörte. Ihre
nördlich an das Areal um die Kirche anschlie-
ßende Bebauung aus der Zeit von etwa
1890-1925 läßt allerdings keine Erinnerung
an das Dorf aufkommen. An dem südlichen
Straßenabschnitt finden sich einige locker ver-
teilte Gebäude, die im ehemaligen Pfarrgarten
bzw. auf dem historischen Gelände des Pla-
tenschen Anwesens stehen, auf das ein Stück
der Einfriedigung mit barockem Portal hindeu-
tet. Von dem großen Platenschen Besitz hat
sich als zusammenhängender Rest nur der
Von-Alten-Garten mit seinem alten Baumbe-
stand erhalten. Außer einigen Trümmern von
dem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schloß,
den Torhäusern von etwa 1900 (s.u. Von-
Alten-Allee) und den Mauerstücken (s.o.) wei-
sen keine baulichen Reste auf diese bedeu-
tende barocke Anlage. Allerdings wurden Tei-
le der Straßenführung in Linden-Süd nachhal-
tig von ihr geprägt (s.u.).
Bereits im 19. Jh. wurde der barocke Park in
einen Landschaftsgarten umgewandelt, und
in den siebziger Jahren begann der Baron
Von-Alten den Besitz abschnittsweise zu ver-
äußern: 1874 legte er in Linden-Süd die Ka-
planstraße und in Linden-Mitte die Niemeyer-
straße an und entwickelte bis 1888 Parzellie-
rungs- und Straßenplanungen für seinen
nördlichen Grundstücksbereich zwischen
Niemeyer- und Schwalenberger Straße, die
sowohl die Anlage der Egestorffstraße als
auch des Lindener Marktes (s.u.) vorsahen,
Planungen, die wenig später von der Stadt
aufgegriffen wurden.
NIEMEYERSTRASSE
1874 verlief auf der südlichen Straßenseite als
Grenzmarkierung zum Park eine neue Mauer
mit altem Tor, denn bis zum Ersten Weltkrieg
beschränkte sich die Bebauung auf die Nord-
seite. Während der östliche Teil zwischen
Egestorff- und Hallermünderstraße vorerst
Gewerbe vorbehalten blieb, entstand zwi¬
schen 1874 (Datierung Nr. 10) und 1891 (Da-
tierung Nr. 15) am westlichen Straßenab-
schnitt Wohnbebauung.
Diese Reihe (Nr. 10-15) setzt sich aus zwei-
bis viergeschossigen in einer Linie fluchten-
den Häusern zusammen, die durch das ver-
wendete Ziegelmaterial und die gleichmäßige
Ausstattung mit Vorgärten, deren originale
Einfriedigungen fast ungestört sind, relativ ho-
mogen wirken. Tatsächlich gehören sie je-
doch unterschiedlichen Gebäudetypen an. Nr.
10, 13, 14 dokumentieren das große zwei-
spännige mit Bauwich errichtete Mietwohn-
haus der Jahre vor 1890 mit flacher, sparsam
durch Gesimse, Formsteine oder farblich ab-
gesetzte Ziegel gegliederter Fassade und
rückwärtiger Erschließung; sehr schön der gut
erhaltene gußeiserne Balkonvorbau an Nr. 14.
Nr. 11 dürfte das älteste Haus in dieser Straße
sein, es wurde jedoch um 1890 erweitert und
mit einer reich dekorierten Ziegelfassade ver-
sehen. Nr. 12. und Nr. 15 repräsentieren das
villenähnliche Wohnhaus. Das helle Ziegel-
material in Verbindung mit Sandstein und die
Architekturformen von Nr. 12 erinnern noch an
den Einfluß der Tudorgotik auf die hannover-
Niemeyerstraße 13,11,9, 7, 5, Wohnhäuser
Niemeyerstraße 15, Wohnhaus, 1891
Niemeyerstraße 12, Wohnhaus, um 1875
121