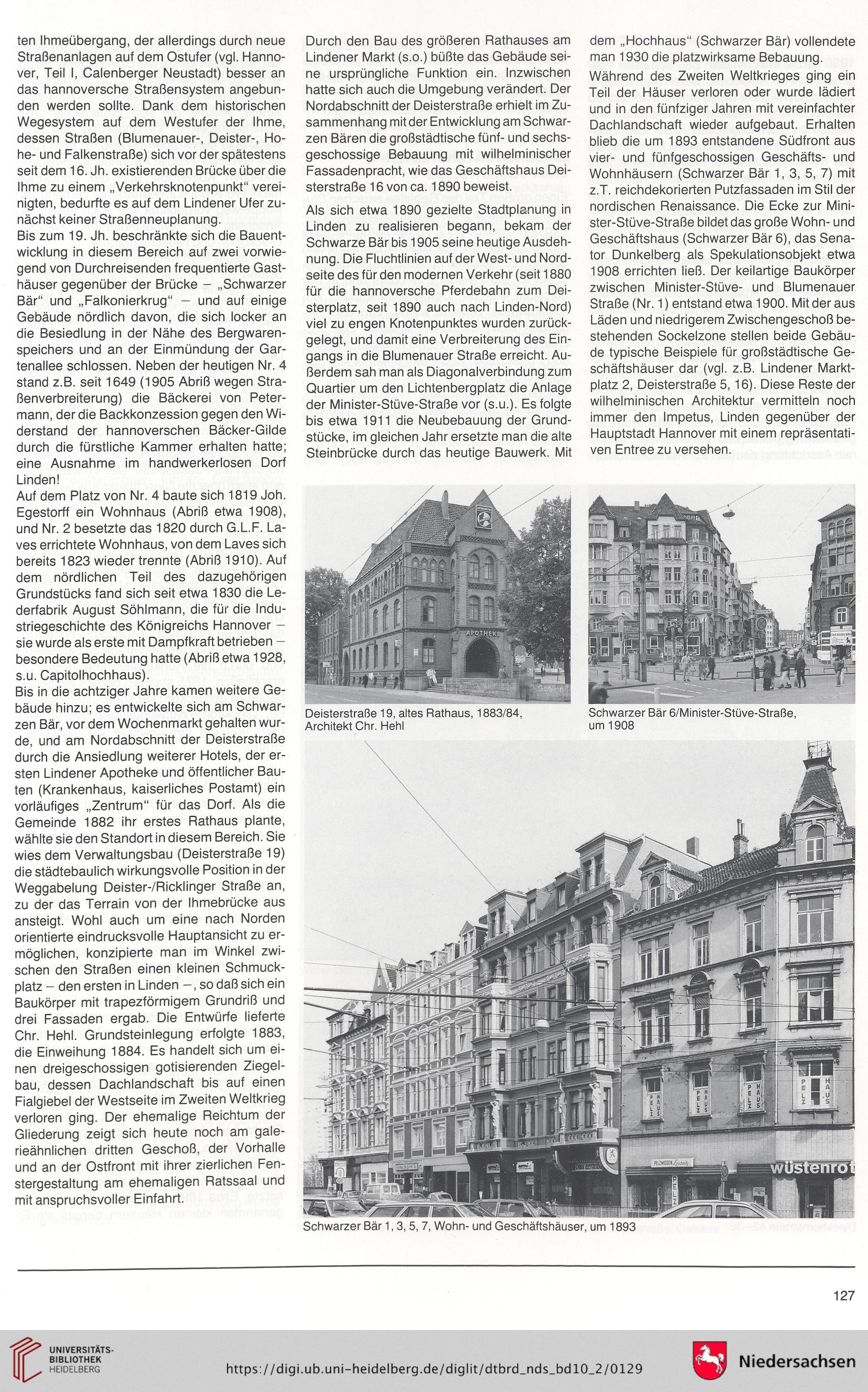ten Ihmeübergang, der allerdings durch neue
Straßenanlagen auf dem Ostufer (vgl. Hanno-
ver, Teil I, Calenberger Neustadt) besser an
das hannoversche Straßensystem angebun-
den werden sollte. Dank dem historischen
Wegesystem auf dem Westufer der Ihme,
dessen Straßen (Blumenauer-, Deister-, Ho-
he- und Falkenstraße) sich vor der spätestens
seit dem 16. Jh. existierenden Brücke über die
Ihme zu einem „Verkehrsknotenpunkt“ verei-
nigten, bedurfte es auf dem Lindener Ufer zu-
nächst keiner Straßenneuplanung.
Bis zum 19. Jh. beschränkte sich die Bauent-
wicklung in diesem Bereich auf zwei vorwie-
gend von Durchreisenden frequentierte Gast-
häuser gegenüber der Brücke - „Schwarzer
Bär“ und „Falkonierkrug“ - und auf einige
Gebäude nördlich davon, die sich locker an
die Besiedlung in der Nähe des Bergwaren-
speichers und an der Einmündung der Gar-
tenallee schlossen. Neben der heutigen Nr. 4
stand z.B. seit 1649 (1905 Abriß wegen Stra-
ßenverbreiterung) die Bäckerei von Peter-
mann, der die Backkonzession gegen den Wi-
derstand der hannoverschen Bäcker-Gilde
durch die fürstliche Kammer erhalten hatte;
eine Ausnahme im handwerkerlosen Dorf
Linden!
Auf dem Platz von Nr. 4 baute sich 1819 Joh.
Egestorff ein Wohnhaus (Abriß etwa 1908),
und Nr. 2 besetzte das 1820 durch G.L.F. La-
ves errichtete Wohnhaus, von dem Laves sich
bereits 1823 wieder trennte (Abriß 1910). Auf
dem nördlichen Teil des dazugehörigen
Grundstücks fand sich seit etwa 1830 die Le-
derfabrik August Söhlmann, die für die Indu-
striegeschichte des Königreichs Hannover -
sie wurde als erste mit Dampfkraft betrieben -
besondere Bedeutung hatte (Abriß etwa 1928,
s.u. Capitolhochhaus).
Bis in die achtziger Jahre kamen weitere Ge-
bäude hinzu; es entwickelte sich am Schwar-
zen Bär, vor dem Wochenmarkt gehalten wur-
de, und am Nordabschnitt der Deisterstraße
durch die Ansiedlung weiterer Hotels, der er-
sten Lindener Apotheke und öffentlicher Bau-
ten (Krankenhaus, kaiserliches Postamt) ein
vorläufiges „Zentrum“ für das Dorf. Als die
Gemeinde 1882 ihr erstes Rathaus plante,
wählte sie den Standort in diesem Bereich. Sie
wies dem Verwaltungsbau (Deisterstraße 19)
die städtebaulich wirkungsvolle Position in der
Weggabelung Deister-/Ricklinger Straße an,
zu der das Terrain von der Ihmebrücke aus
ansteigt. Wohl auch um eine nach Norden
orientierte eindrucksvolle Hauptansicht zu er-
möglichen, konzipierte man im Winkel zwi-
schen den Straßen einen kleinen Schmuck-
platz - den ersten in Linden —, so daß sich ein
Baukörper mit trapezförmigem Grundriß und
drei Fassaden ergab. Die Entwürfe lieferte
Chr. Hehl. Grundsteinlegung erfolgte 1883,
die Einweihung 1884. Es handelt sich um ei-
nen dreigeschossigen gotisierenden Ziegel-
bau, dessen Dachlandschaft bis auf einen
Fialgiebel der Westseite im Zweiten Weltkrieg
verloren ging. Der ehemalige Reichtum der
Gliederung zeigt sich heute noch am gale-
rieähnlichen dritten Geschoß, der Vorhalle
und an der Ostfront mit ihrer zierlichen Fen-
stergestaltung am ehemaligen Ratssaal und
mit anspruchsvoller Einfahrt.
Durch den Bau des größeren Rathauses am
Lindener Markt (s.o.) büßte das Gebäude sei-
ne ursprüngliche Funktion ein. Inzwischen
hatte sich auch die Umgebung verändert. Der
Nordabschnitt der Deisterstraße erhielt im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung am Schwar-
zen Bären die großstädtische fünf- und sechs-
geschossige Bebauung mit wilhelminischer
Fassadenpracht, wie das Geschäftshaus Dei-
sterstraße 16 von ca. 1890 beweist.
Als sich etwa 1890 gezielte Stadtplanung in
Linden zu realisieren begann, bekam der
Schwarze Bär bis 1905 seine heutige Ausdeh-
nung. Die Fluchtlinien auf der West- und Nord-
seite des für den modernen Verkehr (seit 1880
für die hannoversche Pferdebahn zum Dei-
sterplatz, seit 1890 auch nach Linden-Nord)
viel zu engen Knotenpunktes wurden zurück-
gelegt, und damit eine Verbreiterung des Ein-
gangs in die Blumenauer Straße erreicht. Au-
ßerdem sah man als Diagonalverbindung zum
Quartier um den Lichtenbergplatz die Anlage
der Minister-Stüve-Straße vor (s.u.). Es folgte
bis etwa 1911 die Neubebauung der Grund-
stücke, im gleichen Jahr ersetzte man die alte
Steinbrücke durch das heutige Bauwerk. Mit
dem „Hochhaus“ (Schwarzer Bär) vollendete
man 1930 die platzwirksame Bebauung.
Während des Zweiten Weltkrieges ging ein
Teil der Häuser verloren oder wurde lädiert
und in den fünfziger Jahren mit vereinfachter
Dachlandschaft wieder aufgebaut. Erhalten
blieb die um 1893 entstandene Südfront aus
vier- und fünfgeschossigen Geschäfts- und
Wohnhäusern (Schwarzer Bär 1,3, 5, 7) mit
z.T. reichdekorierten Putzfassaden im Stil der
nordischen Renaissance. Die Ecke zur Mini-
ster-Stüve-Straße bildet das große Wohn- und
Geschäftshaus (Schwarzer Bär 6), das Sena-
tor Dunkelberg als Spekulationsobjekt etwa
1908 errichten ließ. Der keilartige Baukörper
zwischen Minister-Stüve- und Blumenauer
Straße (Nr. 1) entstand etwa 1900. Mit der aus
Läden und niedrigerem Zwischengeschoß be-
stehenden Sockelzone stellen beide Gebäu-
de typische Beispiele für großstädtische Ge-
schäftshäuser dar (vgl. z.B. Lindener Markt-
platz 2, Deisterstraße 5,16). Diese Reste der
wilhelminischen Architektur vermitteln noch
immer den Impetus, Linden gegenüber der
Hauptstadt Hannover mit einem repräsentati-
ven Entree zu versehen.
Deisterstraße 19, altes Rathaus, 1883/84,
Architekt Chr. Hehl
Schwarzer Bär 6/Minister-Stüve-Straße,
um 1908
Schwarzer Bär 1,3, 5, 7, Wohn- und Geschäftshäuser, um 1893
127
Straßenanlagen auf dem Ostufer (vgl. Hanno-
ver, Teil I, Calenberger Neustadt) besser an
das hannoversche Straßensystem angebun-
den werden sollte. Dank dem historischen
Wegesystem auf dem Westufer der Ihme,
dessen Straßen (Blumenauer-, Deister-, Ho-
he- und Falkenstraße) sich vor der spätestens
seit dem 16. Jh. existierenden Brücke über die
Ihme zu einem „Verkehrsknotenpunkt“ verei-
nigten, bedurfte es auf dem Lindener Ufer zu-
nächst keiner Straßenneuplanung.
Bis zum 19. Jh. beschränkte sich die Bauent-
wicklung in diesem Bereich auf zwei vorwie-
gend von Durchreisenden frequentierte Gast-
häuser gegenüber der Brücke - „Schwarzer
Bär“ und „Falkonierkrug“ - und auf einige
Gebäude nördlich davon, die sich locker an
die Besiedlung in der Nähe des Bergwaren-
speichers und an der Einmündung der Gar-
tenallee schlossen. Neben der heutigen Nr. 4
stand z.B. seit 1649 (1905 Abriß wegen Stra-
ßenverbreiterung) die Bäckerei von Peter-
mann, der die Backkonzession gegen den Wi-
derstand der hannoverschen Bäcker-Gilde
durch die fürstliche Kammer erhalten hatte;
eine Ausnahme im handwerkerlosen Dorf
Linden!
Auf dem Platz von Nr. 4 baute sich 1819 Joh.
Egestorff ein Wohnhaus (Abriß etwa 1908),
und Nr. 2 besetzte das 1820 durch G.L.F. La-
ves errichtete Wohnhaus, von dem Laves sich
bereits 1823 wieder trennte (Abriß 1910). Auf
dem nördlichen Teil des dazugehörigen
Grundstücks fand sich seit etwa 1830 die Le-
derfabrik August Söhlmann, die für die Indu-
striegeschichte des Königreichs Hannover -
sie wurde als erste mit Dampfkraft betrieben -
besondere Bedeutung hatte (Abriß etwa 1928,
s.u. Capitolhochhaus).
Bis in die achtziger Jahre kamen weitere Ge-
bäude hinzu; es entwickelte sich am Schwar-
zen Bär, vor dem Wochenmarkt gehalten wur-
de, und am Nordabschnitt der Deisterstraße
durch die Ansiedlung weiterer Hotels, der er-
sten Lindener Apotheke und öffentlicher Bau-
ten (Krankenhaus, kaiserliches Postamt) ein
vorläufiges „Zentrum“ für das Dorf. Als die
Gemeinde 1882 ihr erstes Rathaus plante,
wählte sie den Standort in diesem Bereich. Sie
wies dem Verwaltungsbau (Deisterstraße 19)
die städtebaulich wirkungsvolle Position in der
Weggabelung Deister-/Ricklinger Straße an,
zu der das Terrain von der Ihmebrücke aus
ansteigt. Wohl auch um eine nach Norden
orientierte eindrucksvolle Hauptansicht zu er-
möglichen, konzipierte man im Winkel zwi-
schen den Straßen einen kleinen Schmuck-
platz - den ersten in Linden —, so daß sich ein
Baukörper mit trapezförmigem Grundriß und
drei Fassaden ergab. Die Entwürfe lieferte
Chr. Hehl. Grundsteinlegung erfolgte 1883,
die Einweihung 1884. Es handelt sich um ei-
nen dreigeschossigen gotisierenden Ziegel-
bau, dessen Dachlandschaft bis auf einen
Fialgiebel der Westseite im Zweiten Weltkrieg
verloren ging. Der ehemalige Reichtum der
Gliederung zeigt sich heute noch am gale-
rieähnlichen dritten Geschoß, der Vorhalle
und an der Ostfront mit ihrer zierlichen Fen-
stergestaltung am ehemaligen Ratssaal und
mit anspruchsvoller Einfahrt.
Durch den Bau des größeren Rathauses am
Lindener Markt (s.o.) büßte das Gebäude sei-
ne ursprüngliche Funktion ein. Inzwischen
hatte sich auch die Umgebung verändert. Der
Nordabschnitt der Deisterstraße erhielt im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung am Schwar-
zen Bären die großstädtische fünf- und sechs-
geschossige Bebauung mit wilhelminischer
Fassadenpracht, wie das Geschäftshaus Dei-
sterstraße 16 von ca. 1890 beweist.
Als sich etwa 1890 gezielte Stadtplanung in
Linden zu realisieren begann, bekam der
Schwarze Bär bis 1905 seine heutige Ausdeh-
nung. Die Fluchtlinien auf der West- und Nord-
seite des für den modernen Verkehr (seit 1880
für die hannoversche Pferdebahn zum Dei-
sterplatz, seit 1890 auch nach Linden-Nord)
viel zu engen Knotenpunktes wurden zurück-
gelegt, und damit eine Verbreiterung des Ein-
gangs in die Blumenauer Straße erreicht. Au-
ßerdem sah man als Diagonalverbindung zum
Quartier um den Lichtenbergplatz die Anlage
der Minister-Stüve-Straße vor (s.u.). Es folgte
bis etwa 1911 die Neubebauung der Grund-
stücke, im gleichen Jahr ersetzte man die alte
Steinbrücke durch das heutige Bauwerk. Mit
dem „Hochhaus“ (Schwarzer Bär) vollendete
man 1930 die platzwirksame Bebauung.
Während des Zweiten Weltkrieges ging ein
Teil der Häuser verloren oder wurde lädiert
und in den fünfziger Jahren mit vereinfachter
Dachlandschaft wieder aufgebaut. Erhalten
blieb die um 1893 entstandene Südfront aus
vier- und fünfgeschossigen Geschäfts- und
Wohnhäusern (Schwarzer Bär 1,3, 5, 7) mit
z.T. reichdekorierten Putzfassaden im Stil der
nordischen Renaissance. Die Ecke zur Mini-
ster-Stüve-Straße bildet das große Wohn- und
Geschäftshaus (Schwarzer Bär 6), das Sena-
tor Dunkelberg als Spekulationsobjekt etwa
1908 errichten ließ. Der keilartige Baukörper
zwischen Minister-Stüve- und Blumenauer
Straße (Nr. 1) entstand etwa 1900. Mit der aus
Läden und niedrigerem Zwischengeschoß be-
stehenden Sockelzone stellen beide Gebäu-
de typische Beispiele für großstädtische Ge-
schäftshäuser dar (vgl. z.B. Lindener Markt-
platz 2, Deisterstraße 5,16). Diese Reste der
wilhelminischen Architektur vermitteln noch
immer den Impetus, Linden gegenüber der
Hauptstadt Hannover mit einem repräsentati-
ven Entree zu versehen.
Deisterstraße 19, altes Rathaus, 1883/84,
Architekt Chr. Hehl
Schwarzer Bär 6/Minister-Stüve-Straße,
um 1908
Schwarzer Bär 1,3, 5, 7, Wohn- und Geschäftshäuser, um 1893
127