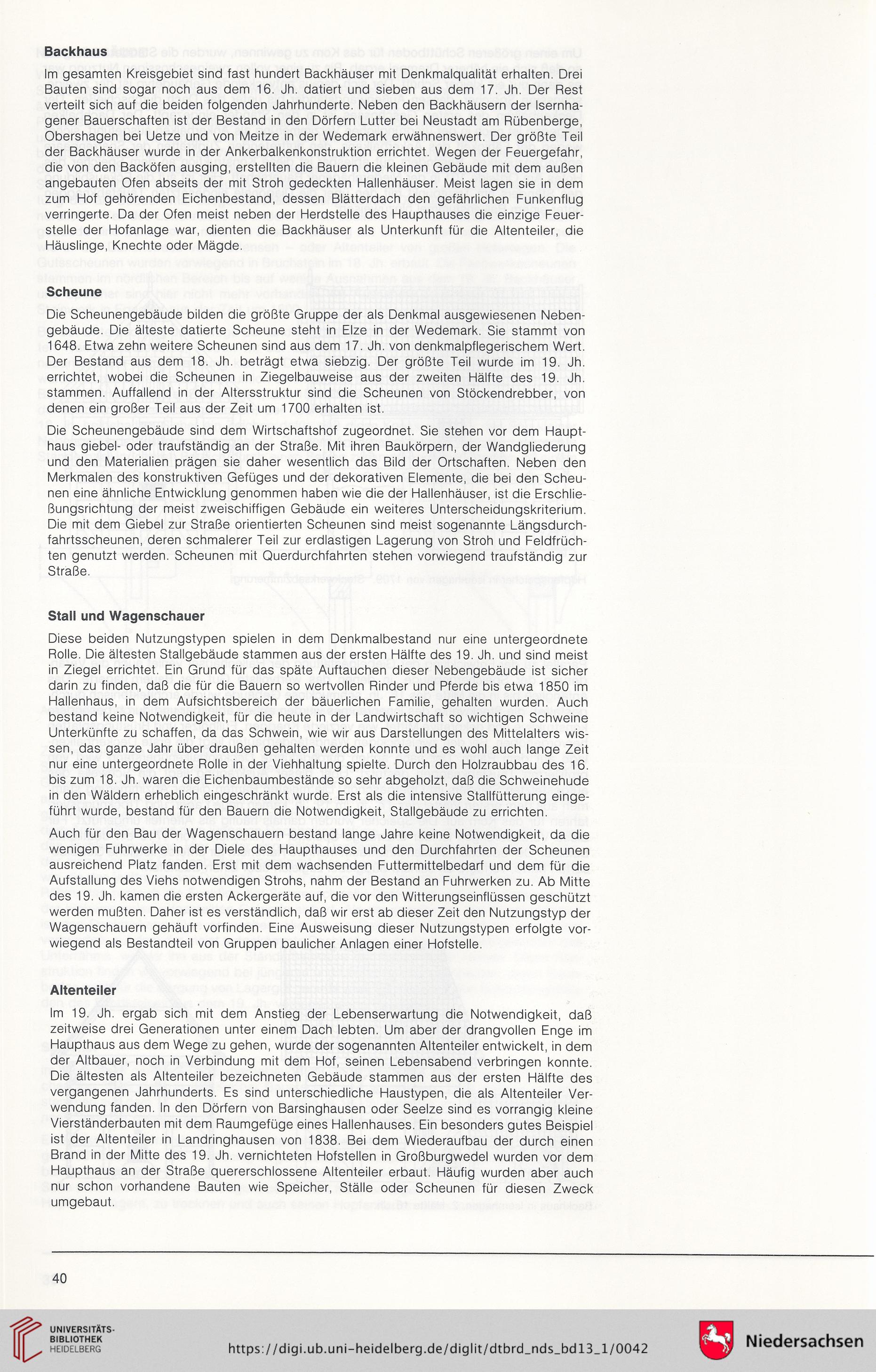Backhaus
Im gesamten Kreisgebiet sind fast hundert Backhäuser mit Denkmalqualität erhalten. Drei
Bauten sind sogar noch aus dem 16. Jh. datiert und sieben aus dem 17. Jh. Der Rest
verteilt sich auf die beiden folgenden Jahrhunderte. Neben den Backhäusern der Isernha-
gener Bauerschaften ist der Bestand in den Dörfern Lutter bei Neustadt am Rübenberge,
Obershagen bei Uetze und von Meitze in der Wedemark erwähnenswert. Der größte Teil
der Backhäuser wurde in der Ankerbalkenkonstruktion errichtet. Wegen der Feuergefahr,
die von den Backöfen ausging, erstellten die Bauern die kleinen Gebäude mit dem außen
angebauten Ofen abseits der mit Stroh gedeckten Hallenhäuser. Meist lagen sie in dem
zum Hof gehörenden Eichenbestand, dessen Blätterdach den gefährlichen Funkenflug
verringerte. Da der Ofen meist neben der Herdstelle des Haupthauses die einzige Feuer-
stelle der Hofanlage war, dienten die Backhäuser als Unterkunft für die Altenteiler, die
Häuslinge, Knechte oder Mägde.
Scheune
Die Scheunengebäude bilden die größte Gruppe der als Denkmal ausgewiesenen Neben-
gebäude. Die älteste datierte Scheune steht in Elze in der Wedemark. Sie stammt von
1648. Etwa zehn weitere Scheunen sind aus dem 17. Jh. von denkmalpflegerischem Wert.
Der Bestand aus dem 18. Jh. beträgt etwa siebzig. Der größte Teil wurde im 19. Jh.
errichtet, wobei die Scheunen in Ziegelbauweise aus der zweiten Hälfte des 19. Jh.
stammen. Auffallend in der Altersstruktur sind die Scheunen von Stöckendrebber, von
denen ein großer Teil aus der Zeit um 1700 erhalten ist.
Die Scheunengebäude sind dem Wirtschaftshof zugeordnet. Sie stehen vor dem Haupt-
haus giebel- oder traufständig an der Straße. Mit ihren Baukörpern, der Wandgliederung
und den Materialien prägen sie daher wesentlich das Bild der Ortschaften. Neben den
Merkmalen des konstruktiven Gefüges und der dekorativen Elemente, die bei den Scheu-
nen eine ähnliche Entwicklung genommen haben wie die der Hallenhäuser, ist die Erschlie-
ßungsrichtung der meist zweischiffigen Gebäude ein weiteres Unterscheidungskriterium.
Die mit dem Giebel zur Straße orientierten Scheunen sind meist sogenannte Längsdurch-
fahrtsscheunen, deren schmalerer Teil zur erdlastigen Lagerung von Stroh und Feldfrüch-
ten genutzt werden. Scheunen mit Querdurchfahrten stehen vorwiegend traufständig zur
Straße.
Stall und Wagenschauer
Diese beiden Nutzungstypen spielen in dem Denkmalbestand nur eine untergeordnete
Rolle. Die ältesten Stallgebäude stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jh. und sind meist
in Ziegel errichtet. Ein Grund für das späte Auftauchen dieser Nebengebäude ist sicher
darin zu finden, daß die für die Bauern so wertvollen Rinder und Pferde bis etwa 1850 im
Hallenhaus, in dem Aufsichtsbereich der bäuerlichen Familie, gehalten wurden. Auch
bestand keine Notwendigkeit, für die heute in der Landwirtschaft so wichtigen Schweine
Unterkünfte zu schaffen, da das Schwein, wie wir aus Darstellungen des Mittelalters wis-
sen, das ganze Jahr über draußen gehalten werden konnte und es wohl auch lange Zeit
nur eine untergeordnete Rolle in der Viehhaltung spielte. Durch den Holzraubbau des 16.
bis zum 18. Jh. waren die Eichenbaumbestände so sehr abgeholzt, daß die Schweinehude
in den Wäldern erheblich eingeschränkt wurde. Erst als die intensive Stallfütterung einge-
führt wurde, bestand für den Bauern die Notwendigkeit, Stallgebäude zu errichten.
Auch für den Bau der Wagenschauern bestand lange Jahre keine Notwendigkeit, da die
wenigen Fuhrwerke in der Diele des Haupthauses und den Durchfahrten der Scheunen
ausreichend Platz fanden. Erst mit dem wachsenden Futtermittelbedarf und dem für die
Aufstallung des Viehs notwendigen Strohs, nahm der Bestand an Fuhrwerken zu. Ab Mitte
des 19. Jh. kamen die ersten Ackergeräte auf, die vor den Witterungseinflüssen geschützt
werden mußten. Daher ist es verständlich, daß wir erst ab dieser Zeit den Nutzungstyp der
Wagenschauern gehäuft vorfinden. Eine Ausweisung dieser Nutzungstypen erfolgte vor-
wiegend als Bestandteil von Gruppen baulicher Anlagen einer Hofstelle.
Altenteiler
Im 19. Jh. ergab sich mit dem Anstieg der Lebenserwartung die Notwendigkeit, daß
zeitweise drei Generationen unter einem Dach lebten. Um aber der drangvollen Enge im
Haupthaus aus dem Wege zu gehen, wurde der sogenannten Altenteiler entwickelt, in dem
der Altbauer, noch in Verbindung mit dem Hof, seinen Lebensabend verbringen konnte.
Die ältesten als Altenteiler bezeichneten Gebäude stammen aus der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts. Es sind unterschiedliche Haustypen, die als Altenteiler Ver-
wendung fanden. In den Dörfern von Barsinghausen oder Seelze sind es vorrangig kleine
Vierständerbauten mit dem Raumgefüge eines Hallenhauses. Ein besonders gutes Beispiel
ist der Altenteiler in Landringhausen von 1838. Bei dem Wiederaufbau der durch einen
Brand in der Mitte des 19. Jh. vernichteten Hofstellen in Großburgwedel wurden vor dem
Haupthaus an der Straße quererschlossene Altenteiler erbaut. Häufig wurden aber auch
nur schon vorhandene Bauten wie Speicher, Ställe oder Scheunen für diesen Zweck
umgebaut.
40
Im gesamten Kreisgebiet sind fast hundert Backhäuser mit Denkmalqualität erhalten. Drei
Bauten sind sogar noch aus dem 16. Jh. datiert und sieben aus dem 17. Jh. Der Rest
verteilt sich auf die beiden folgenden Jahrhunderte. Neben den Backhäusern der Isernha-
gener Bauerschaften ist der Bestand in den Dörfern Lutter bei Neustadt am Rübenberge,
Obershagen bei Uetze und von Meitze in der Wedemark erwähnenswert. Der größte Teil
der Backhäuser wurde in der Ankerbalkenkonstruktion errichtet. Wegen der Feuergefahr,
die von den Backöfen ausging, erstellten die Bauern die kleinen Gebäude mit dem außen
angebauten Ofen abseits der mit Stroh gedeckten Hallenhäuser. Meist lagen sie in dem
zum Hof gehörenden Eichenbestand, dessen Blätterdach den gefährlichen Funkenflug
verringerte. Da der Ofen meist neben der Herdstelle des Haupthauses die einzige Feuer-
stelle der Hofanlage war, dienten die Backhäuser als Unterkunft für die Altenteiler, die
Häuslinge, Knechte oder Mägde.
Scheune
Die Scheunengebäude bilden die größte Gruppe der als Denkmal ausgewiesenen Neben-
gebäude. Die älteste datierte Scheune steht in Elze in der Wedemark. Sie stammt von
1648. Etwa zehn weitere Scheunen sind aus dem 17. Jh. von denkmalpflegerischem Wert.
Der Bestand aus dem 18. Jh. beträgt etwa siebzig. Der größte Teil wurde im 19. Jh.
errichtet, wobei die Scheunen in Ziegelbauweise aus der zweiten Hälfte des 19. Jh.
stammen. Auffallend in der Altersstruktur sind die Scheunen von Stöckendrebber, von
denen ein großer Teil aus der Zeit um 1700 erhalten ist.
Die Scheunengebäude sind dem Wirtschaftshof zugeordnet. Sie stehen vor dem Haupt-
haus giebel- oder traufständig an der Straße. Mit ihren Baukörpern, der Wandgliederung
und den Materialien prägen sie daher wesentlich das Bild der Ortschaften. Neben den
Merkmalen des konstruktiven Gefüges und der dekorativen Elemente, die bei den Scheu-
nen eine ähnliche Entwicklung genommen haben wie die der Hallenhäuser, ist die Erschlie-
ßungsrichtung der meist zweischiffigen Gebäude ein weiteres Unterscheidungskriterium.
Die mit dem Giebel zur Straße orientierten Scheunen sind meist sogenannte Längsdurch-
fahrtsscheunen, deren schmalerer Teil zur erdlastigen Lagerung von Stroh und Feldfrüch-
ten genutzt werden. Scheunen mit Querdurchfahrten stehen vorwiegend traufständig zur
Straße.
Stall und Wagenschauer
Diese beiden Nutzungstypen spielen in dem Denkmalbestand nur eine untergeordnete
Rolle. Die ältesten Stallgebäude stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jh. und sind meist
in Ziegel errichtet. Ein Grund für das späte Auftauchen dieser Nebengebäude ist sicher
darin zu finden, daß die für die Bauern so wertvollen Rinder und Pferde bis etwa 1850 im
Hallenhaus, in dem Aufsichtsbereich der bäuerlichen Familie, gehalten wurden. Auch
bestand keine Notwendigkeit, für die heute in der Landwirtschaft so wichtigen Schweine
Unterkünfte zu schaffen, da das Schwein, wie wir aus Darstellungen des Mittelalters wis-
sen, das ganze Jahr über draußen gehalten werden konnte und es wohl auch lange Zeit
nur eine untergeordnete Rolle in der Viehhaltung spielte. Durch den Holzraubbau des 16.
bis zum 18. Jh. waren die Eichenbaumbestände so sehr abgeholzt, daß die Schweinehude
in den Wäldern erheblich eingeschränkt wurde. Erst als die intensive Stallfütterung einge-
führt wurde, bestand für den Bauern die Notwendigkeit, Stallgebäude zu errichten.
Auch für den Bau der Wagenschauern bestand lange Jahre keine Notwendigkeit, da die
wenigen Fuhrwerke in der Diele des Haupthauses und den Durchfahrten der Scheunen
ausreichend Platz fanden. Erst mit dem wachsenden Futtermittelbedarf und dem für die
Aufstallung des Viehs notwendigen Strohs, nahm der Bestand an Fuhrwerken zu. Ab Mitte
des 19. Jh. kamen die ersten Ackergeräte auf, die vor den Witterungseinflüssen geschützt
werden mußten. Daher ist es verständlich, daß wir erst ab dieser Zeit den Nutzungstyp der
Wagenschauern gehäuft vorfinden. Eine Ausweisung dieser Nutzungstypen erfolgte vor-
wiegend als Bestandteil von Gruppen baulicher Anlagen einer Hofstelle.
Altenteiler
Im 19. Jh. ergab sich mit dem Anstieg der Lebenserwartung die Notwendigkeit, daß
zeitweise drei Generationen unter einem Dach lebten. Um aber der drangvollen Enge im
Haupthaus aus dem Wege zu gehen, wurde der sogenannten Altenteiler entwickelt, in dem
der Altbauer, noch in Verbindung mit dem Hof, seinen Lebensabend verbringen konnte.
Die ältesten als Altenteiler bezeichneten Gebäude stammen aus der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts. Es sind unterschiedliche Haustypen, die als Altenteiler Ver-
wendung fanden. In den Dörfern von Barsinghausen oder Seelze sind es vorrangig kleine
Vierständerbauten mit dem Raumgefüge eines Hallenhauses. Ein besonders gutes Beispiel
ist der Altenteiler in Landringhausen von 1838. Bei dem Wiederaufbau der durch einen
Brand in der Mitte des 19. Jh. vernichteten Hofstellen in Großburgwedel wurden vor dem
Haupthaus an der Straße quererschlossene Altenteiler erbaut. Häufig wurden aber auch
nur schon vorhandene Bauten wie Speicher, Ställe oder Scheunen für diesen Zweck
umgebaut.
40