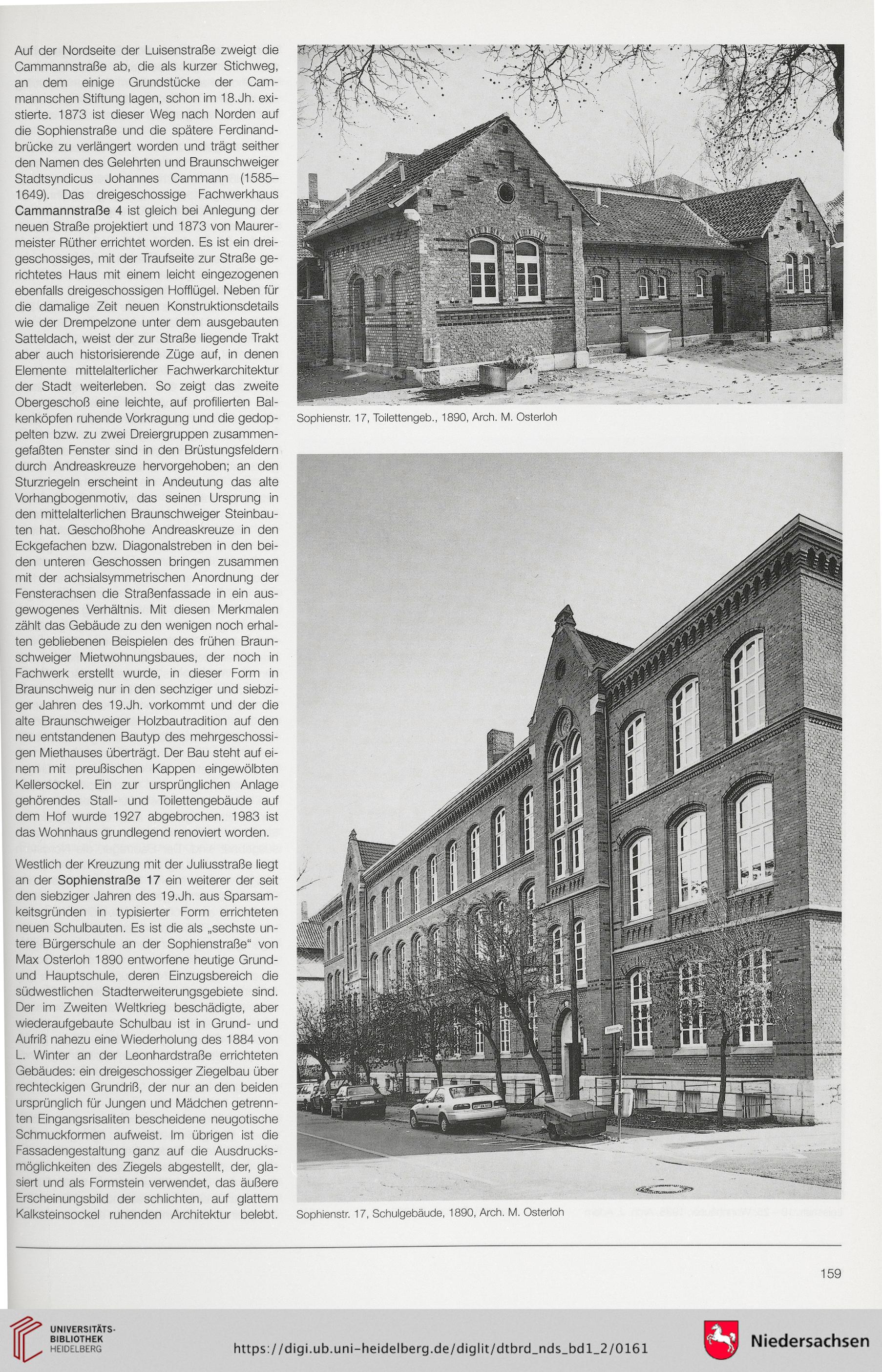Auf der Nordseite der Luisenstraße zweigt die
Cammannstraße ab, die als kurzer Stichweg,
an dem einige Grundstücke der Cam-
mannschen Stiftung lagen, schon im 18.Jh. exi-
stierte. 1873 ist dieser Weg nach Norden auf
die Sophienstraße und die spätere Ferdinand-
brücke zu verlängert worden und trägt seither
den Namen des Gelehrten und Braunschweiger
Stadtsyndicus Johannes Cammann (1585-
1649). Das dreigeschossige Fachwerkhaus
Cammannstraße 4 ist gleich bei Anlegung der
neuen Straße projektiert und 1873 von Maurer-
meister Rüther errichtet worden. Es ist ein drei-
geschossiges, mit der Traufseite zur Straße ge-
richtetes Haus mit einem leicht eingezogenen
ebenfalls dreigeschossigen Hofflügel. Neben für
die damalige Zeit neuen Konstruktionsdetails
wie der Drempelzone unter dem ausgebauten
Satteldach, weist der zur Straße liegende Trakt
aber auch historisierende Züge auf, in denen
Elemente mittelalterlicher Fachwerkarchitektur
der Stadt weiterleben. So zeigt das zweite
Obergeschoß eine leichte, auf profilierten Bal-
kenköpfen ruhende Vorkragung und die gedop-
pelten bzw. zu zwei Dreiergruppen zusammen-
gefaßten Fenster sind in den Brüstungsfeldern
durch Andreaskreuze hervorgehoben; an den
Sturzriegeln erscheint in Andeutung das alte
Vorhangbogenmotiv, das seinen Ursprung in
den mittelalterlichen Braunschweiger Steinbau-
ten hat. Geschoßhöhe Andreaskreuze in den
Eckgefachen bzw. Diagonalstreben in den bei-
den unteren Geschossen bringen zusammen
mit der achsialsymmetrischen Anordnung der
Fensterachsen die Straßenfassade in ein aus-
gewogenes Verhältnis. Mit diesen Merkmalen
zählt das Gebäude zu den wenigen noch erhal-
ten gebliebenen Beispielen des frühen Braun-
schweiger Mietwohnungsbaues, der noch in
Fachwerk erstellt wurde, in dieser Form in
Braunschweig nur in den sechziger und siebzi-
ger Jahren des 19.Jh. vorkommt und der die
alte Braunschweiger Holzbautradition auf den
neu entstandenen Bautyp des mehrgeschossi-
gen Miethauses überträgt. Der Bau steht auf ei-
nem mit preußischen Kappen eingewölbten
Kellersockel. Ein zur ursprünglichen Anlage
gehörendes Stall- und Toilettengebäude auf
dem Hof wurde 1927 abgebrochen. 1983 ist
das Wohnhaus grundlegend renoviert worden.
Westlich der Kreuzung mit der Juliusstraße liegt
an der Sophienstraße 17 ein weiterer der seit
den siebziger Jahren des 19.Jh. aus Sparsam-
keitsgründen in typisierter Form errichteten
neuen Schulbauten. Es ist die als „sechste un-
tere Bürgerschule an der Sophienstraße“ von
Max Osterloh 1890 entworfene heutige Grund-
und Hauptschule, deren Einzugsbereich die
südwestlichen Stadterweiterungsgebiete sind.
Der im Zweiten Weltkrieg beschädigte, aber
wiederaufgebaute Schulbau ist in Grund- und
Aufriß nahezu eine Wiederholung des 1884 von
L. Winter an der Leonhardstraße errichteten
Gebäudes: ein dreigeschossiger Ziegelbau über
rechteckigen Grundriß, der nur an den beiden
ursprünglich für Jungen und Mädchen getrenn-
ten Eingangsrisaliten bescheidene neugotische
Schmuckformen aufweist. Im übrigen ist die
Fassadengestaltung ganz auf die Ausdrucks-
möglichkeiten des Ziegels abgestellt, der, gla-
siert und als Formstein verwendet, das äußere
Erscheinungsbild der schlichten, auf glattem
Kalksteinsockel ruhenden Architektur belebt.
Sophienstr. 17, Toilettengeb., 1890, Arch. M. Osterloh
Sophienstr. 17, Schulgebäude, 1890, Arch. M. Osterloh
159
Cammannstraße ab, die als kurzer Stichweg,
an dem einige Grundstücke der Cam-
mannschen Stiftung lagen, schon im 18.Jh. exi-
stierte. 1873 ist dieser Weg nach Norden auf
die Sophienstraße und die spätere Ferdinand-
brücke zu verlängert worden und trägt seither
den Namen des Gelehrten und Braunschweiger
Stadtsyndicus Johannes Cammann (1585-
1649). Das dreigeschossige Fachwerkhaus
Cammannstraße 4 ist gleich bei Anlegung der
neuen Straße projektiert und 1873 von Maurer-
meister Rüther errichtet worden. Es ist ein drei-
geschossiges, mit der Traufseite zur Straße ge-
richtetes Haus mit einem leicht eingezogenen
ebenfalls dreigeschossigen Hofflügel. Neben für
die damalige Zeit neuen Konstruktionsdetails
wie der Drempelzone unter dem ausgebauten
Satteldach, weist der zur Straße liegende Trakt
aber auch historisierende Züge auf, in denen
Elemente mittelalterlicher Fachwerkarchitektur
der Stadt weiterleben. So zeigt das zweite
Obergeschoß eine leichte, auf profilierten Bal-
kenköpfen ruhende Vorkragung und die gedop-
pelten bzw. zu zwei Dreiergruppen zusammen-
gefaßten Fenster sind in den Brüstungsfeldern
durch Andreaskreuze hervorgehoben; an den
Sturzriegeln erscheint in Andeutung das alte
Vorhangbogenmotiv, das seinen Ursprung in
den mittelalterlichen Braunschweiger Steinbau-
ten hat. Geschoßhöhe Andreaskreuze in den
Eckgefachen bzw. Diagonalstreben in den bei-
den unteren Geschossen bringen zusammen
mit der achsialsymmetrischen Anordnung der
Fensterachsen die Straßenfassade in ein aus-
gewogenes Verhältnis. Mit diesen Merkmalen
zählt das Gebäude zu den wenigen noch erhal-
ten gebliebenen Beispielen des frühen Braun-
schweiger Mietwohnungsbaues, der noch in
Fachwerk erstellt wurde, in dieser Form in
Braunschweig nur in den sechziger und siebzi-
ger Jahren des 19.Jh. vorkommt und der die
alte Braunschweiger Holzbautradition auf den
neu entstandenen Bautyp des mehrgeschossi-
gen Miethauses überträgt. Der Bau steht auf ei-
nem mit preußischen Kappen eingewölbten
Kellersockel. Ein zur ursprünglichen Anlage
gehörendes Stall- und Toilettengebäude auf
dem Hof wurde 1927 abgebrochen. 1983 ist
das Wohnhaus grundlegend renoviert worden.
Westlich der Kreuzung mit der Juliusstraße liegt
an der Sophienstraße 17 ein weiterer der seit
den siebziger Jahren des 19.Jh. aus Sparsam-
keitsgründen in typisierter Form errichteten
neuen Schulbauten. Es ist die als „sechste un-
tere Bürgerschule an der Sophienstraße“ von
Max Osterloh 1890 entworfene heutige Grund-
und Hauptschule, deren Einzugsbereich die
südwestlichen Stadterweiterungsgebiete sind.
Der im Zweiten Weltkrieg beschädigte, aber
wiederaufgebaute Schulbau ist in Grund- und
Aufriß nahezu eine Wiederholung des 1884 von
L. Winter an der Leonhardstraße errichteten
Gebäudes: ein dreigeschossiger Ziegelbau über
rechteckigen Grundriß, der nur an den beiden
ursprünglich für Jungen und Mädchen getrenn-
ten Eingangsrisaliten bescheidene neugotische
Schmuckformen aufweist. Im übrigen ist die
Fassadengestaltung ganz auf die Ausdrucks-
möglichkeiten des Ziegels abgestellt, der, gla-
siert und als Formstein verwendet, das äußere
Erscheinungsbild der schlichten, auf glattem
Kalksteinsockel ruhenden Architektur belebt.
Sophienstr. 17, Toilettengeb., 1890, Arch. M. Osterloh
Sophienstr. 17, Schulgebäude, 1890, Arch. M. Osterloh
159