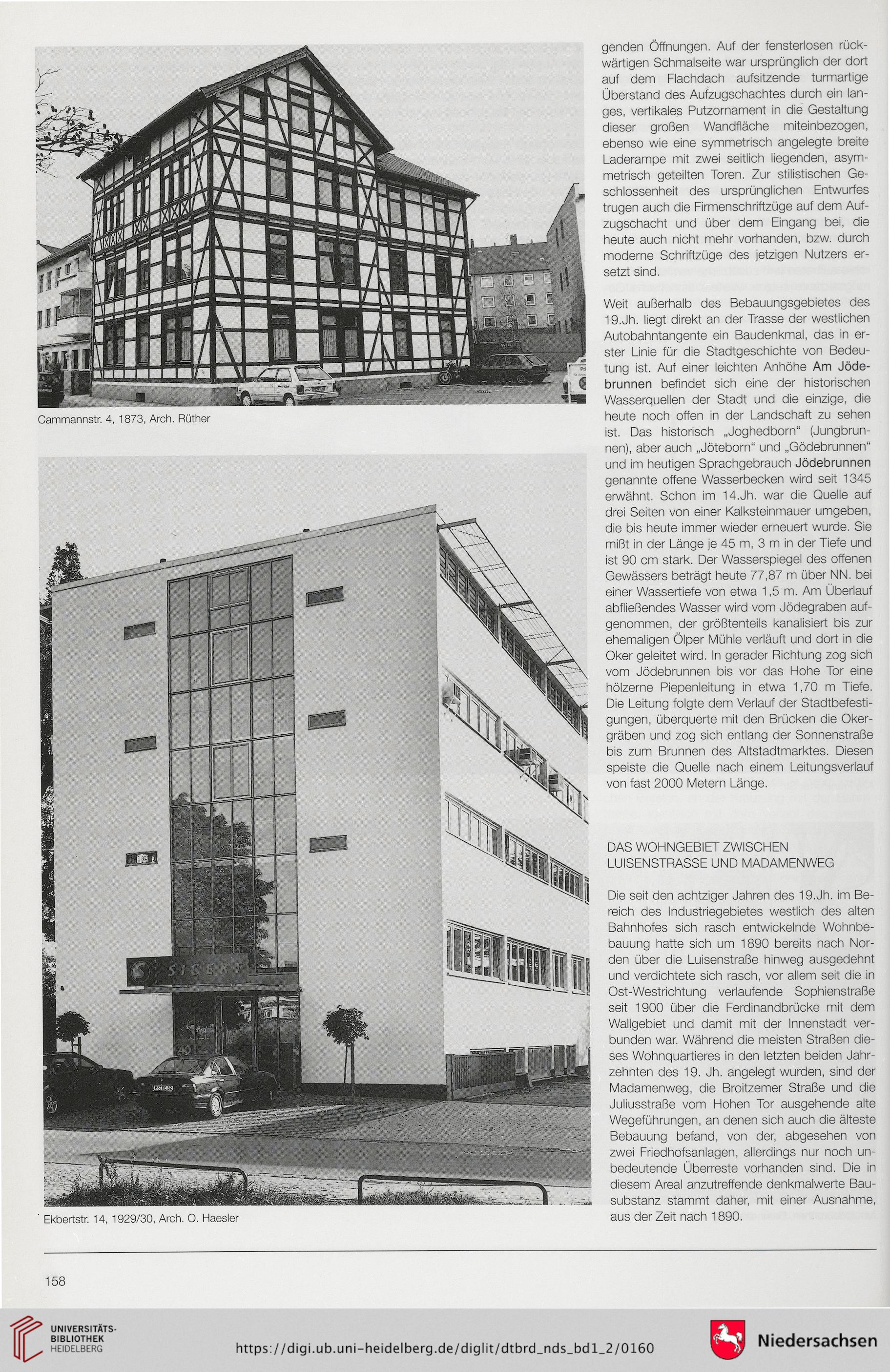Cammannstr. 4, 1873, Arch. Rüther
' Ekbertstr. 14, 1929/30, Arch. O. Haesler
genden Öffnungen. Auf der fensterlosen rück-
wärtigen Schmalseite war ursprünglich der dort
auf dem Flachdach aufsitzende turmartige
Überstand des Aufzugschachtes durch ein lan-
ges, vertikales Putzornament in die Gestaltung
dieser großen Wandfläche miteinbezogen,
ebenso wie eine symmetrisch angelegte breite
Laderampe mit zwei seitlich liegenden, asym-
metrisch geteilten Toren. Zur stilistischen Ge-
schlossenheit des ursprünglichen Entwurfes
trugen auch die Firmenschriftzüge auf dem Auf-
zugschacht und über dem Eingang bei, die
heute auch nicht mehr vorhanden, bzw. durch
moderne Schriftzüge des jetzigen Nutzers er-
setzt sind.
Weit außerhalb des Bebauungsgebietes des
19.Jh. liegt direkt an der Trasse der westlichen
Autobahntangente ein Baudenkmal, das in er-
ster Linie für die Stadtgeschichte von Bedeu-
tung ist. Auf einer leichten Anhöhe Am Jöde-
brunnen befindet sich eine der historischen
Wasserquellen der Stadt und die einzige, die
heute noch offen in der Landschaft zu sehen
ist. Das historisch „Joghedborn“ (Jungbrun-
nen), aber auch „Jöteborn“ und „Gödebrunnen“
und im heutigen Sprachgebrauch Jödebrunnen
genannte offene Wasserbecken wird seit 1345
erwähnt. Schon im 14.Jh. war die Quelle auf
drei Seiten von einer Kalksteinmauer umgeben,
die bis heute immer wieder erneuert wurde. Sie
mißt in der Länge je 45 m, 3 m in der Tiefe und
ist 90 cm stark. Der Wasserspiegel des offenen
Gewässers beträgt heute 77,87 m über NN. bei
einer Wassertiefe von etwa 1,5 m. Am Überlauf
abfließendes Wasser wird vom Jödegraben auf-
genommen, der größtenteils kanalisiert bis zur
ehemaligen Ölper Mühle verläuft und dort in die
Oker geleitet wird. In gerader Richtung zog sich
vom Jödebrunnen bis vor das Hohe Tor eine
hölzerne Piepenleitung in etwa 1,70 m Tiefe.
Die Leitung folgte dem Verlauf der Stadtbefesti-
gungen, überquerte mit den Brücken die Oker-
gräben und zog sich entlang der Sonnenstraße
bis zum Brunnen des Altstadtmarktes. Diesen
speiste die Quelle nach einem Leitungsverlauf
von fast 2000 Metern Länge.
DAS WOHNGEBIET ZWISCHEN
LUISENSTRASSE UND MADAMENWEG
Die seit den achtziger Jahren des 19.Jh. im Be-
reich des Industriegebietes westlich des alten
Bahnhofes sich rasch entwickelnde Wohnbe-
bauung hatte sich um 1890 bereits nach Nor-
den über die Luisenstraße hinweg ausgedehnt
und verdichtete sich rasch, vor allem seit die in
Ost-Westrichtung verlaufende Sophienstraße
seit 1900 über die Ferdinandbrücke mit dem
Wallgebiet und damit mit der Innenstadt ver-
bunden war. Während die meisten Straßen die-
ses Wohnquartieres in den letzten beiden Jahr-
zehnten des 19. Jh. angelegt wurden, sind der
Madamenweg, die Broitzemer Straße und die
Juliusstraße vom Hohen Tor ausgehende alte
Wegeführungen, an denen sich auch die älteste
Bebauung befand, von der, abgesehen von
zwei Friedhofsanlagen, allerdings nur noch un-
bedeutende Überreste vorhanden sind. Die in
diesem Areal anzutreffende denkmalwerte Bau-
substanz stammt daher, mit einer Ausnahme,
aus der Zeit nach 1890.
158
' Ekbertstr. 14, 1929/30, Arch. O. Haesler
genden Öffnungen. Auf der fensterlosen rück-
wärtigen Schmalseite war ursprünglich der dort
auf dem Flachdach aufsitzende turmartige
Überstand des Aufzugschachtes durch ein lan-
ges, vertikales Putzornament in die Gestaltung
dieser großen Wandfläche miteinbezogen,
ebenso wie eine symmetrisch angelegte breite
Laderampe mit zwei seitlich liegenden, asym-
metrisch geteilten Toren. Zur stilistischen Ge-
schlossenheit des ursprünglichen Entwurfes
trugen auch die Firmenschriftzüge auf dem Auf-
zugschacht und über dem Eingang bei, die
heute auch nicht mehr vorhanden, bzw. durch
moderne Schriftzüge des jetzigen Nutzers er-
setzt sind.
Weit außerhalb des Bebauungsgebietes des
19.Jh. liegt direkt an der Trasse der westlichen
Autobahntangente ein Baudenkmal, das in er-
ster Linie für die Stadtgeschichte von Bedeu-
tung ist. Auf einer leichten Anhöhe Am Jöde-
brunnen befindet sich eine der historischen
Wasserquellen der Stadt und die einzige, die
heute noch offen in der Landschaft zu sehen
ist. Das historisch „Joghedborn“ (Jungbrun-
nen), aber auch „Jöteborn“ und „Gödebrunnen“
und im heutigen Sprachgebrauch Jödebrunnen
genannte offene Wasserbecken wird seit 1345
erwähnt. Schon im 14.Jh. war die Quelle auf
drei Seiten von einer Kalksteinmauer umgeben,
die bis heute immer wieder erneuert wurde. Sie
mißt in der Länge je 45 m, 3 m in der Tiefe und
ist 90 cm stark. Der Wasserspiegel des offenen
Gewässers beträgt heute 77,87 m über NN. bei
einer Wassertiefe von etwa 1,5 m. Am Überlauf
abfließendes Wasser wird vom Jödegraben auf-
genommen, der größtenteils kanalisiert bis zur
ehemaligen Ölper Mühle verläuft und dort in die
Oker geleitet wird. In gerader Richtung zog sich
vom Jödebrunnen bis vor das Hohe Tor eine
hölzerne Piepenleitung in etwa 1,70 m Tiefe.
Die Leitung folgte dem Verlauf der Stadtbefesti-
gungen, überquerte mit den Brücken die Oker-
gräben und zog sich entlang der Sonnenstraße
bis zum Brunnen des Altstadtmarktes. Diesen
speiste die Quelle nach einem Leitungsverlauf
von fast 2000 Metern Länge.
DAS WOHNGEBIET ZWISCHEN
LUISENSTRASSE UND MADAMENWEG
Die seit den achtziger Jahren des 19.Jh. im Be-
reich des Industriegebietes westlich des alten
Bahnhofes sich rasch entwickelnde Wohnbe-
bauung hatte sich um 1890 bereits nach Nor-
den über die Luisenstraße hinweg ausgedehnt
und verdichtete sich rasch, vor allem seit die in
Ost-Westrichtung verlaufende Sophienstraße
seit 1900 über die Ferdinandbrücke mit dem
Wallgebiet und damit mit der Innenstadt ver-
bunden war. Während die meisten Straßen die-
ses Wohnquartieres in den letzten beiden Jahr-
zehnten des 19. Jh. angelegt wurden, sind der
Madamenweg, die Broitzemer Straße und die
Juliusstraße vom Hohen Tor ausgehende alte
Wegeführungen, an denen sich auch die älteste
Bebauung befand, von der, abgesehen von
zwei Friedhofsanlagen, allerdings nur noch un-
bedeutende Überreste vorhanden sind. Die in
diesem Areal anzutreffende denkmalwerte Bau-
substanz stammt daher, mit einer Ausnahme,
aus der Zeit nach 1890.
158