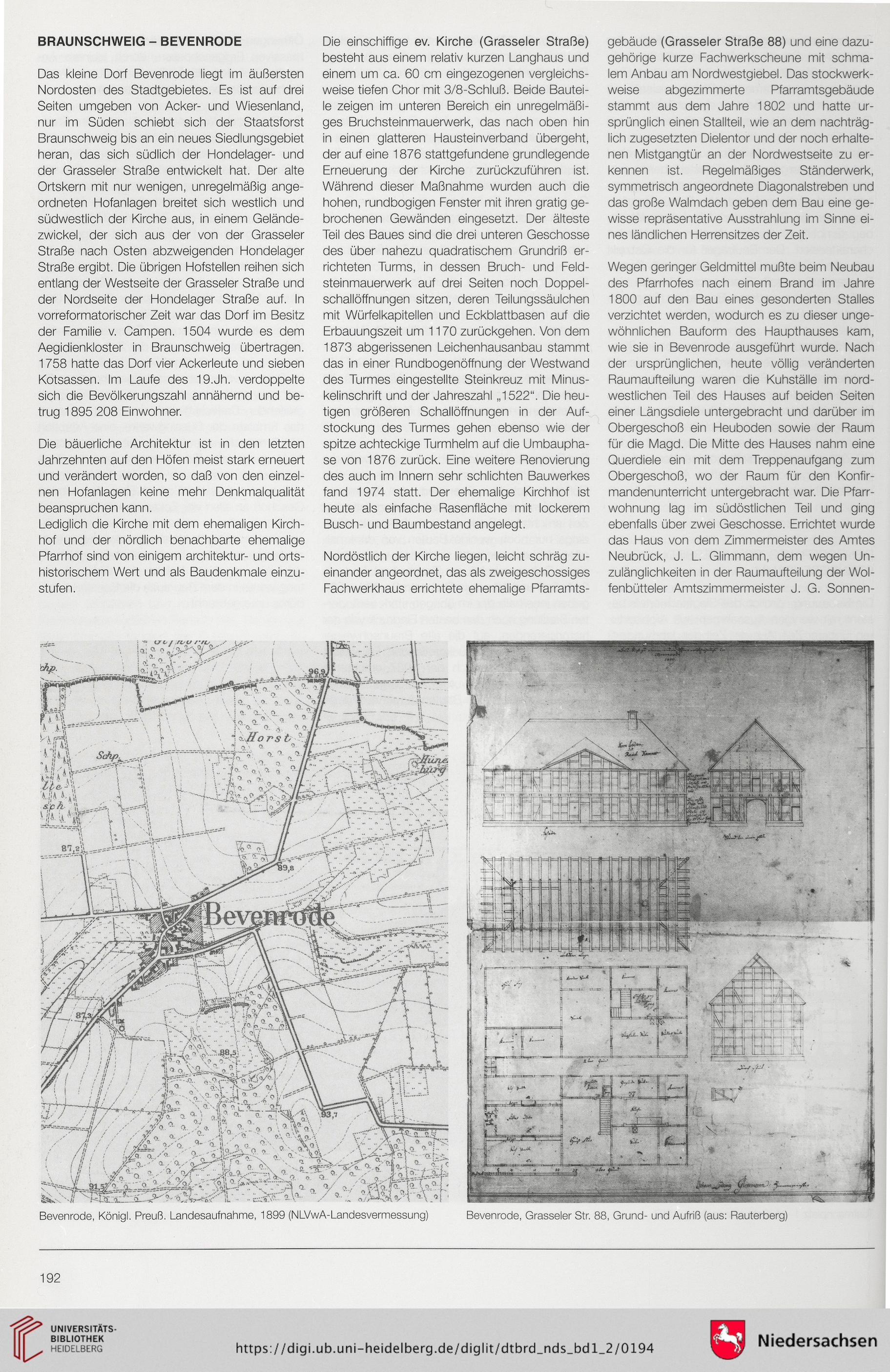BRAUNSCHWEIG - BEVENRODE
Das kleine Dorf Bevenrode liegt im äußersten
Nordosten des Stadtgebietes. Es ist auf drei
Seiten umgeben von Acker- und Wiesenland,
nur im Süden schiebt sich der Staatsforst
Braunschweig bis an ein neues Siedlungsgebiet
heran, das sich südlich der Hondelager- und
der Grasseler Straße entwickelt hat. Der alte
Ortskern mit nur wenigen, unregelmäßig ange-
ordneten Hofanlagen breitet sich westlich und
südwestlich der Kirche aus, in einem Gelände-
zwickel, der sich aus der von der Grasseler
Straße nach Osten abzweigenden Hondelager
Straße ergibt. Die übrigen Hofstellen reihen sich
entlang der Westseite der Grasseler Straße und
der Nordseite der Hondelager Straße auf. In
vorreformatorischer Zeit war das Dorf im Besitz
der Familie v. Campen. 1504 wurde es dem
Aegidienkloster in Braunschweig übertragen.
1758 hatte das Dorf vier Ackerleute und sieben
Kotsassen. Im Laufe des 19.Jh. verdoppelte
sich die Bevölkerungszahl annähernd und be-
trug 1895 208 Einwohner.
Die bäuerliche Architektur ist in den letzten
Jahrzehnten auf den Höfen meist stark erneuert
und verändert worden, so daß von den einzel-
nen Hofanlagen keine mehr Denkmalqualität
beanspruchen kann.
Lediglich die Kirche mit dem ehemaligen Kirch-
hof und der nördlich benachbarte ehemalige
Pfarrhof sind von einigem architektur- und orts-
historischem Wert und als Baudenkmale einzu-
stufen.
Die einschiffige ev. Kirche (Grasseler Straße)
besteht aus einem relativ kurzen Langhaus und
einem um ca. 60 cm eingezogenen vergleichs-
weise tiefen Chor mit 3/8-Schluß. Beide Bautei-
le zeigen im unteren Bereich ein unregelmäßi-
ges Bruchsteinmauerwerk, das nach oben hin
in einen glatteren Hausteinverband übergeht,
der auf eine 1876 stattgefundene grundlegende
Erneuerung der Kirche zurückzuführen ist.
Während dieser Maßnahme wurden auch die
hohen, rundbogigen Fenster mit ihren grätig ge-
brochenen Gewänden eingesetzt. Der älteste
Teil des Baues sind die drei unteren Geschosse
des über nahezu quadratischem Grundriß er-
richteten Turms, in dessen Bruch- und Feld-
steinmauerwerk auf drei Seiten noch Doppel-
schallöffnungen sitzen, deren Teilungssäulchen
mit Würfelkapitellen und Eckblattbasen auf die
Erbauungszeit um 1170 zurückgehen. Von dem
1873 abgerissenen Leichenhausanbau stammt
das in einer Rundbogenöffnung der Westwand
des Turmes eingestellte Steinkreuz mit Minus-
kelinschrift und der Jahreszahl „1522“. Die heu-
tigen größeren Schallöffnungen in der Auf-
stockung des Turmes gehen ebenso wie der
spitze achteckige Turmhelm auf die Umbaupha-
se von 1876 zurück. Eine weitere Renovierung
des auch im Innern sehr schlichten Bauwerkes
fand 1974 statt. Der ehemalige Kirchhof ist
heute als einfache Rasenfläche mit lockerem
Busch- und Baumbestand angelegt.
Nordöstlich der Kirche liegen, leicht schräg zu-
einander angeordnet, das als zweigeschossiges
Fachwerkhaus errichtete ehemalige Pfarramts-
gebäude (Grasseler Straße 88) und eine dazu-
gehörige kurze Fachwerkscheune mit schma-
lem Anbau am Nordwestgiebel. Das stockwerk-
weise abgezimmerte Pfarramtsgebäude
stammt aus dem Jahre 1802 und hatte ur-
sprünglich einen Stallteil, wie an dem nachträg-
lich zugesetzten Dielentor und der noch erhalte-
nen Mistgangtür an der Nordwestseite zu er-
kennen ist. Regelmäßiges Ständerwerk,
symmetrisch angeordnete Diagonalstreben und
das große Walmdach geben dem Bau eine ge-
wisse repräsentative Ausstrahlung im Sinne ei-
nes ländlichen Herrensitzes der Zeit.
Wegen geringer Geldmittel mußte beim Neubau
des Pfarrhofes nach einem Brand im Jahre
1800 auf den Bau eines gesonderten Stalles
verzichtet werden, wodurch es zu dieser unge-
wöhnlichen Bauform des Haupthauses kam,
wie sie in Bevenrode ausgeführt wurde. Nach
der ursprünglichen, heute völlig veränderten
Raumaufteilung waren die Kuhställe im nord-
westlichen Teil des Hauses auf beiden Seiten
einer Längsdiele untergebracht und darüber im
Obergeschoß ein Heuboden sowie der Raum
für die Magd. Die Mitte des Hauses nahm eine
Querdiele ein mit dem Treppenaufgang zum
Obergeschoß, wo der Raum für den Konfir-
mandenunterricht untergebracht war. Die Pfarr-
wohnung lag im südöstlichen Teil und ging
ebenfalls über zwei Geschosse. Errichtet wurde
das Haus von dem Zimmermeister des Amtes
Neubrück, J. L. Glimmann, dem wegen Un-
zulänglichkeiten in der Raumaufteilung der Wol-
fenbütteler Amtszimmermeister J. G. Sonnen-
Bevenrode, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1899 (NLVwA-Landesvermessung)
Bevenrode, Grasseler Str. 88, Grund- und Aufriß (aus: Rauterberg)
192
Das kleine Dorf Bevenrode liegt im äußersten
Nordosten des Stadtgebietes. Es ist auf drei
Seiten umgeben von Acker- und Wiesenland,
nur im Süden schiebt sich der Staatsforst
Braunschweig bis an ein neues Siedlungsgebiet
heran, das sich südlich der Hondelager- und
der Grasseler Straße entwickelt hat. Der alte
Ortskern mit nur wenigen, unregelmäßig ange-
ordneten Hofanlagen breitet sich westlich und
südwestlich der Kirche aus, in einem Gelände-
zwickel, der sich aus der von der Grasseler
Straße nach Osten abzweigenden Hondelager
Straße ergibt. Die übrigen Hofstellen reihen sich
entlang der Westseite der Grasseler Straße und
der Nordseite der Hondelager Straße auf. In
vorreformatorischer Zeit war das Dorf im Besitz
der Familie v. Campen. 1504 wurde es dem
Aegidienkloster in Braunschweig übertragen.
1758 hatte das Dorf vier Ackerleute und sieben
Kotsassen. Im Laufe des 19.Jh. verdoppelte
sich die Bevölkerungszahl annähernd und be-
trug 1895 208 Einwohner.
Die bäuerliche Architektur ist in den letzten
Jahrzehnten auf den Höfen meist stark erneuert
und verändert worden, so daß von den einzel-
nen Hofanlagen keine mehr Denkmalqualität
beanspruchen kann.
Lediglich die Kirche mit dem ehemaligen Kirch-
hof und der nördlich benachbarte ehemalige
Pfarrhof sind von einigem architektur- und orts-
historischem Wert und als Baudenkmale einzu-
stufen.
Die einschiffige ev. Kirche (Grasseler Straße)
besteht aus einem relativ kurzen Langhaus und
einem um ca. 60 cm eingezogenen vergleichs-
weise tiefen Chor mit 3/8-Schluß. Beide Bautei-
le zeigen im unteren Bereich ein unregelmäßi-
ges Bruchsteinmauerwerk, das nach oben hin
in einen glatteren Hausteinverband übergeht,
der auf eine 1876 stattgefundene grundlegende
Erneuerung der Kirche zurückzuführen ist.
Während dieser Maßnahme wurden auch die
hohen, rundbogigen Fenster mit ihren grätig ge-
brochenen Gewänden eingesetzt. Der älteste
Teil des Baues sind die drei unteren Geschosse
des über nahezu quadratischem Grundriß er-
richteten Turms, in dessen Bruch- und Feld-
steinmauerwerk auf drei Seiten noch Doppel-
schallöffnungen sitzen, deren Teilungssäulchen
mit Würfelkapitellen und Eckblattbasen auf die
Erbauungszeit um 1170 zurückgehen. Von dem
1873 abgerissenen Leichenhausanbau stammt
das in einer Rundbogenöffnung der Westwand
des Turmes eingestellte Steinkreuz mit Minus-
kelinschrift und der Jahreszahl „1522“. Die heu-
tigen größeren Schallöffnungen in der Auf-
stockung des Turmes gehen ebenso wie der
spitze achteckige Turmhelm auf die Umbaupha-
se von 1876 zurück. Eine weitere Renovierung
des auch im Innern sehr schlichten Bauwerkes
fand 1974 statt. Der ehemalige Kirchhof ist
heute als einfache Rasenfläche mit lockerem
Busch- und Baumbestand angelegt.
Nordöstlich der Kirche liegen, leicht schräg zu-
einander angeordnet, das als zweigeschossiges
Fachwerkhaus errichtete ehemalige Pfarramts-
gebäude (Grasseler Straße 88) und eine dazu-
gehörige kurze Fachwerkscheune mit schma-
lem Anbau am Nordwestgiebel. Das stockwerk-
weise abgezimmerte Pfarramtsgebäude
stammt aus dem Jahre 1802 und hatte ur-
sprünglich einen Stallteil, wie an dem nachträg-
lich zugesetzten Dielentor und der noch erhalte-
nen Mistgangtür an der Nordwestseite zu er-
kennen ist. Regelmäßiges Ständerwerk,
symmetrisch angeordnete Diagonalstreben und
das große Walmdach geben dem Bau eine ge-
wisse repräsentative Ausstrahlung im Sinne ei-
nes ländlichen Herrensitzes der Zeit.
Wegen geringer Geldmittel mußte beim Neubau
des Pfarrhofes nach einem Brand im Jahre
1800 auf den Bau eines gesonderten Stalles
verzichtet werden, wodurch es zu dieser unge-
wöhnlichen Bauform des Haupthauses kam,
wie sie in Bevenrode ausgeführt wurde. Nach
der ursprünglichen, heute völlig veränderten
Raumaufteilung waren die Kuhställe im nord-
westlichen Teil des Hauses auf beiden Seiten
einer Längsdiele untergebracht und darüber im
Obergeschoß ein Heuboden sowie der Raum
für die Magd. Die Mitte des Hauses nahm eine
Querdiele ein mit dem Treppenaufgang zum
Obergeschoß, wo der Raum für den Konfir-
mandenunterricht untergebracht war. Die Pfarr-
wohnung lag im südöstlichen Teil und ging
ebenfalls über zwei Geschosse. Errichtet wurde
das Haus von dem Zimmermeister des Amtes
Neubrück, J. L. Glimmann, dem wegen Un-
zulänglichkeiten in der Raumaufteilung der Wol-
fenbütteler Amtszimmermeister J. G. Sonnen-
Bevenrode, Königl. Preuß. Landesaufnahme, 1899 (NLVwA-Landesvermessung)
Bevenrode, Grasseler Str. 88, Grund- und Aufriß (aus: Rauterberg)
192