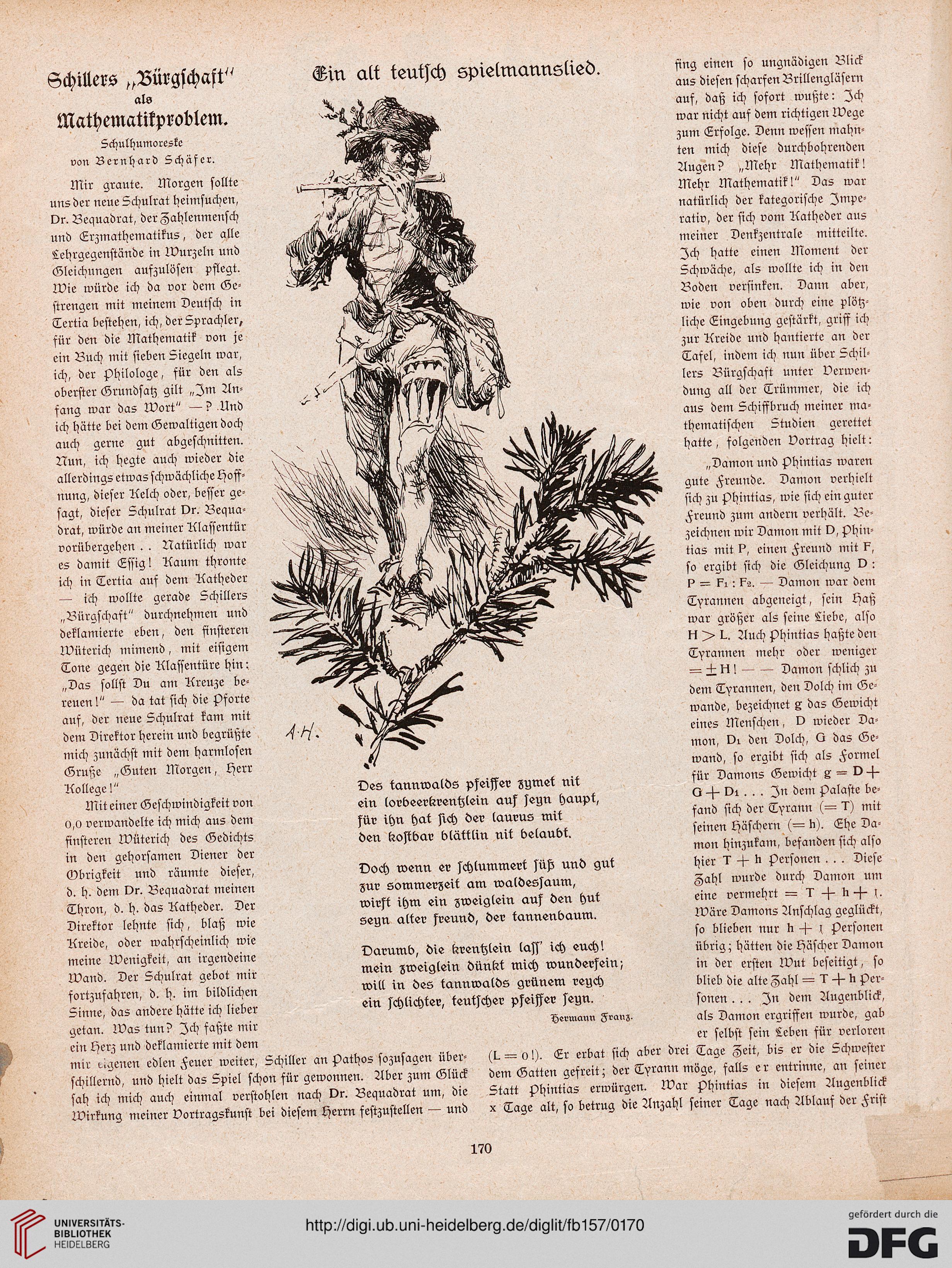Schillers „Bürgschaft"
als
Mathematikproblem.
Schulhumoreske
von Bernhard Schäfer.
Mir graute. Morgen sollte
uns der neue Schulrat heimsuchen,
Or. Bequadrat, der Zahlenmensch
und Erzmathematikus, der alle
Lehrgegenstände in Wurzeln und
Gleichungen aufzulösen pflegt.
Wie würde ich da vor dem Ge-
strengen mit meinem Deutsch in
Tertia bestehen, ich, derSprachler,
für den die Mathematik von je
ein Buch mit sieben Siegeln war,
ich, der Philologe, für den als
oberster Grundsatz gilt „Im An-
fang mar das Wort" — ? Und
ich hätte bei dem Gewaltigen doch
auch gerne gut abgeschnitten.
Nun, ich hegte auch wieder die
allerdings etwas schwächliche fjoff*
nung, dieser Kelch oder, besser ge-
sagt, dieser Schulrat Or. Bequa-
drat, würde an meiner Klassentür
vorübergehen. . Natürlich mar
es damit Essig I Kaum thronte
ich in Tertia auf dem Katheder
— ich wollte gerade Schillers
„Bürgschaft" durchnehmen und
deklamierte eben, den finsteren
Wüterich mimend, mit eisigem
Tone gegen die Klassentüre hin:
„Das sollst Du am Kreuze be-
reuen!" — da tat sich die Pforte
auf, der neue Schulrat kam mit
dem Direktor herein und begrüßte
mich zunächst mit dem harmlosen
Gruße „Guten Morgen, tserr
Kollege!"
Mit einer Geschwindigkeit von
0,0 verwandelte ich mich ans dem
finsteren Wüterich des Gedichts
in den gehorsamen Diener der
(Obrigkeit und räumte dieser,
d. h. dem Or. Bequadrat nieinen
Thron, d. h. das Katheder. Der
Direktor lehnte sich, blaß wie
Kreide, oder wahrscheinlich wie
meine Wenigkeit, an irgendeine
Wand. Der Schulrat gebot mir
fortzufahren, d. h. im bildlichen
Sinne, das andere hätte ich lieber
getan. Was tun? Ich faßte mir
ein lherz und deklamierte mit dem
mir eigenen edlen Feuer weiter, Schiller an Pathos sozusagen über-
schillernd, und hielt das Spiel schon für gewonnen. Aber zum Glück
sah ich mich auch einmal verstohlen nach Or. Bequadrat uni, die
Wirkung nieiner Oortragskunst bei diesem kserrn festzustollen — und
fing einen so ungnädigen Blick
aus diesen scharfen Brillengläsern
auf, daß ich sofort mußte: Ich
war nicht auf dem richtigen Wege
zum Erfolge. Denn wessen mahn-
ten mich diese durchbohrenden
Augen? „Mehr Mathematik!
Mehr Mathematik I" Das war
natürlich der kategorische Inipe-
rativ, der sich vom Katheder aus
meiner Denkzentrale mitteilte.
Ich hatte einen Moment der
Schwäche, als wollte ich in den
Boden versinken. Dann aber,
wie von oben durch eine plötz-
liche Eingebung gestärkt, griff ich
zur Kreide und hantierte an der
Tafel, indem ich nun über Schil-
lers Bürgschaft unter Oerwen-
dung all der Trümmer, die ich
aus dem Schiffbruch meiner ma-
thematischen Studien gerettet
hatte, folgenden Oortrag hielt:
„Dämon und phintias waren
gute freunde. Dämon verhielt
sich zu phintias, wie sich ein guter
freund zum andern verhält. Be-
zeichnen wir Dämon mit O, Phin-
tias mit P, einen Freund mit F,
so ergibt sich die Gleichung O:
P = Fi: F2. — Dämon war dem
Tyrannen abgeneigt, sein Fsaß
war größer als seine Liebe, also
Fl >- L. Auch Phintias haßte den
Tyrannen mehr oder weniger
— + H ! - Dämon schlich zu
dem Tyrannen, den Dolch im Ge-
wände, bezeichnet § das Gewicht
eines Menschen, O wieder Dä-
mon, Or den Dolch, O das Ge-
wand, so ergibt sich als Formel
für Danions Gewicht L—O-P
O —|- Di . . . In dem Palaste be-
fand sich der Tyrann (— T) mit
seinen Näschern (— h). Ehe Dä-
mon hinzukam, befanden sich also
hier T + h Personen. . . Diese
Zahl wurde durch Dämon um
eine vermehrt — T -)- h -f- (.
Wäre Dämons Anschlag geglückt,
so blieben nur b -j- ; Personen
übrig; hätten die Näscher Dämon
in der ersten Wut beseitigt, so
blieb die alte Zahl — T -f- h Per-
sonen ... In dem Augenblick,
als Dämon ergriffen wurde, gab
er selbst sein Leben für verloren
(L = o!). Er erbat sich aber drei Tage Zeit, bis er die Schwester
dem Gatten gefreit; der Tyrann möge, falls er entrinne, an seiner
Statt Phintias erwürgen. War phintias in diesen: Augenblick
x Tage alt, so betrug die Anzahl seiner Tage nach Ablauf der Frist
Gin alt teutsch spielmannslied.
Des tannwalds pfeifet zgmet nit
ein lorbeerkrentzlein auf fetjn Haupt,
für ihn hat sich der lantns mit
den lrosibar blätttin nit belaubt.
Doch wenn er schlummert snsi und gut
zur Sommerzeit am Waldessaum,
wirst ihm ein zweig lein ans den Hut
segn alter freund, der tannenbanm.
Oarnmb, die lrrentzlein lass ich euch!
mein zweiglein dnnkrt mich wnndersein;
will in des tannwalds grünem regch
ein schlichter, tentscher pfeifet fetjn.
Hermann Franz.
170
als
Mathematikproblem.
Schulhumoreske
von Bernhard Schäfer.
Mir graute. Morgen sollte
uns der neue Schulrat heimsuchen,
Or. Bequadrat, der Zahlenmensch
und Erzmathematikus, der alle
Lehrgegenstände in Wurzeln und
Gleichungen aufzulösen pflegt.
Wie würde ich da vor dem Ge-
strengen mit meinem Deutsch in
Tertia bestehen, ich, derSprachler,
für den die Mathematik von je
ein Buch mit sieben Siegeln war,
ich, der Philologe, für den als
oberster Grundsatz gilt „Im An-
fang mar das Wort" — ? Und
ich hätte bei dem Gewaltigen doch
auch gerne gut abgeschnitten.
Nun, ich hegte auch wieder die
allerdings etwas schwächliche fjoff*
nung, dieser Kelch oder, besser ge-
sagt, dieser Schulrat Or. Bequa-
drat, würde an meiner Klassentür
vorübergehen. . Natürlich mar
es damit Essig I Kaum thronte
ich in Tertia auf dem Katheder
— ich wollte gerade Schillers
„Bürgschaft" durchnehmen und
deklamierte eben, den finsteren
Wüterich mimend, mit eisigem
Tone gegen die Klassentüre hin:
„Das sollst Du am Kreuze be-
reuen!" — da tat sich die Pforte
auf, der neue Schulrat kam mit
dem Direktor herein und begrüßte
mich zunächst mit dem harmlosen
Gruße „Guten Morgen, tserr
Kollege!"
Mit einer Geschwindigkeit von
0,0 verwandelte ich mich ans dem
finsteren Wüterich des Gedichts
in den gehorsamen Diener der
(Obrigkeit und räumte dieser,
d. h. dem Or. Bequadrat nieinen
Thron, d. h. das Katheder. Der
Direktor lehnte sich, blaß wie
Kreide, oder wahrscheinlich wie
meine Wenigkeit, an irgendeine
Wand. Der Schulrat gebot mir
fortzufahren, d. h. im bildlichen
Sinne, das andere hätte ich lieber
getan. Was tun? Ich faßte mir
ein lherz und deklamierte mit dem
mir eigenen edlen Feuer weiter, Schiller an Pathos sozusagen über-
schillernd, und hielt das Spiel schon für gewonnen. Aber zum Glück
sah ich mich auch einmal verstohlen nach Or. Bequadrat uni, die
Wirkung nieiner Oortragskunst bei diesem kserrn festzustollen — und
fing einen so ungnädigen Blick
aus diesen scharfen Brillengläsern
auf, daß ich sofort mußte: Ich
war nicht auf dem richtigen Wege
zum Erfolge. Denn wessen mahn-
ten mich diese durchbohrenden
Augen? „Mehr Mathematik!
Mehr Mathematik I" Das war
natürlich der kategorische Inipe-
rativ, der sich vom Katheder aus
meiner Denkzentrale mitteilte.
Ich hatte einen Moment der
Schwäche, als wollte ich in den
Boden versinken. Dann aber,
wie von oben durch eine plötz-
liche Eingebung gestärkt, griff ich
zur Kreide und hantierte an der
Tafel, indem ich nun über Schil-
lers Bürgschaft unter Oerwen-
dung all der Trümmer, die ich
aus dem Schiffbruch meiner ma-
thematischen Studien gerettet
hatte, folgenden Oortrag hielt:
„Dämon und phintias waren
gute freunde. Dämon verhielt
sich zu phintias, wie sich ein guter
freund zum andern verhält. Be-
zeichnen wir Dämon mit O, Phin-
tias mit P, einen Freund mit F,
so ergibt sich die Gleichung O:
P = Fi: F2. — Dämon war dem
Tyrannen abgeneigt, sein Fsaß
war größer als seine Liebe, also
Fl >- L. Auch Phintias haßte den
Tyrannen mehr oder weniger
— + H ! - Dämon schlich zu
dem Tyrannen, den Dolch im Ge-
wände, bezeichnet § das Gewicht
eines Menschen, O wieder Dä-
mon, Or den Dolch, O das Ge-
wand, so ergibt sich als Formel
für Danions Gewicht L—O-P
O —|- Di . . . In dem Palaste be-
fand sich der Tyrann (— T) mit
seinen Näschern (— h). Ehe Dä-
mon hinzukam, befanden sich also
hier T + h Personen. . . Diese
Zahl wurde durch Dämon um
eine vermehrt — T -)- h -f- (.
Wäre Dämons Anschlag geglückt,
so blieben nur b -j- ; Personen
übrig; hätten die Näscher Dämon
in der ersten Wut beseitigt, so
blieb die alte Zahl — T -f- h Per-
sonen ... In dem Augenblick,
als Dämon ergriffen wurde, gab
er selbst sein Leben für verloren
(L = o!). Er erbat sich aber drei Tage Zeit, bis er die Schwester
dem Gatten gefreit; der Tyrann möge, falls er entrinne, an seiner
Statt Phintias erwürgen. War phintias in diesen: Augenblick
x Tage alt, so betrug die Anzahl seiner Tage nach Ablauf der Frist
Gin alt teutsch spielmannslied.
Des tannwalds pfeifet zgmet nit
ein lorbeerkrentzlein auf fetjn Haupt,
für ihn hat sich der lantns mit
den lrosibar blätttin nit belaubt.
Doch wenn er schlummert snsi und gut
zur Sommerzeit am Waldessaum,
wirst ihm ein zweig lein ans den Hut
segn alter freund, der tannenbanm.
Oarnmb, die lrrentzlein lass ich euch!
mein zweiglein dnnkrt mich wnndersein;
will in des tannwalds grünem regch
ein schlichter, tentscher pfeifet fetjn.
Hermann Franz.
170
Werk/Gegenstand/Objekt
Pool: UB Fliegende Blätter
Titel
Titel/Objekt
"Ein alt teutsch Spielmannslied"
Weitere Titel/Paralleltitel
Serientitel
Fliegende Blätter
Sachbegriff/Objekttyp
Inschrift/Wasserzeichen
Aufbewahrung/Standort
Aufbewahrungsort/Standort (GND)
Inv. Nr./Signatur
G 5442-2 Folio RES
Objektbeschreibung
Maß-/Formatangaben
Auflage/Druckzustand
Werktitel/Werkverzeichnis
Herstellung/Entstehung
Entstehungsdatum
um 1922
Entstehungsdatum (normiert)
1917 - 1927
Entstehungsort (GND)
Auftrag
Publikation
Fund/Ausgrabung
Provenienz
Restaurierung
Sammlung Eingang
Ausstellung
Bearbeitung/Umgestaltung
Thema/Bildinhalt
Thema/Bildinhalt (GND)
Literaturangabe
Rechte am Objekt
Aufnahmen/Reproduktionen
Künstler/Urheber (GND)
Reproduktionstyp
Digitales Bild
Rechtsstatus
In Copyright (InC) / Urheberrechtsschutz
Creditline
Fliegende Blätter, 157.1922, Nr. 4035, S. 170
Beziehungen
Erschließung
Lizenz
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Rechteinhaber
Universitätsbibliothek Heidelberg