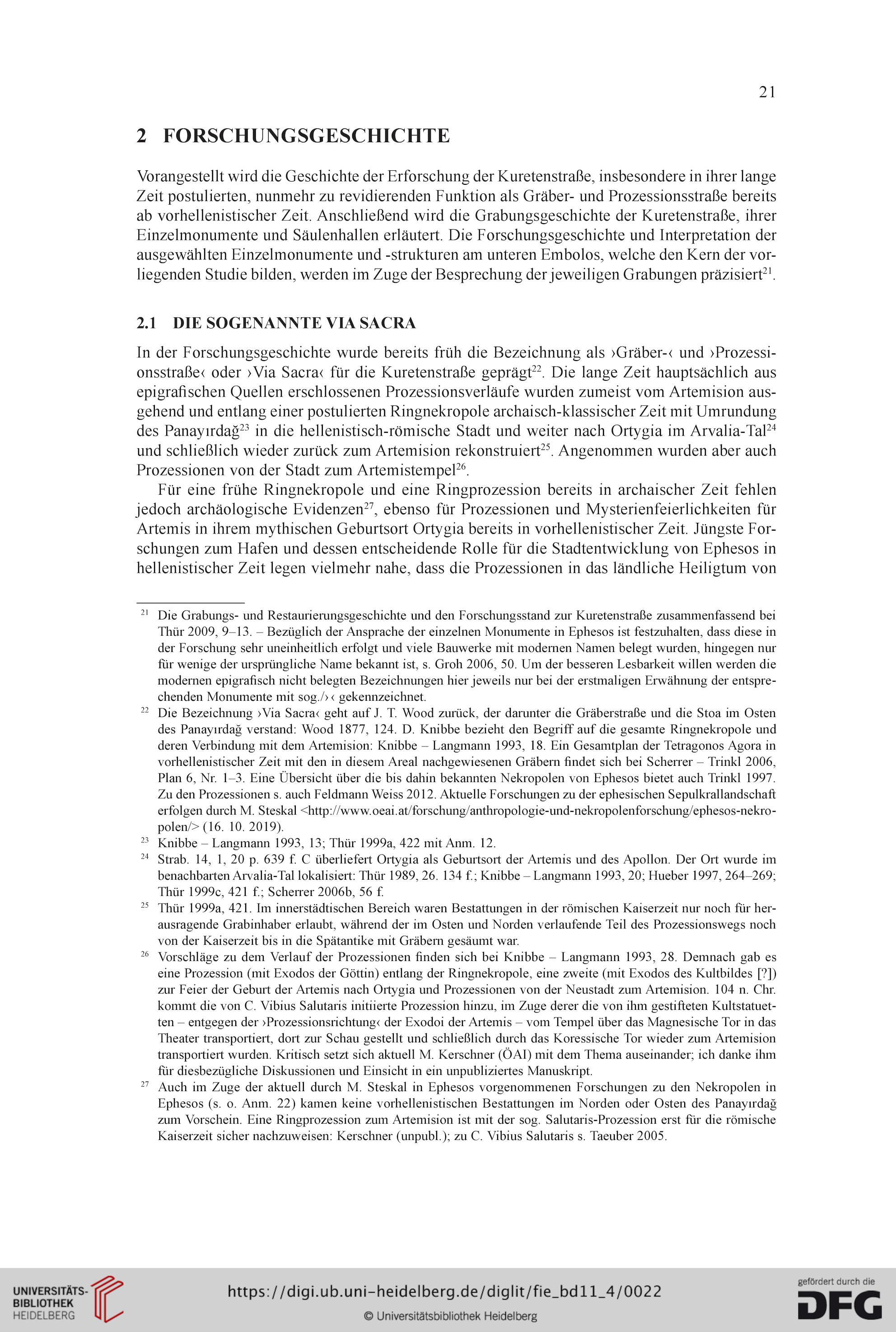21
2 FORSCHUNGSGESCHICHTE
Vorangestellt wird die Geschichte der Erforschung der Kuretenstraße, insbesondere in ihrer lange
Zeit postulierten, nunmehr zu revidierenden Funktion als Gräber- und Prozessionsstraße bereits
ab vorhellenistischer Zeit. Anschließend wird die Grabungsgeschichte der Kuretenstraße, ihrer
Einzelmonumente und Säulenhallen erläutert. Die Forschungsgeschichte und Interpretation der
ausgewählten Einzelmonumente und -Strukturen am unteren Embolos, welche den Kern der vor-
liegenden Studie bilden, werden im Zuge der Besprechung der jeweiligen Grabungen präzisiert21.
2.1 DIE SOGENANNTE VIA SACRA
In der Forschungsgeschichte wurde bereits früh die Bezeichnung als >Gräber-< und >Prozessi-
onsstraße< oder >Via Sacra< für die Kuretenstraße geprägt22. Die lange Zeit hauptsächlich aus
epigrafischen Quellen erschlossenen Prozessionsverläufe wurden zumeist vom Artemision aus-
gehend und entlang einer postulierten Ringnekropole archaisch-klassischer Zeit mit Umrundung
des Panayirdag23 in die hellenistisch-römische Stadt und weiter nach Ortygia im Arvalia-Tal24
und schließlich wieder zurück zum Artemision rekonstruiert25. Angenommen wurden aber auch
Prozessionen von der Stadt zum Artemistempel26.
Für eine frühe Ringnekropole und eine Ringprozession bereits in archaischer Zeit fehlen
jedoch archäologische Evidenzen27, ebenso für Prozessionen und Mysterienfeierlichkeiten für
Artemis in ihrem mythischen Geburtsort Ortygia bereits in vorhellenistischer Zeit. Jüngste For-
schungen zum Hafen und dessen entscheidende Rolle für die Stadtentwicklung von Ephesos in
hellenistischer Zeit legen vielmehr nahe, dass die Prozessionen in das ländliche Heiligtum von
21 Die Grabungs- und Restaurierungsgeschichte und den Forschungsstand zur Kuretenstraße zusammenfassend bei
Thür 2009, 9-13. - Bezüglich der Ansprache der einzelnen Monumente in Ephesos ist festzuhalten, dass diese in
der Forschung sehr uneinheitlich erfolgt und viele Bauwerke mit modernen Namen belegt wurden, hingegen nur
für wenige der ursprüngliche Name bekannt ist, s. Groh 2006, 50. Um der besseren Lesbarkeit willen werden die
modernen epigrafisch nicht belegten Bezeichnungen hier jeweils nur bei der erstmaligen Erwähnung der entspre-
chenden Monumente mit sog./x gekennzeichnet.
22 Die Bezeichnung >Via Sacra< geht auf J. T. Wood zurück, der darunter die Gräberstraße und die Stoa im Osten
des Panayirdag verstand: Wood 1877, 124. D. Knibbe bezieht den Begriff auf die gesamte Ringnekropole und
deren Verbindung mit dem Artemision: Knibbe - Langmann 1993, 18. Ein Gesamtplan der Tetragonos Agora in
vorhellenistischer Zeit mit den in diesem Areal nachgewiesenen Gräbern findet sich bei Scherrer - Trinkl 2006,
Plan 6, Nr. 1-3. Eine Übersicht über die bis dahin bekannten Nekropolen von Ephesos bietet auch Trinkl 1997.
Zu den Prozessionen s. auch Feldmann Weiss 2012. Aktuelle Forschungen zu der ephesischen Sepulkrallandschaft
erfolgen durch M. Steskal <http://www.oeai.at/forschung/antliropologie-und-nekropolenforschung/ephesos-nekro-
polen/> (16. 10. 2019).
23 Knibbe - Langmann 1993, 13; Thür 1999a, 422 mit Anm. 12.
24 Strab. 14, 1, 20 p. 639 f. C überliefert Ortygia als Geburtsort der Artemis und des Apollon. Der Ort wurde im
benachbarten Arvalia-Tal lokalisiert: Uiür 1989, 26. 134 f; Knibbe - Langmann 1993, 20; Hueber 1997, 264-269;
Uiür 1999c, 421 f; Scherrer 2006b, 56 f.
25 Uiür 1999a, 421. Im innerstädtischen Bereich waren Bestattungen in der römischen Kaiserzeit nur noch für her-
ausragende Grabinhaber erlaubt, während der im Osten und Norden verlaufende Teil des Prozessionswegs noch
von der Kaiserzeit bis in die Spätantike mit Gräbern gesäumt war.
26 Vorschläge zu dem Verlauf der Prozessionen finden sich bei Knibbe - Langmann 1993, 28. Demnach gab es
eine Prozession (mit Exodos der Göttin) entlang der Ringnekropole, eine zweite (mit Exodos des Kultbildes [?])
zur Feier der Geburt der Artemis nach Ortygia und Prozessionen von der Neustadt zum Artemision. 104 n. Clir.
kommt die von C. Vibius Salutaris initiierte Prozession hinzu, im Zuge derer die von ihm gestifteten Kultstatuet-
ten - entgegen der >Prozessionsrichtung< der Exodoi der Artemis - vom Tempel über das Magnesische Tor in das
Uieater transportiert, dort zur Schau gestellt und schließlich durch das Koressische Tor wieder zum Artemision
transportiert wurden. Kritisch setzt sich aktuell M. Kerscliner (ÖAI) mit dem Thema auseinander; ich danke ihm
für diesbezügliche Diskussionen und Einsicht in ein unpubliziertes Manuskript.
27 Auch im Zuge der aktuell durch M. Steskal in Ephesos vorgenommenen Forschungen zu den Nekropolen in
Ephesos (s. o. Anm. 22) kamen keine vorhellenistischen Bestattungen im Norden oder Osten des Panayirdag
zum Vorschein. Eine Ringprozession zum Artemision ist mit der sog. Salutaris-Prozession erst für die römische
Kaiserzeit sicher nachzuweisen: Kerscliner (unpubl.); zu C. Vibius Salutaris s. Taeuber 2005.
2 FORSCHUNGSGESCHICHTE
Vorangestellt wird die Geschichte der Erforschung der Kuretenstraße, insbesondere in ihrer lange
Zeit postulierten, nunmehr zu revidierenden Funktion als Gräber- und Prozessionsstraße bereits
ab vorhellenistischer Zeit. Anschließend wird die Grabungsgeschichte der Kuretenstraße, ihrer
Einzelmonumente und Säulenhallen erläutert. Die Forschungsgeschichte und Interpretation der
ausgewählten Einzelmonumente und -Strukturen am unteren Embolos, welche den Kern der vor-
liegenden Studie bilden, werden im Zuge der Besprechung der jeweiligen Grabungen präzisiert21.
2.1 DIE SOGENANNTE VIA SACRA
In der Forschungsgeschichte wurde bereits früh die Bezeichnung als >Gräber-< und >Prozessi-
onsstraße< oder >Via Sacra< für die Kuretenstraße geprägt22. Die lange Zeit hauptsächlich aus
epigrafischen Quellen erschlossenen Prozessionsverläufe wurden zumeist vom Artemision aus-
gehend und entlang einer postulierten Ringnekropole archaisch-klassischer Zeit mit Umrundung
des Panayirdag23 in die hellenistisch-römische Stadt und weiter nach Ortygia im Arvalia-Tal24
und schließlich wieder zurück zum Artemision rekonstruiert25. Angenommen wurden aber auch
Prozessionen von der Stadt zum Artemistempel26.
Für eine frühe Ringnekropole und eine Ringprozession bereits in archaischer Zeit fehlen
jedoch archäologische Evidenzen27, ebenso für Prozessionen und Mysterienfeierlichkeiten für
Artemis in ihrem mythischen Geburtsort Ortygia bereits in vorhellenistischer Zeit. Jüngste For-
schungen zum Hafen und dessen entscheidende Rolle für die Stadtentwicklung von Ephesos in
hellenistischer Zeit legen vielmehr nahe, dass die Prozessionen in das ländliche Heiligtum von
21 Die Grabungs- und Restaurierungsgeschichte und den Forschungsstand zur Kuretenstraße zusammenfassend bei
Thür 2009, 9-13. - Bezüglich der Ansprache der einzelnen Monumente in Ephesos ist festzuhalten, dass diese in
der Forschung sehr uneinheitlich erfolgt und viele Bauwerke mit modernen Namen belegt wurden, hingegen nur
für wenige der ursprüngliche Name bekannt ist, s. Groh 2006, 50. Um der besseren Lesbarkeit willen werden die
modernen epigrafisch nicht belegten Bezeichnungen hier jeweils nur bei der erstmaligen Erwähnung der entspre-
chenden Monumente mit sog./x gekennzeichnet.
22 Die Bezeichnung >Via Sacra< geht auf J. T. Wood zurück, der darunter die Gräberstraße und die Stoa im Osten
des Panayirdag verstand: Wood 1877, 124. D. Knibbe bezieht den Begriff auf die gesamte Ringnekropole und
deren Verbindung mit dem Artemision: Knibbe - Langmann 1993, 18. Ein Gesamtplan der Tetragonos Agora in
vorhellenistischer Zeit mit den in diesem Areal nachgewiesenen Gräbern findet sich bei Scherrer - Trinkl 2006,
Plan 6, Nr. 1-3. Eine Übersicht über die bis dahin bekannten Nekropolen von Ephesos bietet auch Trinkl 1997.
Zu den Prozessionen s. auch Feldmann Weiss 2012. Aktuelle Forschungen zu der ephesischen Sepulkrallandschaft
erfolgen durch M. Steskal <http://www.oeai.at/forschung/antliropologie-und-nekropolenforschung/ephesos-nekro-
polen/> (16. 10. 2019).
23 Knibbe - Langmann 1993, 13; Thür 1999a, 422 mit Anm. 12.
24 Strab. 14, 1, 20 p. 639 f. C überliefert Ortygia als Geburtsort der Artemis und des Apollon. Der Ort wurde im
benachbarten Arvalia-Tal lokalisiert: Uiür 1989, 26. 134 f; Knibbe - Langmann 1993, 20; Hueber 1997, 264-269;
Uiür 1999c, 421 f; Scherrer 2006b, 56 f.
25 Uiür 1999a, 421. Im innerstädtischen Bereich waren Bestattungen in der römischen Kaiserzeit nur noch für her-
ausragende Grabinhaber erlaubt, während der im Osten und Norden verlaufende Teil des Prozessionswegs noch
von der Kaiserzeit bis in die Spätantike mit Gräbern gesäumt war.
26 Vorschläge zu dem Verlauf der Prozessionen finden sich bei Knibbe - Langmann 1993, 28. Demnach gab es
eine Prozession (mit Exodos der Göttin) entlang der Ringnekropole, eine zweite (mit Exodos des Kultbildes [?])
zur Feier der Geburt der Artemis nach Ortygia und Prozessionen von der Neustadt zum Artemision. 104 n. Clir.
kommt die von C. Vibius Salutaris initiierte Prozession hinzu, im Zuge derer die von ihm gestifteten Kultstatuet-
ten - entgegen der >Prozessionsrichtung< der Exodoi der Artemis - vom Tempel über das Magnesische Tor in das
Uieater transportiert, dort zur Schau gestellt und schließlich durch das Koressische Tor wieder zum Artemision
transportiert wurden. Kritisch setzt sich aktuell M. Kerscliner (ÖAI) mit dem Thema auseinander; ich danke ihm
für diesbezügliche Diskussionen und Einsicht in ein unpubliziertes Manuskript.
27 Auch im Zuge der aktuell durch M. Steskal in Ephesos vorgenommenen Forschungen zu den Nekropolen in
Ephesos (s. o. Anm. 22) kamen keine vorhellenistischen Bestattungen im Norden oder Osten des Panayirdag
zum Vorschein. Eine Ringprozession zum Artemision ist mit der sog. Salutaris-Prozession erst für die römische
Kaiserzeit sicher nachzuweisen: Kerscliner (unpubl.); zu C. Vibius Salutaris s. Taeuber 2005.