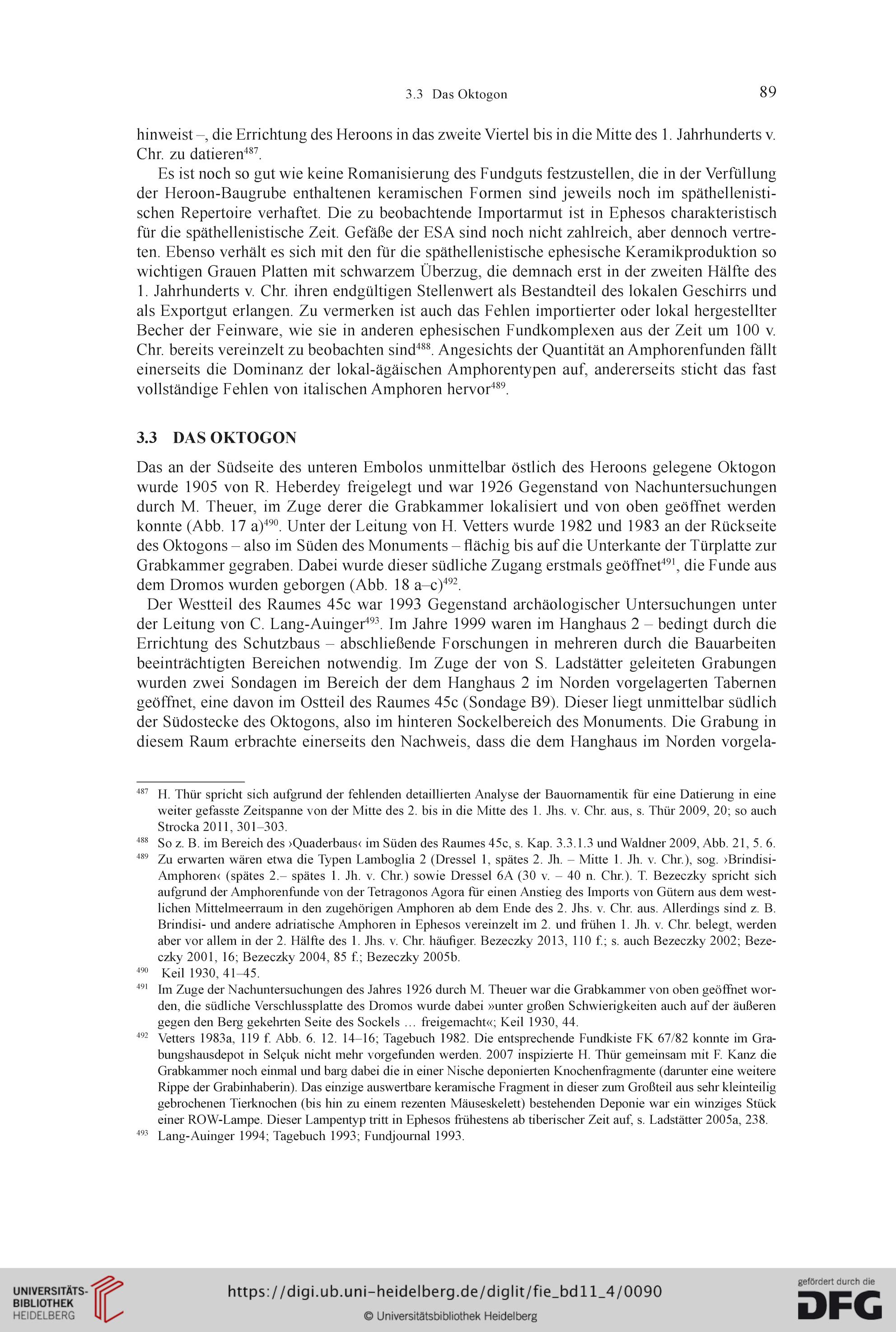3.3 Das Oktogon
89
hinweist die Errichtung des Heroons in das zweite Viertel bis in die Mitte des 1. Jahrhunderts v.
Chr. zu datieren487.
Es ist noch so gut wie keine Romanisierung des Fundguts festzustellen, die in der Verfüllung
der Heroon-Baugrube enthaltenen keramischen Formen sind jeweils noch im späthellenisti-
schen Repertoire verhaftet. Die zu beobachtende Importarmut ist in Ephesos charakteristisch
für die späthellenistische Zeit. Gefäße der ESA sind noch nicht zahlreich, aber dennoch vertre-
ten. Ebenso verhält es sich mit den für die späthellenistische ephesische Keramikproduktion so
wichtigen Grauen Platten mit schwarzem Überzug, die demnach erst in der zweiten Hälfte des
1. Jahrhunderts v. Chr. ihren endgültigen Stellenwert als Bestandteil des lokalen Geschirrs und
als Exportgut erlangen. Zu vermerken ist auch das Fehlen importierter oder lokal hergestellter
Becher der Feinware, wie sie in anderen ephesischen Fundkomplexen aus der Zeit um 100 v.
Chr. bereits vereinzelt zu beobachten sind488. Angesichts der Quantität an Amphorenfunden fällt
einerseits die Dominanz der lokal-ägäischen Amphorentypen auf, andererseits sticht das fast
vollständige Fehlen von italischen Amphoren hervor489.
3.3 DAS OKTOGON
Das an der Südseite des unteren Embolos unmittelbar östlich des Heroons gelegene Oktogon
wurde 1905 von R. Heberdey freigelegt und war 1926 Gegenstand von Nachuntersuchungen
durch M. Theuer, im Zuge derer die Grabkammer lokalisiert und von oben geöffnet werden
konnte (Abb. 17 a)490. Unter der Leitung von H. Vetters wurde 1982 und 1983 an der Rückseite
des Oktogons - also im Süden des Monuments - flächig bis auf die Unterkante der Türplatte zur
Grabkammer gegraben. Dabei wurde dieser südliche Zugang erstmals geöffnet491, die Funde aus
dem Dromos wurden geborgen (Abb. 18 a-c)492.
Der Westteil des Raumes 45c war 1993 Gegenstand archäologischer Untersuchungen unter
der Leitung von C. Lang-Auinger493. Im Jahre 1999 waren im Hanghaus 2 - bedingt durch die
Errichtung des Schutzbaus - abschließende Forschungen in mehreren durch die Bauarbeiten
beeinträchtigten Bereichen notwendig. Im Zuge der von S. Ladstätter geleiteten Grabungen
wurden zwei Sondagen im Bereich der dem Hanghaus 2 im Norden vorgelagerten Tabernen
geöffnet, eine davon im Ostteil des Raumes 45c (Sondage B9). Dieser liegt unmittelbar südlich
der Südostecke des Oktogons, also im hinteren Sockelbereich des Monuments. Die Grabung in
diesem Raum erbrachte einerseits den Nachweis, dass die dem Hanghaus im Norden vorgela-
487 H. Thür spricht sich aufgrund der fehlenden detaillierten Analyse der Bauomamentik für eine Datierung in eine
weiter gefasste Zeitspanne von der Mitte des 2. bis in die Mitte des 1. Jhs. v. Chr. aus, s. Thür 2009, 20; so auch
Strocka 2011, 301-303.
488 So z. B. im Bereich des >Quaderbaus< im Süden des Raumes 45c, s. Kap. 3.3.1.3 und Waldner 2009, Abb. 21, 5. 6.
489 Zu erwarten wären etwa die Typen Lamboglia 2 (Dressel 1, spätes 2. Jli. - Mitte 1. Jh. v. Chr.), sog. >Brindisi-
Amphorem (spätes 2.- spätes 1. Jh. v. Chr.) sowie Dressel 6A (30 v. - 40 n. Chr.). T. Bezeczky spricht sich
aufgrund der Amphorenfunde von der Tetragonos Agora für einen Anstieg des Imports von Gütern aus dem west-
lichen Mittelmeerraum in den zugehörigen Amphoren ab dem Ende des 2. Jhs. v. Chr. aus. Allerdings sind z. B.
Brindisi- und andere adriatische Amphoren in Ephesos vereinzelt im 2. und frühen 1. Jh. v. Chr. belegt, werden
aber vor allem in der 2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. häufiger. Bezeczky 2013, 110 f; s. auch Bezeczky 2002; Beze-
czky 2001, 16; Bezeczky 2004, 85 f; Bezeczky 2005b.
490 Keil 1930, 41-45.
491 Im Zuge der Nachuntersuchungen des Jahres 1926 durch M. Theuer war die Grabkammer von oben geöffnet wor-
den, die südliche Verschlussplatte des Dromos wurde dabei »unter großen Schwierigkeiten auch auf der äußeren
gegen den Berg gekehrten Seite des Sockels ... freigemacht«; Keil 1930, 44.
492 Vetters 1983a, 119 f. Abb. 6. 12. 14-16; Tagebuch 1982. Die entsprechende Fundkiste FK 67/82 konnte im Gra-
bungshausdepot in Selfuk nicht mehr vorgefunden werden. 2007 inspizierte H. Thür gemeinsam mit F. Kanz die
Grabkammer noch einmal und barg dabei die in einer Nische deponierten Knochenfragmente (darunter eine weitere
Rippe der Grabinhaberin). Das einzige auswertbare keramische Fragment in dieser zum Großteil aus sehr kleinteilig
gebrochenen Tierknochen (bis hin zu einem rezenten Mäuseskelett) bestehenden Deponie war ein winziges Stück
einer ROW-Lampe. Dieser Lampentyp tritt in Ephesos frühestens ab tiberischer Zeit auf, s. Ladstätter 2005a, 238.
493 Lang-Auinger 1994; Tagebuch 1993; Fundjoumal 1993.
89
hinweist die Errichtung des Heroons in das zweite Viertel bis in die Mitte des 1. Jahrhunderts v.
Chr. zu datieren487.
Es ist noch so gut wie keine Romanisierung des Fundguts festzustellen, die in der Verfüllung
der Heroon-Baugrube enthaltenen keramischen Formen sind jeweils noch im späthellenisti-
schen Repertoire verhaftet. Die zu beobachtende Importarmut ist in Ephesos charakteristisch
für die späthellenistische Zeit. Gefäße der ESA sind noch nicht zahlreich, aber dennoch vertre-
ten. Ebenso verhält es sich mit den für die späthellenistische ephesische Keramikproduktion so
wichtigen Grauen Platten mit schwarzem Überzug, die demnach erst in der zweiten Hälfte des
1. Jahrhunderts v. Chr. ihren endgültigen Stellenwert als Bestandteil des lokalen Geschirrs und
als Exportgut erlangen. Zu vermerken ist auch das Fehlen importierter oder lokal hergestellter
Becher der Feinware, wie sie in anderen ephesischen Fundkomplexen aus der Zeit um 100 v.
Chr. bereits vereinzelt zu beobachten sind488. Angesichts der Quantität an Amphorenfunden fällt
einerseits die Dominanz der lokal-ägäischen Amphorentypen auf, andererseits sticht das fast
vollständige Fehlen von italischen Amphoren hervor489.
3.3 DAS OKTOGON
Das an der Südseite des unteren Embolos unmittelbar östlich des Heroons gelegene Oktogon
wurde 1905 von R. Heberdey freigelegt und war 1926 Gegenstand von Nachuntersuchungen
durch M. Theuer, im Zuge derer die Grabkammer lokalisiert und von oben geöffnet werden
konnte (Abb. 17 a)490. Unter der Leitung von H. Vetters wurde 1982 und 1983 an der Rückseite
des Oktogons - also im Süden des Monuments - flächig bis auf die Unterkante der Türplatte zur
Grabkammer gegraben. Dabei wurde dieser südliche Zugang erstmals geöffnet491, die Funde aus
dem Dromos wurden geborgen (Abb. 18 a-c)492.
Der Westteil des Raumes 45c war 1993 Gegenstand archäologischer Untersuchungen unter
der Leitung von C. Lang-Auinger493. Im Jahre 1999 waren im Hanghaus 2 - bedingt durch die
Errichtung des Schutzbaus - abschließende Forschungen in mehreren durch die Bauarbeiten
beeinträchtigten Bereichen notwendig. Im Zuge der von S. Ladstätter geleiteten Grabungen
wurden zwei Sondagen im Bereich der dem Hanghaus 2 im Norden vorgelagerten Tabernen
geöffnet, eine davon im Ostteil des Raumes 45c (Sondage B9). Dieser liegt unmittelbar südlich
der Südostecke des Oktogons, also im hinteren Sockelbereich des Monuments. Die Grabung in
diesem Raum erbrachte einerseits den Nachweis, dass die dem Hanghaus im Norden vorgela-
487 H. Thür spricht sich aufgrund der fehlenden detaillierten Analyse der Bauomamentik für eine Datierung in eine
weiter gefasste Zeitspanne von der Mitte des 2. bis in die Mitte des 1. Jhs. v. Chr. aus, s. Thür 2009, 20; so auch
Strocka 2011, 301-303.
488 So z. B. im Bereich des >Quaderbaus< im Süden des Raumes 45c, s. Kap. 3.3.1.3 und Waldner 2009, Abb. 21, 5. 6.
489 Zu erwarten wären etwa die Typen Lamboglia 2 (Dressel 1, spätes 2. Jli. - Mitte 1. Jh. v. Chr.), sog. >Brindisi-
Amphorem (spätes 2.- spätes 1. Jh. v. Chr.) sowie Dressel 6A (30 v. - 40 n. Chr.). T. Bezeczky spricht sich
aufgrund der Amphorenfunde von der Tetragonos Agora für einen Anstieg des Imports von Gütern aus dem west-
lichen Mittelmeerraum in den zugehörigen Amphoren ab dem Ende des 2. Jhs. v. Chr. aus. Allerdings sind z. B.
Brindisi- und andere adriatische Amphoren in Ephesos vereinzelt im 2. und frühen 1. Jh. v. Chr. belegt, werden
aber vor allem in der 2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. häufiger. Bezeczky 2013, 110 f; s. auch Bezeczky 2002; Beze-
czky 2001, 16; Bezeczky 2004, 85 f; Bezeczky 2005b.
490 Keil 1930, 41-45.
491 Im Zuge der Nachuntersuchungen des Jahres 1926 durch M. Theuer war die Grabkammer von oben geöffnet wor-
den, die südliche Verschlussplatte des Dromos wurde dabei »unter großen Schwierigkeiten auch auf der äußeren
gegen den Berg gekehrten Seite des Sockels ... freigemacht«; Keil 1930, 44.
492 Vetters 1983a, 119 f. Abb. 6. 12. 14-16; Tagebuch 1982. Die entsprechende Fundkiste FK 67/82 konnte im Gra-
bungshausdepot in Selfuk nicht mehr vorgefunden werden. 2007 inspizierte H. Thür gemeinsam mit F. Kanz die
Grabkammer noch einmal und barg dabei die in einer Nische deponierten Knochenfragmente (darunter eine weitere
Rippe der Grabinhaberin). Das einzige auswertbare keramische Fragment in dieser zum Großteil aus sehr kleinteilig
gebrochenen Tierknochen (bis hin zu einem rezenten Mäuseskelett) bestehenden Deponie war ein winziges Stück
einer ROW-Lampe. Dieser Lampentyp tritt in Ephesos frühestens ab tiberischer Zeit auf, s. Ladstätter 2005a, 238.
493 Lang-Auinger 1994; Tagebuch 1993; Fundjoumal 1993.