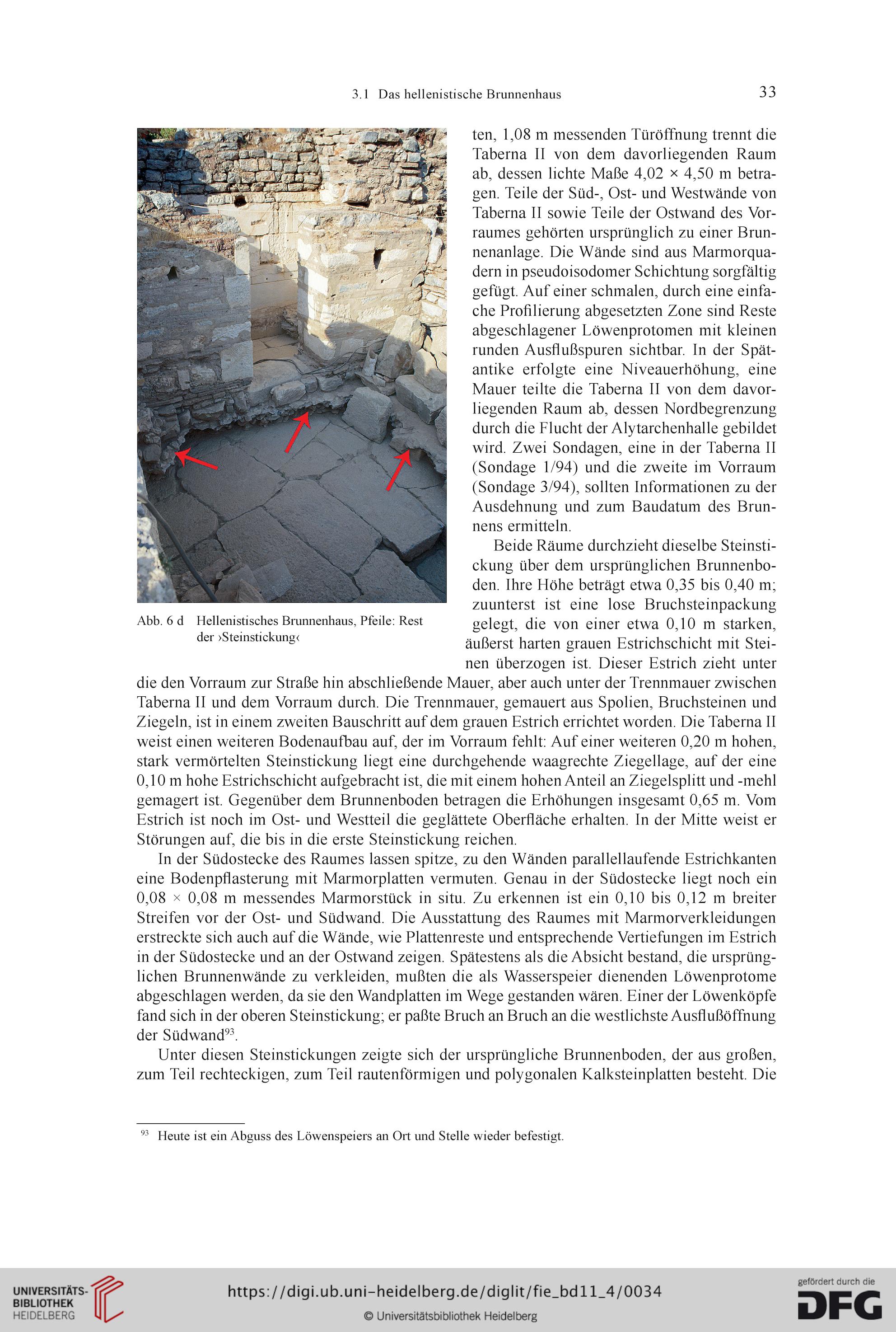3.1 Das hellenistische Brunnenhaus
33
ten, 1,08 m messenden Türöffnung trennt die
Taberna II von dem davorliegenden Raum
ab, dessen lichte Maße 4,02 x 4,50 m betra-
gen. Teile der Süd-, Ost- und Westwände von
Taberna II sowie Teile der Ostwand des Vor-
raumes gehörten ursprünglich zu einer Brun-
nenanlage. Die Wände sind aus Marmorqua-
dern in pseudoisodomer Schichtung sorgfältig
gefügt. Auf einer schmalen, durch eine einfa-
che Profilierung abgesetzten Zone sind Reste
abgeschlagener Löwenprotomen mit kleinen
runden Ausflußspuren sichtbar. In der Spät-
antike erfolgte eine Niveauerhöhung, eine
Mauer teilte die Taberna II von dem davor-
liegenden Raum ab, dessen Nordbegrenzung
durch die Flucht der Alytarchenhalle gebildet
wird. Zwei Sondagen, eine in der Taberna II
(Sondage 1/94) und die zweite im Vorraum
(Sondage 3/94), sollten Informationen zu der
Ausdehnung und zum Baudatum des Brun-
nens ermitteln.
Beide Räume durchzieht dieselbe Steinsti-
ckung über dem ursprünglichen Brunnenbo-
den. Ihre Höhe beträgt etwa 0,35 bis 0,40 m;
zuunterst ist eine lose Bruchsteinpackung
gelegt, die von einer etwa 0,10 m starken,
äußerst harten grauen Estrichschicht mit Stei-
nen überzogen ist. Dieser Estrich zieht unter
die den Vorraum zur Straße hin abschließende Mauer, aber auch unter der Trennmauer zwischen
Taberna II und dem Vorraum durch. Die Trennmauer, gemauert aus Spolien, Bruchsteinen und
Ziegeln, ist in einem zweiten Bauschritt auf dem grauen Estrich errichtet worden. Die Taberna II
weist einen weiteren Bodenaufbau auf, der im Vorraum fehlt: Auf einer weiteren 0,20 m hohen,
stark vermörtelten Steinstickung liegt eine durchgehende waagrechte Ziegellage, auf der eine
0,10 m hohe Estrichschicht aufgebracht ist, die mit einem hohen Anteil an Ziegelsplitt und -mehl
gemagert ist. Gegenüber dem Brunnenboden betragen die Erhöhungen insgesamt 0,65 m. Vom
Estrich ist noch im Ost- und Westteil die geglättete Oberfläche erhalten. In der Mitte weist er
Störungen auf, die bis in die erste Steinstickung reichen.
In der Südostecke des Raumes lassen spitze, zu den Wänden parallellaufende Estrichkanten
eine Bodenpflasterung mit Marmorplatten vermuten. Genau in der Südostecke liegt noch ein
0,08 x 0,08 m messendes Marmorstück in situ. Zu erkennen ist ein 0,10 bis 0,12 m breiter
Streifen vor der Ost- und Südwand. Die Ausstattung des Raumes mit Marmorverkleidungen
erstreckte sich auch auf die Wände, wie Plattenreste und entsprechende Vertiefungen im Estrich
in der Südostecke und an der Ostwand zeigen. Spätestens als die Absicht bestand, die ursprüng-
lichen Brunnenwände zu verkleiden, mußten die als Wasserspeier dienenden Löwenprotome
abgeschlagen werden, da sie den Wandplatten im Wege gestanden wären. Einer der Löwenköpfe
fand sich in der oberen Steinstickung; er paßte Bruch an Bruch an die westlichste Ausflußöffnung
der Südwand93.
Unter diesen Steinstickungen zeigte sich der ursprüngliche Brunnenboden, der aus großen,
zum Teil rechteckigen, zum Teil rautenförmigen und polygonalen Kalksteinplatten besteht. Die
Abb. 6 d Hellenistisches Brunnenhaus, Pfeile: Rest
der >Steinstickung<
93 Heute ist ein Abguss des Löwenspeiers an Ort und Stelle wieder befestigt.
33
ten, 1,08 m messenden Türöffnung trennt die
Taberna II von dem davorliegenden Raum
ab, dessen lichte Maße 4,02 x 4,50 m betra-
gen. Teile der Süd-, Ost- und Westwände von
Taberna II sowie Teile der Ostwand des Vor-
raumes gehörten ursprünglich zu einer Brun-
nenanlage. Die Wände sind aus Marmorqua-
dern in pseudoisodomer Schichtung sorgfältig
gefügt. Auf einer schmalen, durch eine einfa-
che Profilierung abgesetzten Zone sind Reste
abgeschlagener Löwenprotomen mit kleinen
runden Ausflußspuren sichtbar. In der Spät-
antike erfolgte eine Niveauerhöhung, eine
Mauer teilte die Taberna II von dem davor-
liegenden Raum ab, dessen Nordbegrenzung
durch die Flucht der Alytarchenhalle gebildet
wird. Zwei Sondagen, eine in der Taberna II
(Sondage 1/94) und die zweite im Vorraum
(Sondage 3/94), sollten Informationen zu der
Ausdehnung und zum Baudatum des Brun-
nens ermitteln.
Beide Räume durchzieht dieselbe Steinsti-
ckung über dem ursprünglichen Brunnenbo-
den. Ihre Höhe beträgt etwa 0,35 bis 0,40 m;
zuunterst ist eine lose Bruchsteinpackung
gelegt, die von einer etwa 0,10 m starken,
äußerst harten grauen Estrichschicht mit Stei-
nen überzogen ist. Dieser Estrich zieht unter
die den Vorraum zur Straße hin abschließende Mauer, aber auch unter der Trennmauer zwischen
Taberna II und dem Vorraum durch. Die Trennmauer, gemauert aus Spolien, Bruchsteinen und
Ziegeln, ist in einem zweiten Bauschritt auf dem grauen Estrich errichtet worden. Die Taberna II
weist einen weiteren Bodenaufbau auf, der im Vorraum fehlt: Auf einer weiteren 0,20 m hohen,
stark vermörtelten Steinstickung liegt eine durchgehende waagrechte Ziegellage, auf der eine
0,10 m hohe Estrichschicht aufgebracht ist, die mit einem hohen Anteil an Ziegelsplitt und -mehl
gemagert ist. Gegenüber dem Brunnenboden betragen die Erhöhungen insgesamt 0,65 m. Vom
Estrich ist noch im Ost- und Westteil die geglättete Oberfläche erhalten. In der Mitte weist er
Störungen auf, die bis in die erste Steinstickung reichen.
In der Südostecke des Raumes lassen spitze, zu den Wänden parallellaufende Estrichkanten
eine Bodenpflasterung mit Marmorplatten vermuten. Genau in der Südostecke liegt noch ein
0,08 x 0,08 m messendes Marmorstück in situ. Zu erkennen ist ein 0,10 bis 0,12 m breiter
Streifen vor der Ost- und Südwand. Die Ausstattung des Raumes mit Marmorverkleidungen
erstreckte sich auch auf die Wände, wie Plattenreste und entsprechende Vertiefungen im Estrich
in der Südostecke und an der Ostwand zeigen. Spätestens als die Absicht bestand, die ursprüng-
lichen Brunnenwände zu verkleiden, mußten die als Wasserspeier dienenden Löwenprotome
abgeschlagen werden, da sie den Wandplatten im Wege gestanden wären. Einer der Löwenköpfe
fand sich in der oberen Steinstickung; er paßte Bruch an Bruch an die westlichste Ausflußöffnung
der Südwand93.
Unter diesen Steinstickungen zeigte sich der ursprüngliche Brunnenboden, der aus großen,
zum Teil rechteckigen, zum Teil rautenförmigen und polygonalen Kalksteinplatten besteht. Die
Abb. 6 d Hellenistisches Brunnenhaus, Pfeile: Rest
der >Steinstickung<
93 Heute ist ein Abguss des Löwenspeiers an Ort und Stelle wieder befestigt.