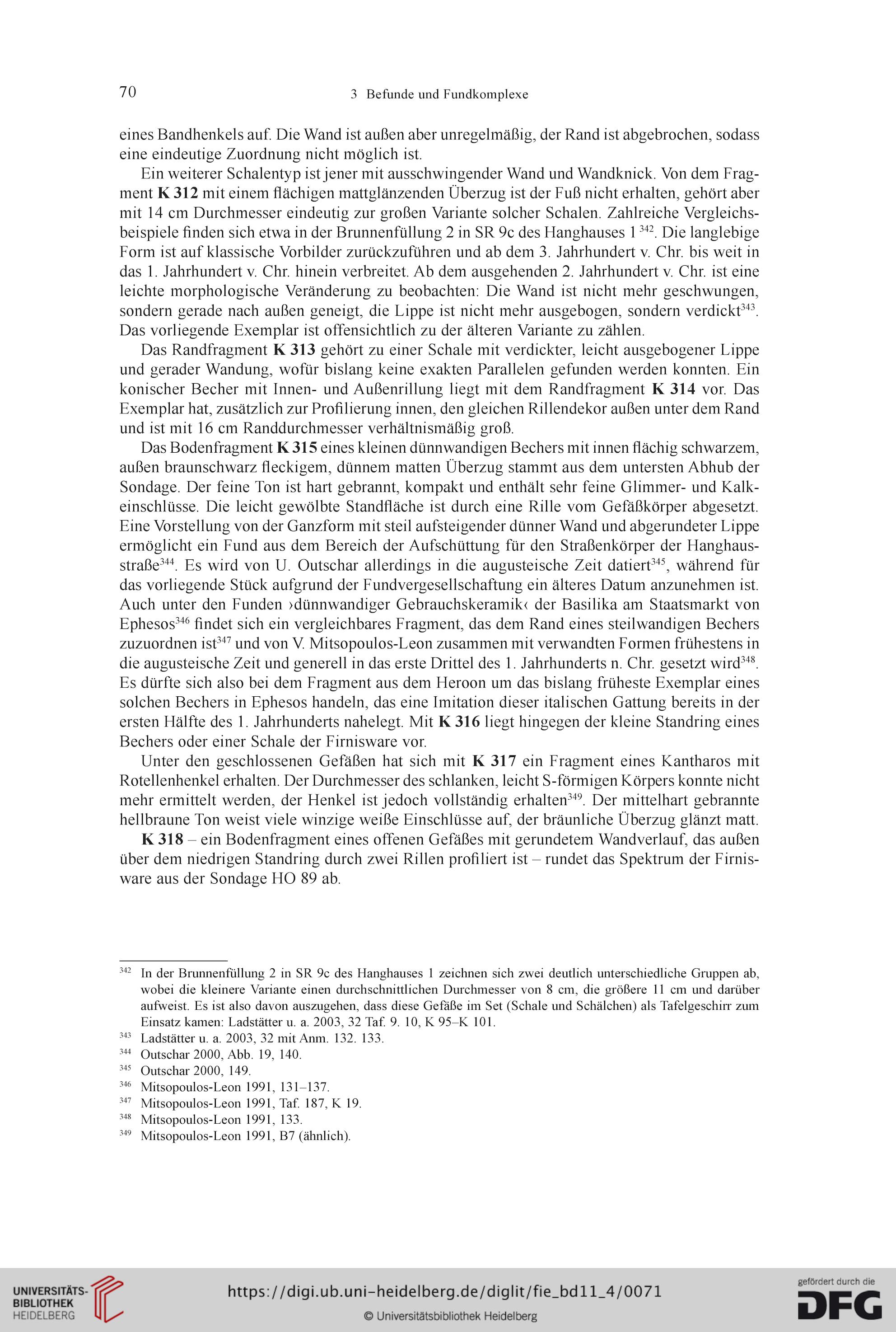70
3 Befunde und Fundkomplexe
eines Bandhenkels auf. Die Wand ist außen aber unregelmäßig, der Rand ist abgebrochen, sodass
eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.
Ein weiterer Schalentyp ist jener mit ausschwingender Wand und Wandknick. Von dem Frag-
ment K 312 mit einem flächigen mattglänzenden Überzug ist der Fuß nicht erhalten, gehört aber
mit 14 cm Durchmesser eindeutig zur großen Variante solcher Schalen. Zahlreiche Vergleichs-
beispiele finden sich etwa in der Brunnenfüllung 2 in SR 9c des Hanghauses 1 342. Die langlebige
Form ist auf klassische Vorbilder zurückzuführen und ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. bis weit in
das 1. Jahrhundert v. Chr. hinein verbreitet. Ab dem ausgehenden 2. Jahrhundert v. Chr. ist eine
leichte morphologische Veränderung zu beobachten: Die Wand ist nicht mehr geschwungen,
sondern gerade nach außen geneigt, die Lippe ist nicht mehr ausgebogen, sondern verdickt343.
Das vorliegende Exemplar ist offensichtlich zu der älteren Variante zu zählen.
Das Randfragment K 313 gehört zu einer Schale mit verdickter, leicht ausgebogener Lippe
und gerader Wandung, wofür bislang keine exakten Parallelen gefunden werden konnten. Ein
konischer Becher mit Innen- und Außenrillung liegt mit dem Randfragment K 314 vor. Das
Exemplar hat, zusätzlich zur Profilierung innen, den gleichen Rillendekor außen unter dem Rand
und ist mit 16 cm Randdurchmesser verhältnismäßig groß.
Das Bodenfragment K 315 eines kleinen dünnwandigen Bechers mit innen flächig schwarzem,
außen braunschwarz fleckigem, dünnem matten Überzug stammt aus dem untersten Abhub der
Sondage. Der feine Ton ist hart gebrannt, kompakt und enthält sehr feine Glimmer- und Kalk-
einschlüsse. Die leicht gewölbte Standfläche ist durch eine Rille vom Gefäßkörper abgesetzt.
Eine Vorstellung von der Ganzform mit steil aufsteigender dünner Wand und abgerundeter Lippe
ermöglicht ein Fund aus dem Bereich der Aufschüttung für den Straßenkörper der Hanghaus-
straße344. Es wird von U. Outschar allerdings in die augusteische Zeit datiert345, während für
das vorliegende Stück aufgrund der Fundvergesellschaftung ein älteres Datum anzunehmen ist.
Auch unter den Funden >dünnwandiger Gebrauchskeramik< der Basilika am Staatsmarkt von
Ephesos346 findet sich ein vergleichbares Fragment, das dem Rand eines steilwandigen Bechers
zuzuordnen ist347 und von V. Mitsopoulos-Leon zusammen mit verwandten Formen frühestens in
die augusteische Zeit und generell in das erste Drittel des 1. Jahrhunderts n. Chr. gesetzt wird348.
Es dürfte sich also bei dem Fragment aus dem Heroon um das bislang früheste Exemplar eines
solchen Bechers in Ephesos handeln, das eine Imitation dieser italischen Gattung bereits in der
ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts nahelegt. Mit K 316 liegt hingegen der kleine Standring eines
Bechers oder einer Schale der Firnisware vor.
Unter den geschlossenen Gefäßen hat sich mit K 317 ein Fragment eines Kantharos mit
Rotellenhenkel erhalten. Der Durchmesser des schlanken, leicht S-förmigen Körpers konnte nicht
mehr ermittelt werden, der Henkel ist jedoch vollständig erhalten349. Der mittelhart gebrannte
hellbraune Ton weist viele winzige weiße Einschlüsse auf, der bräunliche Überzug glänzt matt.
K318 - ein Bodenfragment eines offenen Gefäßes mit gerundetem Wandverlauf, das außen
über dem niedrigen Standring durch zwei Rillen profiliert ist - rundet das Spektrum der Firnis-
ware aus der Sondage HO 89 ab.
342 In der Brunnenfüllung 2 in SR 9c des Hanghauses 1 zeichnen sich zwei deutlich unterschiedliche Gruppen ab,
wobei die kleinere Variante einen durchschnittlichen Durchmesser von 8 cm, die größere 11 cm und darüber
aufweist. Es ist also davon auszugehen, dass diese Gefäße im Set (Schale und Schälchen) als Tafelgeschirr zum
Einsatz kamen: Ladstätter u. a. 2003, 32 Taf. 9. 10, K 95-K 101.
343 Ladstätter u. a. 2003, 32 mit Amn. 132. 133.
344 Outschar 2000, Abb. 19, 140.
345 Outschar 2000, 149.
346 Mitsopoulos-Leon 1991, 131-137.
347 Mitsopoulos-Leon 1991, Taf. 187, K 19.
348 Mitsopoulos-Leon 1991, 133.
349 Mitsopoulos-Leon 1991, B7 (ähnlich).
3 Befunde und Fundkomplexe
eines Bandhenkels auf. Die Wand ist außen aber unregelmäßig, der Rand ist abgebrochen, sodass
eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.
Ein weiterer Schalentyp ist jener mit ausschwingender Wand und Wandknick. Von dem Frag-
ment K 312 mit einem flächigen mattglänzenden Überzug ist der Fuß nicht erhalten, gehört aber
mit 14 cm Durchmesser eindeutig zur großen Variante solcher Schalen. Zahlreiche Vergleichs-
beispiele finden sich etwa in der Brunnenfüllung 2 in SR 9c des Hanghauses 1 342. Die langlebige
Form ist auf klassische Vorbilder zurückzuführen und ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. bis weit in
das 1. Jahrhundert v. Chr. hinein verbreitet. Ab dem ausgehenden 2. Jahrhundert v. Chr. ist eine
leichte morphologische Veränderung zu beobachten: Die Wand ist nicht mehr geschwungen,
sondern gerade nach außen geneigt, die Lippe ist nicht mehr ausgebogen, sondern verdickt343.
Das vorliegende Exemplar ist offensichtlich zu der älteren Variante zu zählen.
Das Randfragment K 313 gehört zu einer Schale mit verdickter, leicht ausgebogener Lippe
und gerader Wandung, wofür bislang keine exakten Parallelen gefunden werden konnten. Ein
konischer Becher mit Innen- und Außenrillung liegt mit dem Randfragment K 314 vor. Das
Exemplar hat, zusätzlich zur Profilierung innen, den gleichen Rillendekor außen unter dem Rand
und ist mit 16 cm Randdurchmesser verhältnismäßig groß.
Das Bodenfragment K 315 eines kleinen dünnwandigen Bechers mit innen flächig schwarzem,
außen braunschwarz fleckigem, dünnem matten Überzug stammt aus dem untersten Abhub der
Sondage. Der feine Ton ist hart gebrannt, kompakt und enthält sehr feine Glimmer- und Kalk-
einschlüsse. Die leicht gewölbte Standfläche ist durch eine Rille vom Gefäßkörper abgesetzt.
Eine Vorstellung von der Ganzform mit steil aufsteigender dünner Wand und abgerundeter Lippe
ermöglicht ein Fund aus dem Bereich der Aufschüttung für den Straßenkörper der Hanghaus-
straße344. Es wird von U. Outschar allerdings in die augusteische Zeit datiert345, während für
das vorliegende Stück aufgrund der Fundvergesellschaftung ein älteres Datum anzunehmen ist.
Auch unter den Funden >dünnwandiger Gebrauchskeramik< der Basilika am Staatsmarkt von
Ephesos346 findet sich ein vergleichbares Fragment, das dem Rand eines steilwandigen Bechers
zuzuordnen ist347 und von V. Mitsopoulos-Leon zusammen mit verwandten Formen frühestens in
die augusteische Zeit und generell in das erste Drittel des 1. Jahrhunderts n. Chr. gesetzt wird348.
Es dürfte sich also bei dem Fragment aus dem Heroon um das bislang früheste Exemplar eines
solchen Bechers in Ephesos handeln, das eine Imitation dieser italischen Gattung bereits in der
ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts nahelegt. Mit K 316 liegt hingegen der kleine Standring eines
Bechers oder einer Schale der Firnisware vor.
Unter den geschlossenen Gefäßen hat sich mit K 317 ein Fragment eines Kantharos mit
Rotellenhenkel erhalten. Der Durchmesser des schlanken, leicht S-förmigen Körpers konnte nicht
mehr ermittelt werden, der Henkel ist jedoch vollständig erhalten349. Der mittelhart gebrannte
hellbraune Ton weist viele winzige weiße Einschlüsse auf, der bräunliche Überzug glänzt matt.
K318 - ein Bodenfragment eines offenen Gefäßes mit gerundetem Wandverlauf, das außen
über dem niedrigen Standring durch zwei Rillen profiliert ist - rundet das Spektrum der Firnis-
ware aus der Sondage HO 89 ab.
342 In der Brunnenfüllung 2 in SR 9c des Hanghauses 1 zeichnen sich zwei deutlich unterschiedliche Gruppen ab,
wobei die kleinere Variante einen durchschnittlichen Durchmesser von 8 cm, die größere 11 cm und darüber
aufweist. Es ist also davon auszugehen, dass diese Gefäße im Set (Schale und Schälchen) als Tafelgeschirr zum
Einsatz kamen: Ladstätter u. a. 2003, 32 Taf. 9. 10, K 95-K 101.
343 Ladstätter u. a. 2003, 32 mit Amn. 132. 133.
344 Outschar 2000, Abb. 19, 140.
345 Outschar 2000, 149.
346 Mitsopoulos-Leon 1991, 131-137.
347 Mitsopoulos-Leon 1991, Taf. 187, K 19.
348 Mitsopoulos-Leon 1991, 133.
349 Mitsopoulos-Leon 1991, B7 (ähnlich).