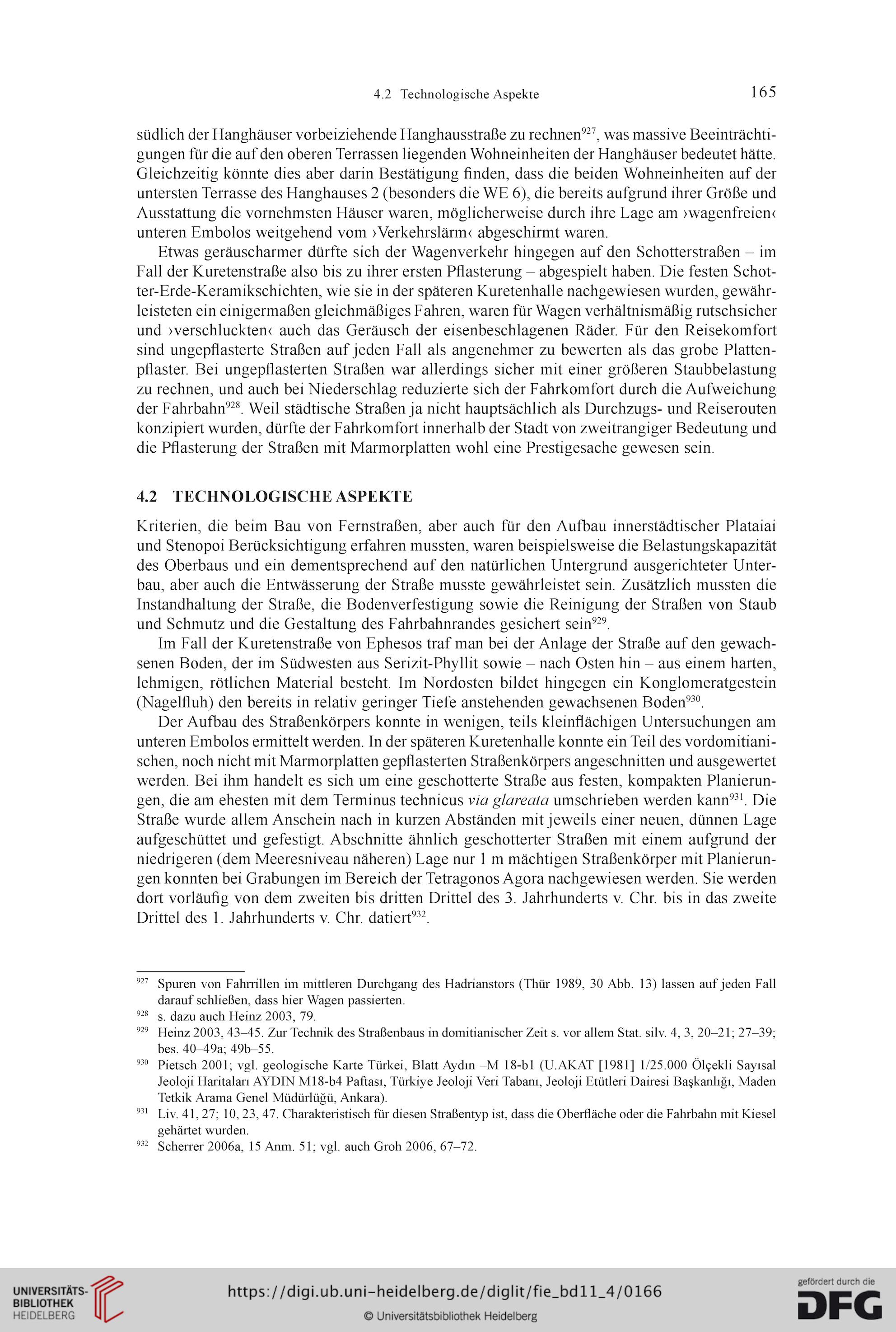4.2 Technologische Aspekte
165
südlich der Hanghäuser vorbeiziehende Hanghausstraße zu rechnen927, was massive Beeinträchti-
gungen für die auf den oberen Terrassen liegenden Wohneinheiten der Hanghäuser bedeutet hätte.
Gleichzeitig könnte dies aber darin Bestätigung finden, dass die beiden Wohneinheiten auf der
untersten Terrasse des Hanghauses 2 (besonders die WE 6), die bereits aufgrund ihrer Größe und
Ausstattung die vornehmsten Häuser waren, möglicherweise durch ihre Lage am >wagenfreien<
unteren Embolos weitgehend vom >Verkehrslärm< abgeschirmt waren.
Etwas geräuscharmer dürfte sich der Wagenverkehr hingegen auf den Schotter Straßen - im
Fall der Kuretenstraße also bis zu ihrer ersten Pflasterung - abgespielt haben. Die festen Schot-
ter-Erde-Keramikschichten, wie sie in der späteren Kuretenhalle nachgewiesen wurden, gewähr-
leisteten ein einigermaßen gleichmäßiges Fahren, waren für Wagen verhältnismäßig rutschsicher
und >verschlucktem auch das Geräusch der eisenbeschlagenen Räder. Für den Reisekomfort
sind ungepflasterte Straßen auf jeden Fall als angenehmer zu bewerten als das grobe Platten-
pflaster. Bei ungepflasterten Straßen war allerdings sicher mit einer größeren Staubbelastung
zu rechnen, und auch bei Niederschlag reduzierte sich der Fahrkomfort durch die Aufweichung
der Fahrbahn928. Weil städtische Straßen ja nicht hauptsächlich als Durchzugs- und Reiserouten
konzipiert wurden, dürfte der Fahrkomfort innerhalb der Stadt von zweitrangiger Bedeutung und
die Pflasterung der Straßen mit Marmorplatten wohl eine Prestigesache gewesen sein.
4.2 TECHNOLOGISCHE ASPEKTE
Kriterien, die beim Bau von Fernstraßen, aber auch für den Aufbau innerstädtischer Plataiai
und Stenopoi Berücksichtigung erfahren mussten, waren beispielsweise die Belastungskapazität
des Oberbaus und ein dementsprechend auf den natürlichen Untergrund ausgerichteter Unter-
bau, aber auch die Entwässerung der Straße musste gewährleistet sein. Zusätzlich mussten die
Instandhaltung der Straße, die Bodenverfestigung sowie die Reinigung der Straßen von Staub
und Schmutz und die Gestaltung des Fahrbahnrandes gesichert sein929.
Im Fall der Kuretenstraße von Ephesos traf man bei der Anlage der Straße auf den gewach-
senen Boden, der im Südwesten aus Serizit-Phyllit sowie - nach Osten hin - aus einem harten,
lehmigen, rötlichen Material besteht. Im Nordosten bildet hingegen ein Konglomeratgestein
(Nagelfluh) den bereits in relativ geringer Tiefe anstehenden gewachsenen Boden930.
Der Aufbau des Straßenkörpers konnte in wenigen, teils kleinflächigen Untersuchungen am
unteren Embolos ermittelt werden. In der späteren Kuretenhalle konnte ein Teil des vordomitiani-
schen, noch nicht mit Marmorplatten gepflasterten Straßenkörpers angeschnitten und ausgewertet
werden. Bei ihm handelt es sich um eine geschotterte Straße aus festen, kompakten Planierun-
gen, die am ehesten mit dem Terminus technicus via glareata umschrieben werden kann931. Die
Straße wurde allem Anschein nach in kurzen Abständen mit jeweils einer neuen, dünnen Lage
aufgeschüttet und gefestigt. Abschnitte ähnlich geschotterter Straßen mit einem aufgrund der
niedrigeren (dem Meeresniveau näheren) Lage nur 1 m mächtigen Straßenkörper mit Planierun-
gen konnten bei Grabungen im Bereich der Tetragonos Agora nachgewiesen werden. Sie werden
dort vorläufig von dem zweiten bis dritten Drittel des 3. Jahrhunderts v. Chr. bis in das zweite
Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. datiert932.
927 Spuren von Fahrrillen im mittleren Durchgang des Hadrianstors (Thür 1989, 30 Abb. 13) lassen auf jeden Fall
darauf schließen, dass hier Wagen passierten.
928 s. dazu auch Heinz 2003, 79.
929 Heinz 2003, 43-45. Zur Technik des Straßenbaus in domitianischer Zeit s. vor allem Stat. silv. 4, 3, 20-21; 27-39;
bes. 40-49a; 49b-55.
930 Pietsch 2001; vgl. geologische Karte Türkei, Blatt Aydm -M 18-bl (U.AKAT [1981] 1/25.000 Ölfekli Sayisal
Jeoloji Haritalari AYDIN M18-b4 Paftasi, Türkiye Jeoloji Veri Tabam, Jeoloji Etütleri Dairesi Ba§kanhgi, Maden
Tetkik Arama Genei Müdürlügü, Ankara).
931 Liv. 41, 27; 10, 23, 47. Charakteristisch für diesen Straßentyp ist, dass die Oberfläche oder die Fahrbahn mit Kiesel
gehärtet wurden.
932 Scherrer 2006a, 15 Anm. 51; vgl. auch Groh 2006, 67-72.
165
südlich der Hanghäuser vorbeiziehende Hanghausstraße zu rechnen927, was massive Beeinträchti-
gungen für die auf den oberen Terrassen liegenden Wohneinheiten der Hanghäuser bedeutet hätte.
Gleichzeitig könnte dies aber darin Bestätigung finden, dass die beiden Wohneinheiten auf der
untersten Terrasse des Hanghauses 2 (besonders die WE 6), die bereits aufgrund ihrer Größe und
Ausstattung die vornehmsten Häuser waren, möglicherweise durch ihre Lage am >wagenfreien<
unteren Embolos weitgehend vom >Verkehrslärm< abgeschirmt waren.
Etwas geräuscharmer dürfte sich der Wagenverkehr hingegen auf den Schotter Straßen - im
Fall der Kuretenstraße also bis zu ihrer ersten Pflasterung - abgespielt haben. Die festen Schot-
ter-Erde-Keramikschichten, wie sie in der späteren Kuretenhalle nachgewiesen wurden, gewähr-
leisteten ein einigermaßen gleichmäßiges Fahren, waren für Wagen verhältnismäßig rutschsicher
und >verschlucktem auch das Geräusch der eisenbeschlagenen Räder. Für den Reisekomfort
sind ungepflasterte Straßen auf jeden Fall als angenehmer zu bewerten als das grobe Platten-
pflaster. Bei ungepflasterten Straßen war allerdings sicher mit einer größeren Staubbelastung
zu rechnen, und auch bei Niederschlag reduzierte sich der Fahrkomfort durch die Aufweichung
der Fahrbahn928. Weil städtische Straßen ja nicht hauptsächlich als Durchzugs- und Reiserouten
konzipiert wurden, dürfte der Fahrkomfort innerhalb der Stadt von zweitrangiger Bedeutung und
die Pflasterung der Straßen mit Marmorplatten wohl eine Prestigesache gewesen sein.
4.2 TECHNOLOGISCHE ASPEKTE
Kriterien, die beim Bau von Fernstraßen, aber auch für den Aufbau innerstädtischer Plataiai
und Stenopoi Berücksichtigung erfahren mussten, waren beispielsweise die Belastungskapazität
des Oberbaus und ein dementsprechend auf den natürlichen Untergrund ausgerichteter Unter-
bau, aber auch die Entwässerung der Straße musste gewährleistet sein. Zusätzlich mussten die
Instandhaltung der Straße, die Bodenverfestigung sowie die Reinigung der Straßen von Staub
und Schmutz und die Gestaltung des Fahrbahnrandes gesichert sein929.
Im Fall der Kuretenstraße von Ephesos traf man bei der Anlage der Straße auf den gewach-
senen Boden, der im Südwesten aus Serizit-Phyllit sowie - nach Osten hin - aus einem harten,
lehmigen, rötlichen Material besteht. Im Nordosten bildet hingegen ein Konglomeratgestein
(Nagelfluh) den bereits in relativ geringer Tiefe anstehenden gewachsenen Boden930.
Der Aufbau des Straßenkörpers konnte in wenigen, teils kleinflächigen Untersuchungen am
unteren Embolos ermittelt werden. In der späteren Kuretenhalle konnte ein Teil des vordomitiani-
schen, noch nicht mit Marmorplatten gepflasterten Straßenkörpers angeschnitten und ausgewertet
werden. Bei ihm handelt es sich um eine geschotterte Straße aus festen, kompakten Planierun-
gen, die am ehesten mit dem Terminus technicus via glareata umschrieben werden kann931. Die
Straße wurde allem Anschein nach in kurzen Abständen mit jeweils einer neuen, dünnen Lage
aufgeschüttet und gefestigt. Abschnitte ähnlich geschotterter Straßen mit einem aufgrund der
niedrigeren (dem Meeresniveau näheren) Lage nur 1 m mächtigen Straßenkörper mit Planierun-
gen konnten bei Grabungen im Bereich der Tetragonos Agora nachgewiesen werden. Sie werden
dort vorläufig von dem zweiten bis dritten Drittel des 3. Jahrhunderts v. Chr. bis in das zweite
Drittel des 1. Jahrhunderts v. Chr. datiert932.
927 Spuren von Fahrrillen im mittleren Durchgang des Hadrianstors (Thür 1989, 30 Abb. 13) lassen auf jeden Fall
darauf schließen, dass hier Wagen passierten.
928 s. dazu auch Heinz 2003, 79.
929 Heinz 2003, 43-45. Zur Technik des Straßenbaus in domitianischer Zeit s. vor allem Stat. silv. 4, 3, 20-21; 27-39;
bes. 40-49a; 49b-55.
930 Pietsch 2001; vgl. geologische Karte Türkei, Blatt Aydm -M 18-bl (U.AKAT [1981] 1/25.000 Ölfekli Sayisal
Jeoloji Haritalari AYDIN M18-b4 Paftasi, Türkiye Jeoloji Veri Tabam, Jeoloji Etütleri Dairesi Ba§kanhgi, Maden
Tetkik Arama Genei Müdürlügü, Ankara).
931 Liv. 41, 27; 10, 23, 47. Charakteristisch für diesen Straßentyp ist, dass die Oberfläche oder die Fahrbahn mit Kiesel
gehärtet wurden.
932 Scherrer 2006a, 15 Anm. 51; vgl. auch Groh 2006, 67-72.