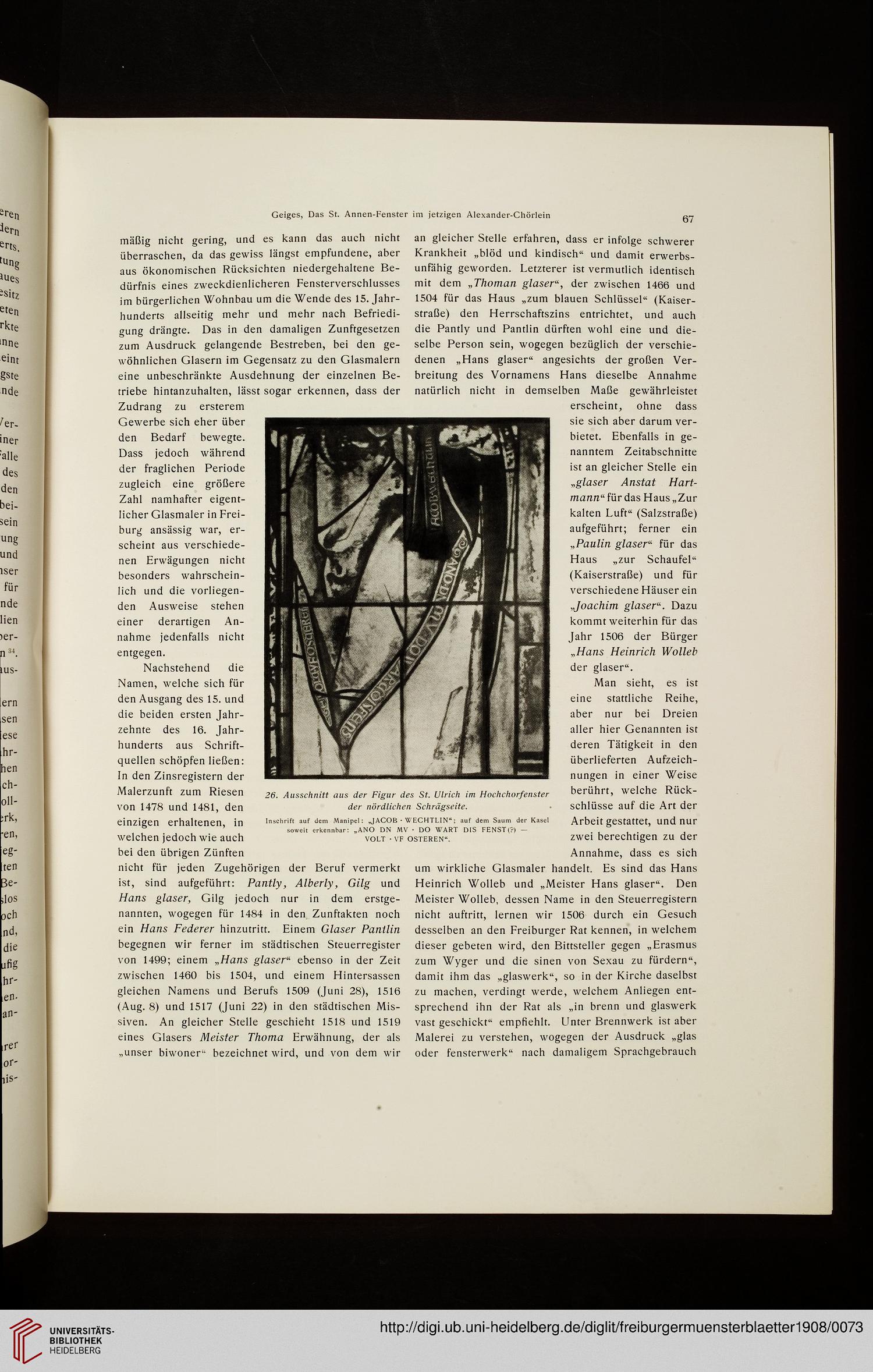S5?C
H
Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
67
mäßig nicht gering, und es kann das auch nicht
überraschen, da das gewiss längst empfundene, aber
aus ökonomischen Rücksichten niedergehaltene Be-
dürfnis eines zweckdienlicheren Fensterverschlusses
im bürgerlichen Wohnbau um die Wende des 15. Jahr-
hunderts allseitig mehr und mehr nach Befriedi-
gung drängte. Das in den damaligen Zunftgesetzen
zum Ausdruck gelangende Bestreben, bei den ge-
wöhnlichen Glasern im Gegensatz zu den Glasmalern
eine unbeschränkte Ausdehnung der einzelnen Be-
triebe hintanzuhalten, lässt sogar erkennen, dass der
Zudrang zu ersterem
Gewerbe sich eher über
den Bedarf bewegte.
Dass jedoch während
der fraglichen Periode
zugleich eine größere
Zahl namhafter eigent-
licher Glasmaler in Frei-
burg ansässig war, er-
scheint aus verschiede-
nen Erwägungen nicht
besonders wahrschein-
lich und die vorliegen-
den Ausweise stehen
einer derartigen An-
nahme jedenfalls nicht
entgegen.
Nachstehend die
Namen, welche sich für
den Ausgang des 15. und
die beiden ersten Jahr-
zehnte des 16. Jahr-
hunderts aus Schrift-
quellen schöpfen ließen:
In den Zinsregistern der
Malerzunft zum Riesen
von 1478 und 1481, den
einzigen erhaltenen, in
welchen jedoch wie auch
bei den übrigen Zünften
nicht für jeden Zugehörigen der Beruf vermerkt
ist, sind aufgeführt: Pantly, Alberly, Gilg und
Hans glaser, Gilg jedoch nur in dem erstge-
nannten, wogegen für 1484 in den Zunftakten noch
ein Hans Federer hinzutritt. Einem Glaser Pantlin
begegnen wir ferner im städtischen Steuerregister
von 1499; einem „Hans glaser" ebenso in der Zeit
zwischen 1460 bis 1504, und einem Hintersassen
gleichen Namens und Berufs 1509 (Juni 28), 1516
(Aug. 8) und 1517 (Juni 22) in den städtischen Mis-
siven. An gleicher Stelle geschieht 1518 und 1519
eines Glasers Meister Thoma Erwähnung, der als
„unser biwoner" bezeichnet wird, und von dem wir
26. Ausschnitt aus der Figur des St. Ulrich im Hochchorfenster
der nördlichen Schrägseite.
Inschrift auf dem Manipe! : JACOB ■ WECHTLIN" ; auf dem Saum der Kasel
„ANO DN MV • DO WART DIS FENST(?) —
VOLT ■ VF OSTEREN".
soweit erkennb
an gleicher Stelle erfahren, dass er infolge schwerer
Krankheit „blöd und kindisch" und damit erwerbs-
unfähig geworden. Letzterer ist vermutlich identisch
mit dem „Thoman glaser'', der zwischen 1466 und
1504 für das Haus „zum blauen Schlüssel" (Kaiser-
straße) den Herrschaftszins entrichtet, und auch
die Pantly und Pantlin dürften wohl eine und die-
selbe Person sein, wogegen bezüglich der verschie-
denen „Hans glaser" angesichts der großen Ver-
breitung des Vornamens Hans dieselbe Annahme
natürlich nicht in demselben Maße gewährleistet
erscheint, ohne dass
sie sich aber darum ver-
bietet. Ebenfalls in ge-
nanntem Zeitabschnitte
ist an gleicher Stelle ein
„glaser Anstat Hart-
mann" für das Haus „Zur
kalten Luft" (Salzstraße)
aufgeführt; ferner ein
„Paulin glaser" für das
Haus „zur Schaufel"
(Kaiserstraße) und für
verschiedene Häuser ein
„Joachim glaser". Dazu
kommt weiterhin für das
Jahr 1506 der Bürger
„Hans Heinrich Wolleb
der glaser".
Man sieht, es ist
eine stattliche Reihe,
aber nur bei Dreien
aller hier Genannten ist
deren Tätigkeit in den
überlieferten Aufzeich-
nungen in einer Weise
berührt, welche Rück-
schlüsse auf die Art der
Arbeit gestattet, und nur
zwei berechtigen zu der
Annahme, dass es sich
um wirkliche Glasmaler handelt. Es sind das Hans
Heinrich Wolleb und „Meister Hans glaser". Den
Meister Wolleb, dessen Name in den Steuerregistern
nicht auftritt, lernen wir 1506 durch ein Gesuch
desselben an den Freiburger Rat kennen, in welchem
dieser gebeten wird, den Bittsteller gegen „Erasmus
zum Wyger und die sinen von Sexau zu fürdern",
damit ihm das „glaswerk", so in der Kirche daselbst
zu machen, verdingt werde, welchem Anliegen ent-
sprechend ihn der Rat als „in brenn und glaswerk
vast geschickt" empfiehlt. Unter Brennwerk ist aber
Malerei zu verstehen, wogegen der Ausdruck „glas
oder fensterwerk" nach damaligem Sprachgebrauch
H
Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein
67
mäßig nicht gering, und es kann das auch nicht
überraschen, da das gewiss längst empfundene, aber
aus ökonomischen Rücksichten niedergehaltene Be-
dürfnis eines zweckdienlicheren Fensterverschlusses
im bürgerlichen Wohnbau um die Wende des 15. Jahr-
hunderts allseitig mehr und mehr nach Befriedi-
gung drängte. Das in den damaligen Zunftgesetzen
zum Ausdruck gelangende Bestreben, bei den ge-
wöhnlichen Glasern im Gegensatz zu den Glasmalern
eine unbeschränkte Ausdehnung der einzelnen Be-
triebe hintanzuhalten, lässt sogar erkennen, dass der
Zudrang zu ersterem
Gewerbe sich eher über
den Bedarf bewegte.
Dass jedoch während
der fraglichen Periode
zugleich eine größere
Zahl namhafter eigent-
licher Glasmaler in Frei-
burg ansässig war, er-
scheint aus verschiede-
nen Erwägungen nicht
besonders wahrschein-
lich und die vorliegen-
den Ausweise stehen
einer derartigen An-
nahme jedenfalls nicht
entgegen.
Nachstehend die
Namen, welche sich für
den Ausgang des 15. und
die beiden ersten Jahr-
zehnte des 16. Jahr-
hunderts aus Schrift-
quellen schöpfen ließen:
In den Zinsregistern der
Malerzunft zum Riesen
von 1478 und 1481, den
einzigen erhaltenen, in
welchen jedoch wie auch
bei den übrigen Zünften
nicht für jeden Zugehörigen der Beruf vermerkt
ist, sind aufgeführt: Pantly, Alberly, Gilg und
Hans glaser, Gilg jedoch nur in dem erstge-
nannten, wogegen für 1484 in den Zunftakten noch
ein Hans Federer hinzutritt. Einem Glaser Pantlin
begegnen wir ferner im städtischen Steuerregister
von 1499; einem „Hans glaser" ebenso in der Zeit
zwischen 1460 bis 1504, und einem Hintersassen
gleichen Namens und Berufs 1509 (Juni 28), 1516
(Aug. 8) und 1517 (Juni 22) in den städtischen Mis-
siven. An gleicher Stelle geschieht 1518 und 1519
eines Glasers Meister Thoma Erwähnung, der als
„unser biwoner" bezeichnet wird, und von dem wir
26. Ausschnitt aus der Figur des St. Ulrich im Hochchorfenster
der nördlichen Schrägseite.
Inschrift auf dem Manipe! : JACOB ■ WECHTLIN" ; auf dem Saum der Kasel
„ANO DN MV • DO WART DIS FENST(?) —
VOLT ■ VF OSTEREN".
soweit erkennb
an gleicher Stelle erfahren, dass er infolge schwerer
Krankheit „blöd und kindisch" und damit erwerbs-
unfähig geworden. Letzterer ist vermutlich identisch
mit dem „Thoman glaser'', der zwischen 1466 und
1504 für das Haus „zum blauen Schlüssel" (Kaiser-
straße) den Herrschaftszins entrichtet, und auch
die Pantly und Pantlin dürften wohl eine und die-
selbe Person sein, wogegen bezüglich der verschie-
denen „Hans glaser" angesichts der großen Ver-
breitung des Vornamens Hans dieselbe Annahme
natürlich nicht in demselben Maße gewährleistet
erscheint, ohne dass
sie sich aber darum ver-
bietet. Ebenfalls in ge-
nanntem Zeitabschnitte
ist an gleicher Stelle ein
„glaser Anstat Hart-
mann" für das Haus „Zur
kalten Luft" (Salzstraße)
aufgeführt; ferner ein
„Paulin glaser" für das
Haus „zur Schaufel"
(Kaiserstraße) und für
verschiedene Häuser ein
„Joachim glaser". Dazu
kommt weiterhin für das
Jahr 1506 der Bürger
„Hans Heinrich Wolleb
der glaser".
Man sieht, es ist
eine stattliche Reihe,
aber nur bei Dreien
aller hier Genannten ist
deren Tätigkeit in den
überlieferten Aufzeich-
nungen in einer Weise
berührt, welche Rück-
schlüsse auf die Art der
Arbeit gestattet, und nur
zwei berechtigen zu der
Annahme, dass es sich
um wirkliche Glasmaler handelt. Es sind das Hans
Heinrich Wolleb und „Meister Hans glaser". Den
Meister Wolleb, dessen Name in den Steuerregistern
nicht auftritt, lernen wir 1506 durch ein Gesuch
desselben an den Freiburger Rat kennen, in welchem
dieser gebeten wird, den Bittsteller gegen „Erasmus
zum Wyger und die sinen von Sexau zu fürdern",
damit ihm das „glaswerk", so in der Kirche daselbst
zu machen, verdingt werde, welchem Anliegen ent-
sprechend ihn der Rat als „in brenn und glaswerk
vast geschickt" empfiehlt. Unter Brennwerk ist aber
Malerei zu verstehen, wogegen der Ausdruck „glas
oder fensterwerk" nach damaligem Sprachgebrauch