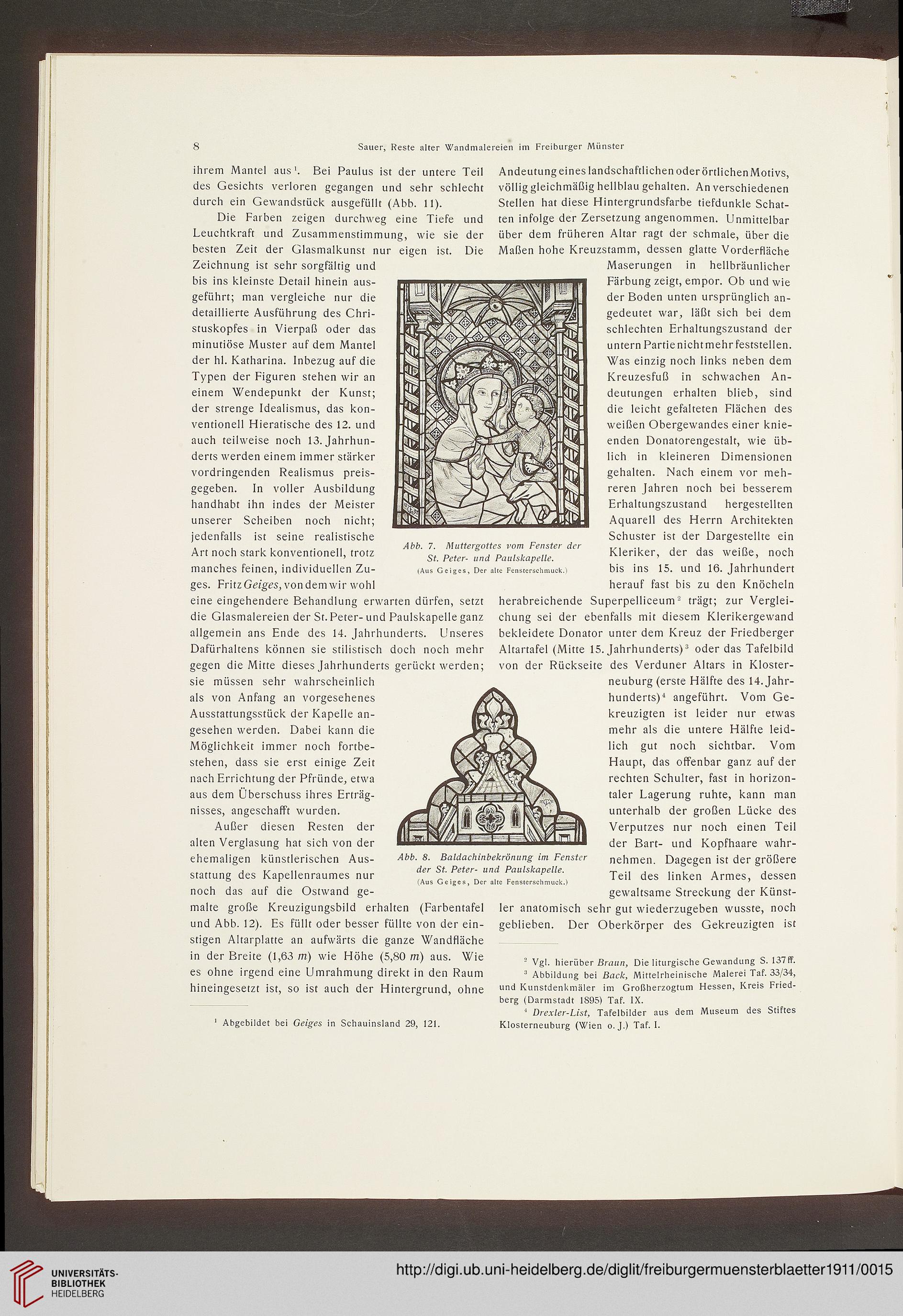Sauer, Reste alter Wandmalereien im Freiburger Münster
ihrem Mantel aus1. Bei Paulus ist der untere Teil AndeutungeineslandschaftlichenoderörtlichenMotivs,
des Gesichts verloren gegangen und sehr schlecht völlig gleichmäßig hellblau gehalten. An verschiedenen
durch ein Gewandstück ausgefüllt (Abb. 11). Stellen hat diese Hintergrundsfarbe tiefdunkle Schat-
Die Farben zeigen durchweg eine Tiefe und ten infolge der Zersetzung angenommen. Unmittelbar
Leuchtkraft und Zusammenstimmung, wie sie der über dem früheren Altar ragt der schmale, über die
besten Zeit der Glasmalkunst nur eigen ist. Die Maßen hohe Kreuzstamm, dessen glatte Vorderfläche
Zeichnung ist sehr sorgfältig und
bis ins kleinste Detail hinein aus-
geführt; man vergleiche nur die
detaillierte Ausführung des Chri-
stuskopfes in Vierpaß oder das
minutiöse Muster auf dem Mantel
der hl. Katharina. Inbezug auf die
Typen der Figuren stehen wir an
einem Wendepunkt der Kunst;
der strenge Idealismus, das kon-
ventionell Hieratische des 12. und
auch teilweise noch 13. Jahrhun-
derts werden einem immer stärker
vordringenden Realismus preis-
gegeben. In voller Ausbildung
handhabt ihn indes der Meister
unserer Scheiben noch nicht;
jedenfalls ist seine realistische
Art noch stark konventionell, trotz
manches feinen, individuellen Zu-
ges. FritzGeiges, vondemwir wohl
Abb. 7. Muttergottes vom Fenster der
St. Peter- und Paulskapelle.
(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)
Maserungen in hellbräunlicher
Färbung zeigt, empor. Ob und wie
der Boden unten ursprünglich an-
gedeutet war, läßt sich bei dem
schlechten Erhaltungszustand der
untern Partie nicht mehr feststellen.
Was einzig noch links neben dem
Kreuzesfuß in schwachen An-
deutungen erhalten blieb, sind
die leicht gefalteten Flächen des
weißen Obergewandes einer knie-
enden Donatorengestalt, wie üb-
lich in kleineren Dimensionen
gehalten. Nach einem vor meh-
reren Jahren noch bei besserem
Erhaltungszustand hergestellten
Aquarell des Herrn Architekten
Schuster ist der Dargestellte ein
Kleriker, der das weiße, noch
bis ins 15. und 16. Jahrhundert
herauf fast bis zu den Knöcheln
eine eingehendere Behandlung erwarten dürfen, setzt herabreichende Superpelliceum2 trägt; zur Verglei-
die Glasmalereien der St. Peter-und Paulskapelle ganz chung sei der ebenfalls mit diesem Klerikergewand
allgemein ans Ende des 14. Jahrhunderts. Unseres bekleidete Donator unter dem Kreuz der Friedberger
Dafürhaltens können sie stilistisch doch noch mehr Altartafel (Mitte 15. Jahrhunderts)3 oder das Tafelbild
gegen die Mitte dieses Jahrhunderts gerückt werden; von der Rückseite des Verduner Altars in Kloster-
sie müssen sehr wahrscheinlich
als von Anfang an vorgesehenes
Ausstattungsstück der Kapelle an-
gesehen werden. Dabei kann die
Möglichkeit immer noch fortbe-
stehen, dass sie erst einige Zeit
nach Errichtung der Pfründe, etwa
aus dem Überschuss ihres Erträg-
nisses, angeschafft wurden.
Außer diesen Resten der
alten Verglasung hat sich von der
ehemaligen künstlerischen Aus-
stattung des Kapellenraumes nur
noch das auf die Ostwand ge-
Abb. 8. Baldachinbekrönung im Fenster
der St. Peter- und Paulskapelle.
(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)
neuburg (erste Hälfte des 14. Jahr-
hunderts)4 angeführt. Vom Ge-
kreuzigten ist leider nur etwas
mehr als die untere Hälfte leid-
lich gut noch sichtbar. Vom
Haupt, das offenbar ganz auf der
rechten Schulter, fast in horizon-
taler Lagerung ruhte, kann man
unterhalb der großen Lücke des
Verputzes nur noch einen Teil
der Bart- und Kopfhaare wahr-
nehmen. Dagegen ist der größere
Teil des linken Armes, dessen
gewaltsame Streckung der Künst-
malte große Kreuzigungsbild erhalten (Farbentafel 1er anatomisch sehr gut wiederzugeben wusste, noch
und Abb. 12). Es füllt oder besser füllte von der ein- geblieben. Der Oberkörper des Gekreuzigten ist
stigen Altarplatte an aufwärts die ganze Wandfläche
in der Breite (1,63 tri) wie Höhe (5,80 tri) aus. Wie ., ,, , .. ... „ „. ... . . r„iraJll„ e n7ff
\ ' / \ ' / Vgl. hierüber Braun, Die liturgische Gewandung s. um.
es Ohne irgend eine Umrahmung direkt in den Raum 3 Abbildung bei Back, Mittelrheinische Malerei Taf. 33/34,
hineingesetzt ist, SO ist auch der Hintergrund, ohne und Kunstdenkmäler im Großherzogtum Hessen, Kreis Fried-
________ berg (Darmstadt 1895) Taf. IX.
1 Drexler-List, Tafelbilder aus dem Museum des Stiftes
1 Abgebildet bei Geiges in Schauinsland 29, 121. Klosterneuburg (Wien o. J.) Taf. I.
ihrem Mantel aus1. Bei Paulus ist der untere Teil AndeutungeineslandschaftlichenoderörtlichenMotivs,
des Gesichts verloren gegangen und sehr schlecht völlig gleichmäßig hellblau gehalten. An verschiedenen
durch ein Gewandstück ausgefüllt (Abb. 11). Stellen hat diese Hintergrundsfarbe tiefdunkle Schat-
Die Farben zeigen durchweg eine Tiefe und ten infolge der Zersetzung angenommen. Unmittelbar
Leuchtkraft und Zusammenstimmung, wie sie der über dem früheren Altar ragt der schmale, über die
besten Zeit der Glasmalkunst nur eigen ist. Die Maßen hohe Kreuzstamm, dessen glatte Vorderfläche
Zeichnung ist sehr sorgfältig und
bis ins kleinste Detail hinein aus-
geführt; man vergleiche nur die
detaillierte Ausführung des Chri-
stuskopfes in Vierpaß oder das
minutiöse Muster auf dem Mantel
der hl. Katharina. Inbezug auf die
Typen der Figuren stehen wir an
einem Wendepunkt der Kunst;
der strenge Idealismus, das kon-
ventionell Hieratische des 12. und
auch teilweise noch 13. Jahrhun-
derts werden einem immer stärker
vordringenden Realismus preis-
gegeben. In voller Ausbildung
handhabt ihn indes der Meister
unserer Scheiben noch nicht;
jedenfalls ist seine realistische
Art noch stark konventionell, trotz
manches feinen, individuellen Zu-
ges. FritzGeiges, vondemwir wohl
Abb. 7. Muttergottes vom Fenster der
St. Peter- und Paulskapelle.
(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)
Maserungen in hellbräunlicher
Färbung zeigt, empor. Ob und wie
der Boden unten ursprünglich an-
gedeutet war, läßt sich bei dem
schlechten Erhaltungszustand der
untern Partie nicht mehr feststellen.
Was einzig noch links neben dem
Kreuzesfuß in schwachen An-
deutungen erhalten blieb, sind
die leicht gefalteten Flächen des
weißen Obergewandes einer knie-
enden Donatorengestalt, wie üb-
lich in kleineren Dimensionen
gehalten. Nach einem vor meh-
reren Jahren noch bei besserem
Erhaltungszustand hergestellten
Aquarell des Herrn Architekten
Schuster ist der Dargestellte ein
Kleriker, der das weiße, noch
bis ins 15. und 16. Jahrhundert
herauf fast bis zu den Knöcheln
eine eingehendere Behandlung erwarten dürfen, setzt herabreichende Superpelliceum2 trägt; zur Verglei-
die Glasmalereien der St. Peter-und Paulskapelle ganz chung sei der ebenfalls mit diesem Klerikergewand
allgemein ans Ende des 14. Jahrhunderts. Unseres bekleidete Donator unter dem Kreuz der Friedberger
Dafürhaltens können sie stilistisch doch noch mehr Altartafel (Mitte 15. Jahrhunderts)3 oder das Tafelbild
gegen die Mitte dieses Jahrhunderts gerückt werden; von der Rückseite des Verduner Altars in Kloster-
sie müssen sehr wahrscheinlich
als von Anfang an vorgesehenes
Ausstattungsstück der Kapelle an-
gesehen werden. Dabei kann die
Möglichkeit immer noch fortbe-
stehen, dass sie erst einige Zeit
nach Errichtung der Pfründe, etwa
aus dem Überschuss ihres Erträg-
nisses, angeschafft wurden.
Außer diesen Resten der
alten Verglasung hat sich von der
ehemaligen künstlerischen Aus-
stattung des Kapellenraumes nur
noch das auf die Ostwand ge-
Abb. 8. Baldachinbekrönung im Fenster
der St. Peter- und Paulskapelle.
(Aus Geiges, Der alte Fensterschmuck.)
neuburg (erste Hälfte des 14. Jahr-
hunderts)4 angeführt. Vom Ge-
kreuzigten ist leider nur etwas
mehr als die untere Hälfte leid-
lich gut noch sichtbar. Vom
Haupt, das offenbar ganz auf der
rechten Schulter, fast in horizon-
taler Lagerung ruhte, kann man
unterhalb der großen Lücke des
Verputzes nur noch einen Teil
der Bart- und Kopfhaare wahr-
nehmen. Dagegen ist der größere
Teil des linken Armes, dessen
gewaltsame Streckung der Künst-
malte große Kreuzigungsbild erhalten (Farbentafel 1er anatomisch sehr gut wiederzugeben wusste, noch
und Abb. 12). Es füllt oder besser füllte von der ein- geblieben. Der Oberkörper des Gekreuzigten ist
stigen Altarplatte an aufwärts die ganze Wandfläche
in der Breite (1,63 tri) wie Höhe (5,80 tri) aus. Wie ., ,, , .. ... „ „. ... . . r„iraJll„ e n7ff
\ ' / \ ' / Vgl. hierüber Braun, Die liturgische Gewandung s. um.
es Ohne irgend eine Umrahmung direkt in den Raum 3 Abbildung bei Back, Mittelrheinische Malerei Taf. 33/34,
hineingesetzt ist, SO ist auch der Hintergrund, ohne und Kunstdenkmäler im Großherzogtum Hessen, Kreis Fried-
________ berg (Darmstadt 1895) Taf. IX.
1 Drexler-List, Tafelbilder aus dem Museum des Stiftes
1 Abgebildet bei Geiges in Schauinsland 29, 121. Klosterneuburg (Wien o. J.) Taf. I.