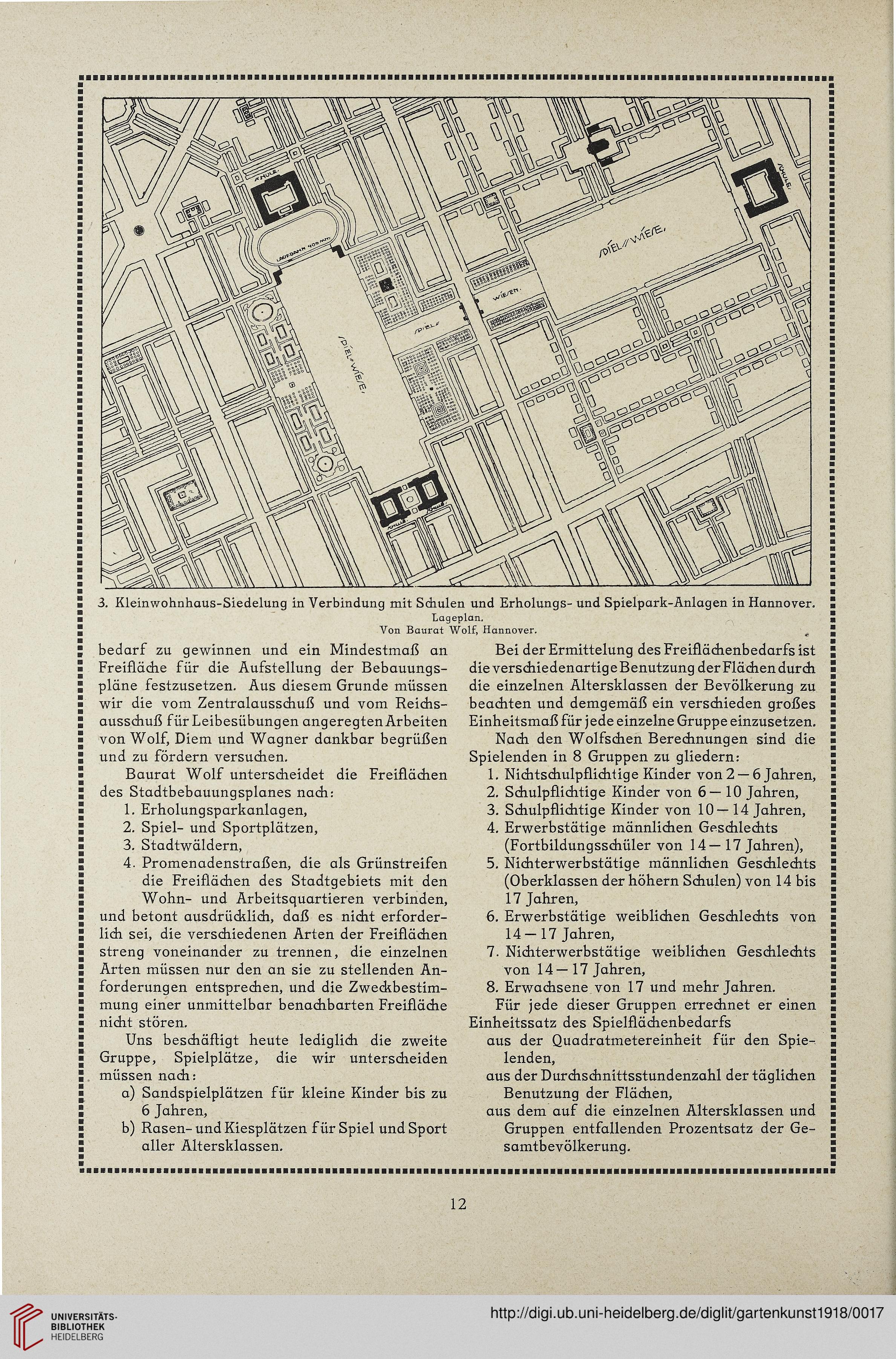3.
Kleinwohnhaus-Siedelung in Verbindung mit Schulen und Erholungs- und Spielpark-Anlagen in Hannover.
Lageplan.
Von Baurat Wolf, Hannover. t
bedarf zu gewinnen und ein Mindestmaß an
Freifläche für die Aufstellung der Bebauungs-
pläne festzusetzen. Aus diesem Grunde müssen
wir die vom Zentralausschuß und vom Reichs-
ausschuß für Leibesübungen angeregten Arbeiten
von Wolf, Diem und Wagner dankbar begrüßen
und zu fördern versuchen.
Baurat Wolf unterscheidet die Freiflächen
des Stadtbebauungsplanes nach:
1. Erholungsparkanlagen,
2. Spiel- und Sportplätzen,
3. Stadtwäldern,
4. Promenadenstraßen, die als Grünstreifen
die Freiflächen des Stadtgebiets mit den
Wohn- und Arbeitsquartieren verbinden,
und betont ausdrücklich, daß es nicht erforder-
lich sei, die verschiedenen Arten der Freiflächen
streng voneinander zu trennen, die einzelnen
Arten müssen nur den an sie zu stellenden An-
forderungen entsprechen, und die Zweckbestim-
mung einer unmittelbar benachbarten Freifläche
nicht stören.
Uns beschäftigt heute lediglich die zweite
Gruppe, Spielplätze, die wir unterscheiden
müssen nach:
a) Sandspielplätzen für kleine Kinder bis zu
6 Jahren,
b) Rasen- und Kiesplätzen f ür Spiel und Sport
aller Altersklassen.
Bei der Ermittelung des Freiflächenbedarfs ist
die verschiedenartig e Benutzung der Flächen durch
die einzelnen Altersklassen der Bevölkerung zu
beachten und demgemäß ein verschieden großes
Einheitsmaß für jede einzelne Gruppe einzusetzen.
Nach den Wolfschen Berechnungen sind die
Spielenden in 8 Gruppen zu gliedern:
1. Nichtschulpflichtige Kinder von 2 — 6 Jahren,
2. Schulpflichtige Kinder von 6—10 Jahren,
3. Schulpflichtige Kinder von 10— 14 Jahren,
4. Erwerbstätige männlichen Geschlechts
(Fortbildungsschüler von 14—17 Jahren),
5. Nichterwerbstätige männlichen Geschlechts
(Oberklassen der höhern Schulen) von 14 bis
17 Jahren,
6. Erwerbstätige weiblichen Geschlechts von
14 — 17 Jahren,
7. Nichterwerbstätige weiblichen Geschlechts
von 14—17 Jahren,
8. Erwachsene von 17 und mehr Jahren.
Für jede dieser Gruppen errechnet er einen
Einheitssatz des Spielflächenbedarfs
aus der Quadratmetereinheit für den Spie-
lenden,
aus der Durchschnittsstundenzahl der täglichen
Benutzung der Flächen,
aus dem auf die einzelnen Altersklassen und
Gruppen entfallenden Prozentsatz der Ge-
samtbevölkerung.
12
Kleinwohnhaus-Siedelung in Verbindung mit Schulen und Erholungs- und Spielpark-Anlagen in Hannover.
Lageplan.
Von Baurat Wolf, Hannover. t
bedarf zu gewinnen und ein Mindestmaß an
Freifläche für die Aufstellung der Bebauungs-
pläne festzusetzen. Aus diesem Grunde müssen
wir die vom Zentralausschuß und vom Reichs-
ausschuß für Leibesübungen angeregten Arbeiten
von Wolf, Diem und Wagner dankbar begrüßen
und zu fördern versuchen.
Baurat Wolf unterscheidet die Freiflächen
des Stadtbebauungsplanes nach:
1. Erholungsparkanlagen,
2. Spiel- und Sportplätzen,
3. Stadtwäldern,
4. Promenadenstraßen, die als Grünstreifen
die Freiflächen des Stadtgebiets mit den
Wohn- und Arbeitsquartieren verbinden,
und betont ausdrücklich, daß es nicht erforder-
lich sei, die verschiedenen Arten der Freiflächen
streng voneinander zu trennen, die einzelnen
Arten müssen nur den an sie zu stellenden An-
forderungen entsprechen, und die Zweckbestim-
mung einer unmittelbar benachbarten Freifläche
nicht stören.
Uns beschäftigt heute lediglich die zweite
Gruppe, Spielplätze, die wir unterscheiden
müssen nach:
a) Sandspielplätzen für kleine Kinder bis zu
6 Jahren,
b) Rasen- und Kiesplätzen f ür Spiel und Sport
aller Altersklassen.
Bei der Ermittelung des Freiflächenbedarfs ist
die verschiedenartig e Benutzung der Flächen durch
die einzelnen Altersklassen der Bevölkerung zu
beachten und demgemäß ein verschieden großes
Einheitsmaß für jede einzelne Gruppe einzusetzen.
Nach den Wolfschen Berechnungen sind die
Spielenden in 8 Gruppen zu gliedern:
1. Nichtschulpflichtige Kinder von 2 — 6 Jahren,
2. Schulpflichtige Kinder von 6—10 Jahren,
3. Schulpflichtige Kinder von 10— 14 Jahren,
4. Erwerbstätige männlichen Geschlechts
(Fortbildungsschüler von 14—17 Jahren),
5. Nichterwerbstätige männlichen Geschlechts
(Oberklassen der höhern Schulen) von 14 bis
17 Jahren,
6. Erwerbstätige weiblichen Geschlechts von
14 — 17 Jahren,
7. Nichterwerbstätige weiblichen Geschlechts
von 14—17 Jahren,
8. Erwachsene von 17 und mehr Jahren.
Für jede dieser Gruppen errechnet er einen
Einheitssatz des Spielflächenbedarfs
aus der Quadratmetereinheit für den Spie-
lenden,
aus der Durchschnittsstundenzahl der täglichen
Benutzung der Flächen,
aus dem auf die einzelnen Altersklassen und
Gruppen entfallenden Prozentsatz der Ge-
samtbevölkerung.
12