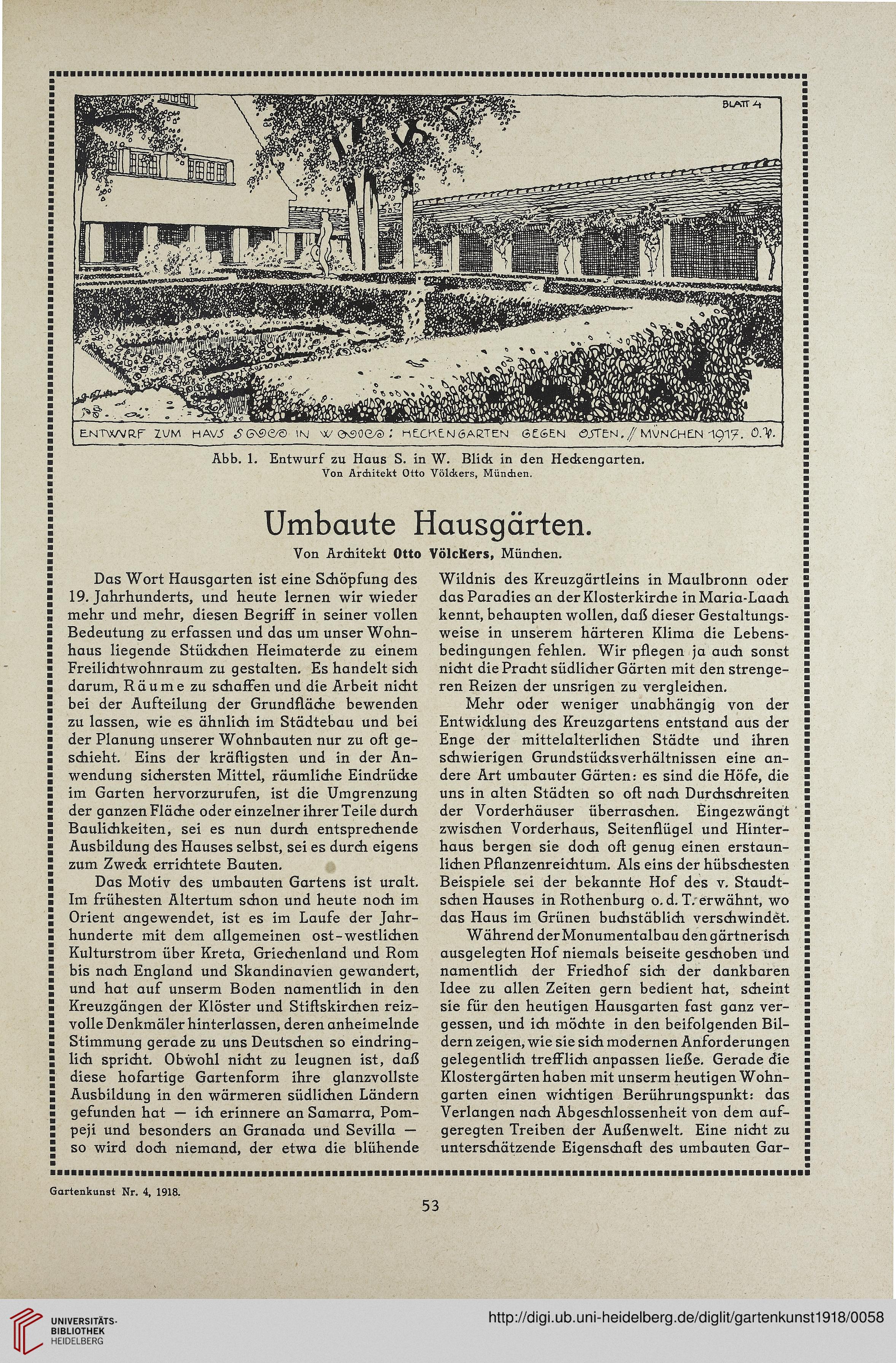Abb. 1. Entwurf zu Haus S. in W. Blick in den Heckengarten.
Von Architekt Otto Völckers, München.
Umbaute Hausgärten.
Von Architekt Otto VölcKers, München.
Das Wort Hausgarten ist eine Schöpfung des
19. Jahrhunderts, und heute lernen wir wieder
mehr und mehr, diesen Begriff in seiner vollen
Bedeutung zu erfassen und das um unser Wohn-
haus liegende Stückchen Heimaterde zu einem
Freilichtwohnraum zu gestalten. Es handelt sich
darum, Räume zu schaffen und die Arbeit nicht
bei der Aufteilung der Grundfläche bewenden
zu lassen, wie es ähnlich im Städtebau und bei
der Planung unserer Wohnbauten nur zu oft ge-
schieht. Eins der kräftigsten und in der An-
wendung sichersten Mittel, räumliche Eindrücke
im Garten hervorzurufen, ist die Umgrenzung
der ganzen Fläche oder einzelner ihrer Teile durch
Baulichkeiten, sei es nun durch entsprechende
Ausbildung des Hauses selbst, sei es durch eigens
zum Zweck errichtete Bauten.
Das Motiv des umbauten Gartens ist uralt.
Im frühesten Altertum schon und heute noch im
Orient angewendet, ist es im Laufe der Jahr-
hunderte mit dem allgemeinen ost-westlichen
Kulturstrom über Kreta, Griechenland und Rom
bis nach England und Skandinavien gewandert,
und hat auf unserm Boden namentlich in den
Kreuzgängen der Klöster und Stiftskirchen reiz-
volle Denkmäler hinterlassen, deren anheimelnde
Stimmung gerade zu uns Deutschen so eindring-
lich spricht. Obwohl nicht zu leugnen ist, daß
diese hofartige Gartenform ihre glanzvollste
Ausbildung in den wärmeren südlichen Ländern
gefunden hat — ich erinnere an Samarra, Pom-
peji und besonders an Granada und Sevilla —
so wird doch niemand, der etwa die blühende
Wildnis des Kreuzgärtleins in Maulbronn oder
das Paradies an der Klosterkirche in Maria-Laach
kennt, behaupten wollen, daß dieser Gestaltungs-
weise in unserem härteren Klima die Lebens-
bedingungen fehlen. Wir pflegen ja auch sonst
nicht die Pracht südlicher Gärten mit den strenge-
ren Reizen der unsrigen zu vergleichen.
Mehr oder weniger unabhängig von der
Entwicklung des Kreuzgartens entstand aus der
Enge der mittelalterlichen Städte und ihren
schwierigen Grundstücksverhältnissen eine an-
dere Art umbauter Gärten: es sind die Höfe, die
uns in alten Städten so oft nach Durchschreiten
der Vorderhäuser überraschen. Eingezwängt
zwischen Vorderhaus, Seitenflügel und Hinter-
haus bergen sie doch oft genug einen erstaun-
lichen Pflanzenreichtum. Als eins der hübschesten
Beispiele sei der bekannte Hof des v. Staudt-
schen Hauses in Rothenburg o. d. T. erwähnt, wo
das Haus im Grünen buchstäblich verschwindet.
Während der Monumentalbau den gärtnerisch
ausgelegten Hof niemals beiseite geschoben und
namentlich der Friedhof sich der dankbaren
Idee zu allen Zeiten gern bedient hat, scheint
sie für den heutigen Hausgarten fast ganz ver-
gessen, und ich möchte in den beifolgenden Bil-
dern zeigen, wie sie sich modernen Anforderungen
gelegentlich trefflich anpassen ließe. Gerade die
Klostergärten haben mit unserm heutigen Wohn-
garten einen wichtigen Berührungspunkt: das
Verlangen nach Abgeschlossenheit von dem auf-
geregten Treiben der Außenwelt. Eine nicht zu
unterschätzende Eigenschaft des umbauten Gar-
Gartenkunst Nr. 4, 1918.
53
Von Architekt Otto Völckers, München.
Umbaute Hausgärten.
Von Architekt Otto VölcKers, München.
Das Wort Hausgarten ist eine Schöpfung des
19. Jahrhunderts, und heute lernen wir wieder
mehr und mehr, diesen Begriff in seiner vollen
Bedeutung zu erfassen und das um unser Wohn-
haus liegende Stückchen Heimaterde zu einem
Freilichtwohnraum zu gestalten. Es handelt sich
darum, Räume zu schaffen und die Arbeit nicht
bei der Aufteilung der Grundfläche bewenden
zu lassen, wie es ähnlich im Städtebau und bei
der Planung unserer Wohnbauten nur zu oft ge-
schieht. Eins der kräftigsten und in der An-
wendung sichersten Mittel, räumliche Eindrücke
im Garten hervorzurufen, ist die Umgrenzung
der ganzen Fläche oder einzelner ihrer Teile durch
Baulichkeiten, sei es nun durch entsprechende
Ausbildung des Hauses selbst, sei es durch eigens
zum Zweck errichtete Bauten.
Das Motiv des umbauten Gartens ist uralt.
Im frühesten Altertum schon und heute noch im
Orient angewendet, ist es im Laufe der Jahr-
hunderte mit dem allgemeinen ost-westlichen
Kulturstrom über Kreta, Griechenland und Rom
bis nach England und Skandinavien gewandert,
und hat auf unserm Boden namentlich in den
Kreuzgängen der Klöster und Stiftskirchen reiz-
volle Denkmäler hinterlassen, deren anheimelnde
Stimmung gerade zu uns Deutschen so eindring-
lich spricht. Obwohl nicht zu leugnen ist, daß
diese hofartige Gartenform ihre glanzvollste
Ausbildung in den wärmeren südlichen Ländern
gefunden hat — ich erinnere an Samarra, Pom-
peji und besonders an Granada und Sevilla —
so wird doch niemand, der etwa die blühende
Wildnis des Kreuzgärtleins in Maulbronn oder
das Paradies an der Klosterkirche in Maria-Laach
kennt, behaupten wollen, daß dieser Gestaltungs-
weise in unserem härteren Klima die Lebens-
bedingungen fehlen. Wir pflegen ja auch sonst
nicht die Pracht südlicher Gärten mit den strenge-
ren Reizen der unsrigen zu vergleichen.
Mehr oder weniger unabhängig von der
Entwicklung des Kreuzgartens entstand aus der
Enge der mittelalterlichen Städte und ihren
schwierigen Grundstücksverhältnissen eine an-
dere Art umbauter Gärten: es sind die Höfe, die
uns in alten Städten so oft nach Durchschreiten
der Vorderhäuser überraschen. Eingezwängt
zwischen Vorderhaus, Seitenflügel und Hinter-
haus bergen sie doch oft genug einen erstaun-
lichen Pflanzenreichtum. Als eins der hübschesten
Beispiele sei der bekannte Hof des v. Staudt-
schen Hauses in Rothenburg o. d. T. erwähnt, wo
das Haus im Grünen buchstäblich verschwindet.
Während der Monumentalbau den gärtnerisch
ausgelegten Hof niemals beiseite geschoben und
namentlich der Friedhof sich der dankbaren
Idee zu allen Zeiten gern bedient hat, scheint
sie für den heutigen Hausgarten fast ganz ver-
gessen, und ich möchte in den beifolgenden Bil-
dern zeigen, wie sie sich modernen Anforderungen
gelegentlich trefflich anpassen ließe. Gerade die
Klostergärten haben mit unserm heutigen Wohn-
garten einen wichtigen Berührungspunkt: das
Verlangen nach Abgeschlossenheit von dem auf-
geregten Treiben der Außenwelt. Eine nicht zu
unterschätzende Eigenschaft des umbauten Gar-
Gartenkunst Nr. 4, 1918.
53