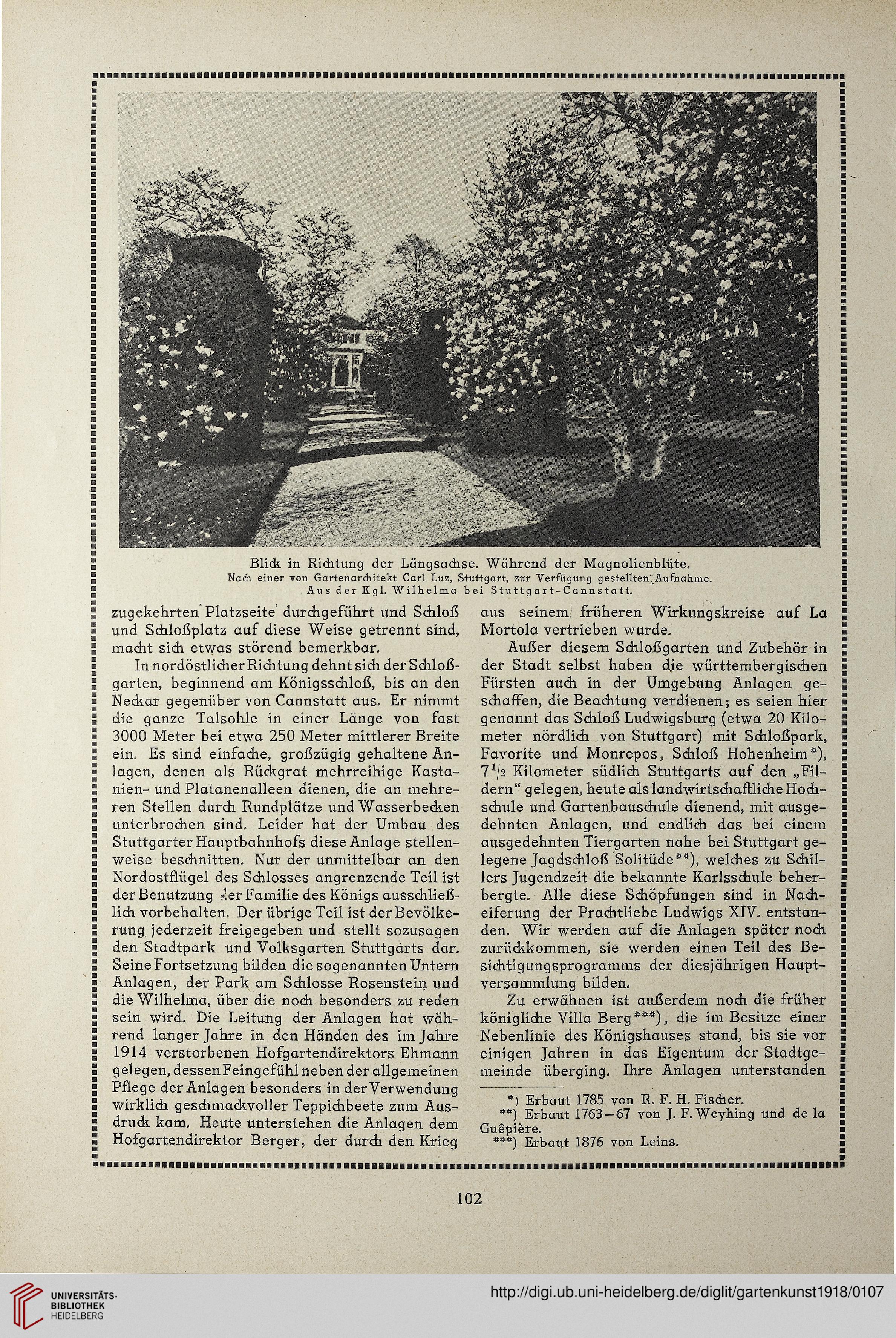Blick in Richtung der Längsachse. Während der Magnolienblüte.
Nadi einer von Gartenarchitekt Carl Luz, Stuttgart, zur Verfügung gestellten^Aufnahme.
Aus der Kgl. Wilhelma bei Stuttgart-Cannstatt.
zugekehrten Platzseite durchgeführt und Schloß
und Schloßplatz auf diese Weise getrennt sind,
macht sich etwas störend bemerkbar.
In nordöstlicher Richtung dehnt sich der Schloß-
garten, beginnend am Königsschloß, bis an den
Neckar gegenüber von Cannstatt aus. Er nimmt
die ganze Talsohle in einer Länge von fast
3000 Meter bei etwa 250 Meter mittlerer Breite
ein. Es sind einfache, großzügig gehaltene An-
lagen, denen als Rückgrat mehrreihige Kasta-
nien- und Platanenalleen dienen, die an mehre-
ren Stellen durch Rundplätze und Wasserbecken
unterbrochen sind. Leider hat der Umbau des
Stuttgarter Hauptbahnhofs diese Anlage stellen-
weise beschnitten. Nur der unmittelbar an den
Nordostflügel des Schlosses angrenzende Teil ist
der Benutzung -.er Familie des Königs ausschließ-
lich Vorbehalten. Der übrige Teil ist der Bevölke-
rung jederzeit freigegeben und stellt sozusagen
den Stadtpark und Volksgarten Stuttgarts dar.
Seine Fortsetzung bilden die sogenannten Untern
Anlagen, der Park am Schlosse Rosenstein und
die Wilhelma, über die noch besonders zu reden
sein wird. Die Leitung der Anlagen hat wäh-
rend langer Jahre in den Händen des im Jahre
1914 verstorbenen Hofgartendirektors Ehmann
gelegen, dessenFeingefühl neben der allgemeinen
Pflege der Anlagen besonders in der Verwendung
wirklich geschmackvoller Teppichbeete zum Aus-
druck kam. Heute unterstehen die Anlagen dem
Hofgartendirektor Berger, der durch den Krieg
aus seinem; früheren Wirkungskreise auf La
Mortola vertrieben wurde.
Außer diesem Schloßgarten und Zubehör in
der Stadt selbst haben die württembergischen
Fürsten auch in der Umgebung Anlagen ge-
schaffen, die Beachtung verdienen; es seien hier
genannt das Schloß Ludwigsburg (etwa 20 Kilo-
meter nördlich von Stuttgart) mit Schloßpark,
Favorite und Monrepos, Schloß Hohenheim4),
71/2 Kilometer südlich Stuttgarts auf den „Fil-
dern“ gelegen, heute als landwirtschaftliche Hoch-
schule und Gartenbauschule dienend, mit ausge-
dehnten Anlagen, und endlich das bei einem
ausgedehnten Tiergarten nahe bei Stuttgart ge-
legene Jagdschloß Solitüde44), welches zu Schil-
lers Jugendzeit die bekannte Karlsschule beher-
bergte. Alle diese Schöpfungen sind in Nach-
eiferung der Prachtliebe Ludwigs XIV. entstan-
den. Wir werden auf die Anlagen später noch
zurückkommen, sie werden einen Teil des Be-
sichtigungsprogramms der diesjährigen Haupt-
versammlung bilden.
Zu erwähnen ist außerdem noch die früher
königliche Villa Berg 444), die im Besitze einer
Nebenlinie des Königshauses stand, bis sie vor
einigen Jahren in das Eigentum der Stadtge-
meinde überging. Ihre Anlagen unterstanden *) * ***)
*) Erbaut 1785 von R. F. H. Fischer.
44) Erbaut 1763 — 67 von J. F. Weyhing und de la
Guepiere.
***) Erbaut 1876 von Leins.
102
Nadi einer von Gartenarchitekt Carl Luz, Stuttgart, zur Verfügung gestellten^Aufnahme.
Aus der Kgl. Wilhelma bei Stuttgart-Cannstatt.
zugekehrten Platzseite durchgeführt und Schloß
und Schloßplatz auf diese Weise getrennt sind,
macht sich etwas störend bemerkbar.
In nordöstlicher Richtung dehnt sich der Schloß-
garten, beginnend am Königsschloß, bis an den
Neckar gegenüber von Cannstatt aus. Er nimmt
die ganze Talsohle in einer Länge von fast
3000 Meter bei etwa 250 Meter mittlerer Breite
ein. Es sind einfache, großzügig gehaltene An-
lagen, denen als Rückgrat mehrreihige Kasta-
nien- und Platanenalleen dienen, die an mehre-
ren Stellen durch Rundplätze und Wasserbecken
unterbrochen sind. Leider hat der Umbau des
Stuttgarter Hauptbahnhofs diese Anlage stellen-
weise beschnitten. Nur der unmittelbar an den
Nordostflügel des Schlosses angrenzende Teil ist
der Benutzung -.er Familie des Königs ausschließ-
lich Vorbehalten. Der übrige Teil ist der Bevölke-
rung jederzeit freigegeben und stellt sozusagen
den Stadtpark und Volksgarten Stuttgarts dar.
Seine Fortsetzung bilden die sogenannten Untern
Anlagen, der Park am Schlosse Rosenstein und
die Wilhelma, über die noch besonders zu reden
sein wird. Die Leitung der Anlagen hat wäh-
rend langer Jahre in den Händen des im Jahre
1914 verstorbenen Hofgartendirektors Ehmann
gelegen, dessenFeingefühl neben der allgemeinen
Pflege der Anlagen besonders in der Verwendung
wirklich geschmackvoller Teppichbeete zum Aus-
druck kam. Heute unterstehen die Anlagen dem
Hofgartendirektor Berger, der durch den Krieg
aus seinem; früheren Wirkungskreise auf La
Mortola vertrieben wurde.
Außer diesem Schloßgarten und Zubehör in
der Stadt selbst haben die württembergischen
Fürsten auch in der Umgebung Anlagen ge-
schaffen, die Beachtung verdienen; es seien hier
genannt das Schloß Ludwigsburg (etwa 20 Kilo-
meter nördlich von Stuttgart) mit Schloßpark,
Favorite und Monrepos, Schloß Hohenheim4),
71/2 Kilometer südlich Stuttgarts auf den „Fil-
dern“ gelegen, heute als landwirtschaftliche Hoch-
schule und Gartenbauschule dienend, mit ausge-
dehnten Anlagen, und endlich das bei einem
ausgedehnten Tiergarten nahe bei Stuttgart ge-
legene Jagdschloß Solitüde44), welches zu Schil-
lers Jugendzeit die bekannte Karlsschule beher-
bergte. Alle diese Schöpfungen sind in Nach-
eiferung der Prachtliebe Ludwigs XIV. entstan-
den. Wir werden auf die Anlagen später noch
zurückkommen, sie werden einen Teil des Be-
sichtigungsprogramms der diesjährigen Haupt-
versammlung bilden.
Zu erwähnen ist außerdem noch die früher
königliche Villa Berg 444), die im Besitze einer
Nebenlinie des Königshauses stand, bis sie vor
einigen Jahren in das Eigentum der Stadtge-
meinde überging. Ihre Anlagen unterstanden *) * ***)
*) Erbaut 1785 von R. F. H. Fischer.
44) Erbaut 1763 — 67 von J. F. Weyhing und de la
Guepiere.
***) Erbaut 1876 von Leins.
102