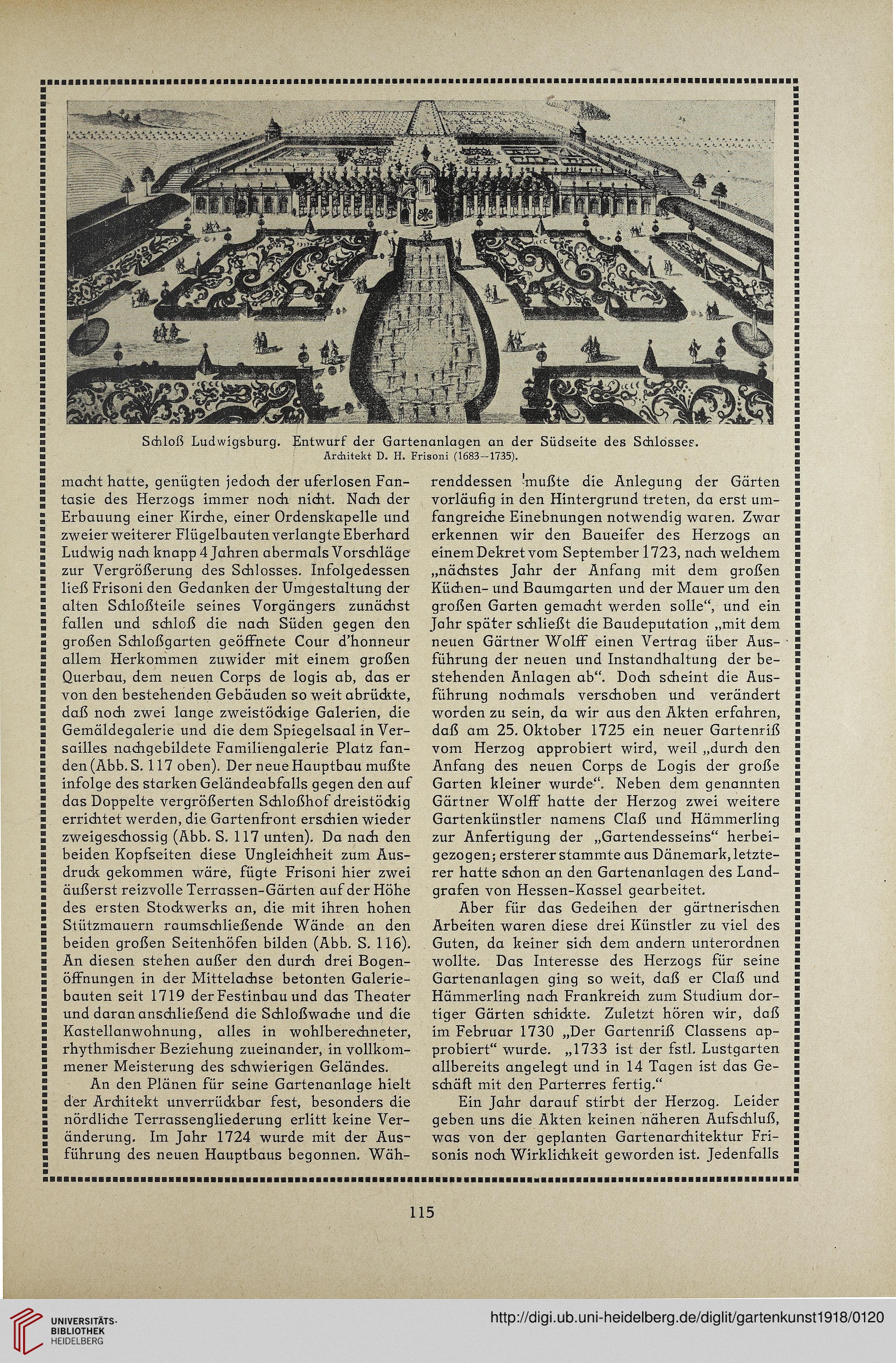Sdiloß Ludwigsburg. Entwurf der Gartenanlagen an der Südseite des Schlosses.
Architekt D. H. Frisoni (1683 — 1735).
macht hatte, genügten jedoch der uferlosen Fan-
tasie des Herzogs immer noch nicht. Nach der
Erbauung einer Kirche, einer Ordenskapelle und
zweier weiterer Flügelbauten verlangte Eberhard
Ludwig nach knapp 4 Jahren abermals Vorschläge
zur Vergrößerung des Schlosses. Infolgedessen
ließ Frisoni den Gedanken der Umgestaltung der
alten Schloßteile seines Vorgängers zunächst
fallen und schloß die nach Süden gegen den
großen Schloßgarten geöffnete Cour d’honneur
allem Herkommen zuwider mit einem großen
Querbau, dem neuen Corps de logis ab, das er
von den bestehenden Gebäuden so weit abrückte,
daß noch zwei lange zweistöckige Galerien, die
Gemäldegalerie und die dem Spiegelsaal in Ver-
sailles nachgebildete Familiengalerie Platz fan-
den (Abb.S. 117 oben). Der neue Hauptbau mußte
infolge des starken Geländeabfalls gegen den auf
das Doppelte vergrößerten Schloßhof dreistöckig
errichtet werden, die Gartenfront erschien wieder
zweigeschossig (Abb. S. 117 unten). Da nach den
beiden Kopfseiten diese Ungleichheit zum Aus-
druck gekommen wäre, fügte Frisoni hier zwei
äußerst reizvolle Terrassen-Gärten auf der Höhe
des ersten Stockwerks an, die mit ihren hohen
Stützmauern raumschließende Wände an den
beiden großen Seitenhöfen bilden (Abb. S. 116).
An diesen stehen außer den durch drei Bogen-
öffnungen in der Mittelachse betonten Galerie-
bauten seit 1719 der Festinbau und das Theater
und daran anschließend die Schloßwache und die
Kastellanwohnung, alles in wohlberechneter,
rhythmischer Beziehung zueinander, in vollkom-
mener Meisterung des schwierigen Geländes.
An den Plänen für seine Gartenanlage hielt
der Architekt unverrückbar fest, besonders die
nördliche Terrassengliederung erlitt keine Ver-
änderung. Im Jahr 1724 wurde mit der Aus-
führung des neuen Hauptbaus begonnen. Wäh-
renddessen 'mußte die Anlegung der Gärten
vorläufig in den Hintergrund treten, da erst um-
fangreiche Einebnungen notwendig waren. Zwar
erkennen wir den Baueifer des Herzogs an
einem Dekret vom September 1723, nach welchem
„nächstes Jahr der Anfang mit dem großen
Küchen- und Baumgarten und der Mauer um den
großen Garten gemacht werden solle“, und ein
Jahr später schließt die Baudeputation „mit dem
neuen Gärtner Wolff einen Vertrag über Aus-
führung der neuen und Instandhaltung der be-
stehenden Anlagen ab“. Doch scheint die Aus-
führung nochmals verschoben und verändert
worden zu sein, da wir aus den Akten erfahren,
daß am 25. Oktober 1725 ein neuer Gartenriß
vom Herzog approbiert wird, weil „durch den
Anfang des neuen Corps de Logis der große
Garten kleiner wurde“. Neben dem genannten
Gärtner Wolff hatte der Herzog zwei weitere
Gartenkünstler namens Claß und Hämmerling
zur Anfertigung der „Gartendesseins“ herbei-
gezogen; ersterer stammte aus Dänemark, letzte-
rer hatte schon an den Gartenanlagen des Land-
grafen von Hessen-Kassel gearbeitet.
Aber für das Gedeihen der gärtnerischen
Arbeiten waren diese drei Künstler zu viel des
Guten, da keiner sich dem andern unterordnen
wollte. Das Interesse des Herzogs für seine
Gartenanlagen ging so weit, daß er Claß und
Hämmerling nach Frankreich zum Studium dor-
tiger Gärten schickte. Zuletzt hören wir, daß
im Februar 1730 „Der Gartenriß Classens ap-
probiert“ wurde. „1733 ist der fstl. Lustgarten
allbereits angelegt und in 14 Tagen ist das Ge-
schäft mit den Parterres fertig.“
Ein Jahr darauf stirbt der Herzog. Leider
geben uns die Akten keinen näheren Aufschluß,
was von der geplanten Gartenarchitektur Fri-
sonis noch Wirklichkeit geworden ist. Jedenfalls
115
Architekt D. H. Frisoni (1683 — 1735).
macht hatte, genügten jedoch der uferlosen Fan-
tasie des Herzogs immer noch nicht. Nach der
Erbauung einer Kirche, einer Ordenskapelle und
zweier weiterer Flügelbauten verlangte Eberhard
Ludwig nach knapp 4 Jahren abermals Vorschläge
zur Vergrößerung des Schlosses. Infolgedessen
ließ Frisoni den Gedanken der Umgestaltung der
alten Schloßteile seines Vorgängers zunächst
fallen und schloß die nach Süden gegen den
großen Schloßgarten geöffnete Cour d’honneur
allem Herkommen zuwider mit einem großen
Querbau, dem neuen Corps de logis ab, das er
von den bestehenden Gebäuden so weit abrückte,
daß noch zwei lange zweistöckige Galerien, die
Gemäldegalerie und die dem Spiegelsaal in Ver-
sailles nachgebildete Familiengalerie Platz fan-
den (Abb.S. 117 oben). Der neue Hauptbau mußte
infolge des starken Geländeabfalls gegen den auf
das Doppelte vergrößerten Schloßhof dreistöckig
errichtet werden, die Gartenfront erschien wieder
zweigeschossig (Abb. S. 117 unten). Da nach den
beiden Kopfseiten diese Ungleichheit zum Aus-
druck gekommen wäre, fügte Frisoni hier zwei
äußerst reizvolle Terrassen-Gärten auf der Höhe
des ersten Stockwerks an, die mit ihren hohen
Stützmauern raumschließende Wände an den
beiden großen Seitenhöfen bilden (Abb. S. 116).
An diesen stehen außer den durch drei Bogen-
öffnungen in der Mittelachse betonten Galerie-
bauten seit 1719 der Festinbau und das Theater
und daran anschließend die Schloßwache und die
Kastellanwohnung, alles in wohlberechneter,
rhythmischer Beziehung zueinander, in vollkom-
mener Meisterung des schwierigen Geländes.
An den Plänen für seine Gartenanlage hielt
der Architekt unverrückbar fest, besonders die
nördliche Terrassengliederung erlitt keine Ver-
änderung. Im Jahr 1724 wurde mit der Aus-
führung des neuen Hauptbaus begonnen. Wäh-
renddessen 'mußte die Anlegung der Gärten
vorläufig in den Hintergrund treten, da erst um-
fangreiche Einebnungen notwendig waren. Zwar
erkennen wir den Baueifer des Herzogs an
einem Dekret vom September 1723, nach welchem
„nächstes Jahr der Anfang mit dem großen
Küchen- und Baumgarten und der Mauer um den
großen Garten gemacht werden solle“, und ein
Jahr später schließt die Baudeputation „mit dem
neuen Gärtner Wolff einen Vertrag über Aus-
führung der neuen und Instandhaltung der be-
stehenden Anlagen ab“. Doch scheint die Aus-
führung nochmals verschoben und verändert
worden zu sein, da wir aus den Akten erfahren,
daß am 25. Oktober 1725 ein neuer Gartenriß
vom Herzog approbiert wird, weil „durch den
Anfang des neuen Corps de Logis der große
Garten kleiner wurde“. Neben dem genannten
Gärtner Wolff hatte der Herzog zwei weitere
Gartenkünstler namens Claß und Hämmerling
zur Anfertigung der „Gartendesseins“ herbei-
gezogen; ersterer stammte aus Dänemark, letzte-
rer hatte schon an den Gartenanlagen des Land-
grafen von Hessen-Kassel gearbeitet.
Aber für das Gedeihen der gärtnerischen
Arbeiten waren diese drei Künstler zu viel des
Guten, da keiner sich dem andern unterordnen
wollte. Das Interesse des Herzogs für seine
Gartenanlagen ging so weit, daß er Claß und
Hämmerling nach Frankreich zum Studium dor-
tiger Gärten schickte. Zuletzt hören wir, daß
im Februar 1730 „Der Gartenriß Classens ap-
probiert“ wurde. „1733 ist der fstl. Lustgarten
allbereits angelegt und in 14 Tagen ist das Ge-
schäft mit den Parterres fertig.“
Ein Jahr darauf stirbt der Herzog. Leider
geben uns die Akten keinen näheren Aufschluß,
was von der geplanten Gartenarchitektur Fri-
sonis noch Wirklichkeit geworden ist. Jedenfalls
115