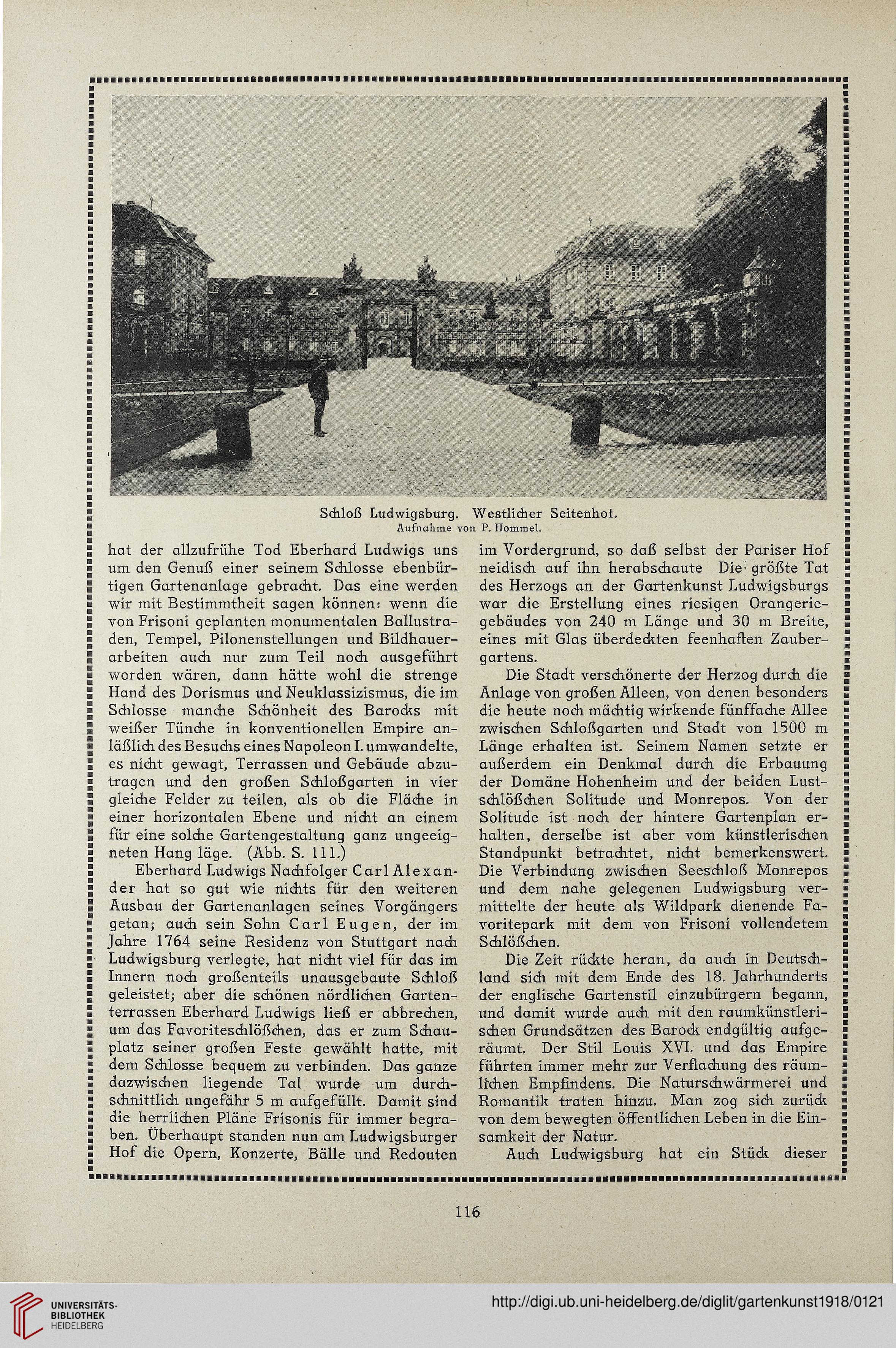Schloß Ludwigsburg. Westlicher Seitenhot.
Aufnahme von P. Hommel.
hat der allzufrühe Tod Eberhard Ludwigs uns
um den Genuß einer seinem Schlosse ebenbür-
tigen Gartenanlage gebracht. Das eine werden
wir mit Bestimmtheit sagen können: wenn die
von Frisoni geplanten monumentalen Ballustra-
den, Tempel, Pilonenstellungen und Bildhauer-
arbeiten auch nur zum Teil noch ausgeführt
worden wären, dann hätte wohl die strenge
Hand des Dorismus und Neuklassizismus, die im
Schlosse manche Schönheit des Barocks mit
weißer Tünche in konventionellen Empire an-
läßlich des Besuchs eines Napoleon I. umwandelte,
es nicht gewagt, Terrassen und Gebäude abzu-
tragen und den großen Schloßgarten in vier
gleiche Felder zu teilen, als ob die Fläche in
einer horizontalen Ebene und nicht an einem
für eine solche Gartengestaltung ganz ungeeig-
neten Hang läge. (Abb. S. 111.)
Eberhard Ludwigs Nachfolger Carl Alexan-
der hat so gut wie nichts für den weiteren
Ausbau der Gartenanlagen seines Vorgängers
getan; auch sein Sohn Carl Eugen, der im
Jahre 1764 seine Residenz von Stuttgart nach
Ludwigsburg verlegte, hat nicht viel für das im
Innern noch großenteils unausgebaute Schloß
geleistet; aber die schönen nördlichen Garten-
terrassen Eberhard Ludwigs ließ er abbrechen,
um das Favoriteschlößchen, das er zum Schau-
platz seiner großen Feste gewählt hatte, mit
dem Schlosse bequem zu verbinden. Das ganze
dazwischen liegende Tal wurde um durch-
schnittlich ungefähr 5 m aufgefüllt. Damit sind
die herrlichen Pläne Frisonis für immer begra-
ben. Überhaupt standen nun am Ludwigsburger
Hof die Opern, Konzerte, Bälle und Redouten
im Vordergrund, so daß selbst der Pariser Hof
neidisch auf ihn herabschaute Die größte Tat
des Herzogs an der Gartenkunst Ludwigsburgs
war die Erstellung eines riesigen Orangerie-
gebäudes von 240 m Länge und 30 m Breite,
eines mit Glas überdeckten feenhaften Zauber-
gartens.
Die Stadt verschönerte der Herzog durch die
Anlage von großen Alleen, von denen besonders
die heute noch mächtig wirkende fünffache Allee
zwischen Schloßgarten und Stadt von 1500 m
Länge erhalten ist. Seinem Namen setzte er
außerdem ein Denkmal durch die Erbauung
der Domäne Hohenheim und der beiden Lust-
schlößchen Solitude und Monrepos. Von der
Solitude ist noch der hintere Gartenplan er-
halten, derselbe ist aber vom künstlerischen
Standpunkt betrachtet, nicht bemerkenswert.
Die Verbindung zwischen Seeschloß Monrepos
und dem nahe gelegenen Ludwigsburg ver-
mittelte der heute als Wildpark dienende Fa-
voritepark mit dem von Frisoni vollendetem
Schlößchen.
Die Zeit rückte heran, da auch in Deutsch-
land sich mit dem Ende des 18. Jahrhunderts
der englische Gartenstil einzubürgern begann,
und damit wurde auch mit den raumkünstleri-
schen Grundsätzen des Barock endgültig aufge-
räumt. Der Stil Louis XVI. und das Empire
führten immer mehr zur Verflachung des räum-
lichen Empfindens. Die Naturschwärmerei und
Romantik traten hinzu. Man zog sich zurück
von dem bewegten öffentlichen Leben in die Ein-
samkeit der Natur.
Audi Ludwigsburg hat ein Stück dieser
116
Aufnahme von P. Hommel.
hat der allzufrühe Tod Eberhard Ludwigs uns
um den Genuß einer seinem Schlosse ebenbür-
tigen Gartenanlage gebracht. Das eine werden
wir mit Bestimmtheit sagen können: wenn die
von Frisoni geplanten monumentalen Ballustra-
den, Tempel, Pilonenstellungen und Bildhauer-
arbeiten auch nur zum Teil noch ausgeführt
worden wären, dann hätte wohl die strenge
Hand des Dorismus und Neuklassizismus, die im
Schlosse manche Schönheit des Barocks mit
weißer Tünche in konventionellen Empire an-
läßlich des Besuchs eines Napoleon I. umwandelte,
es nicht gewagt, Terrassen und Gebäude abzu-
tragen und den großen Schloßgarten in vier
gleiche Felder zu teilen, als ob die Fläche in
einer horizontalen Ebene und nicht an einem
für eine solche Gartengestaltung ganz ungeeig-
neten Hang läge. (Abb. S. 111.)
Eberhard Ludwigs Nachfolger Carl Alexan-
der hat so gut wie nichts für den weiteren
Ausbau der Gartenanlagen seines Vorgängers
getan; auch sein Sohn Carl Eugen, der im
Jahre 1764 seine Residenz von Stuttgart nach
Ludwigsburg verlegte, hat nicht viel für das im
Innern noch großenteils unausgebaute Schloß
geleistet; aber die schönen nördlichen Garten-
terrassen Eberhard Ludwigs ließ er abbrechen,
um das Favoriteschlößchen, das er zum Schau-
platz seiner großen Feste gewählt hatte, mit
dem Schlosse bequem zu verbinden. Das ganze
dazwischen liegende Tal wurde um durch-
schnittlich ungefähr 5 m aufgefüllt. Damit sind
die herrlichen Pläne Frisonis für immer begra-
ben. Überhaupt standen nun am Ludwigsburger
Hof die Opern, Konzerte, Bälle und Redouten
im Vordergrund, so daß selbst der Pariser Hof
neidisch auf ihn herabschaute Die größte Tat
des Herzogs an der Gartenkunst Ludwigsburgs
war die Erstellung eines riesigen Orangerie-
gebäudes von 240 m Länge und 30 m Breite,
eines mit Glas überdeckten feenhaften Zauber-
gartens.
Die Stadt verschönerte der Herzog durch die
Anlage von großen Alleen, von denen besonders
die heute noch mächtig wirkende fünffache Allee
zwischen Schloßgarten und Stadt von 1500 m
Länge erhalten ist. Seinem Namen setzte er
außerdem ein Denkmal durch die Erbauung
der Domäne Hohenheim und der beiden Lust-
schlößchen Solitude und Monrepos. Von der
Solitude ist noch der hintere Gartenplan er-
halten, derselbe ist aber vom künstlerischen
Standpunkt betrachtet, nicht bemerkenswert.
Die Verbindung zwischen Seeschloß Monrepos
und dem nahe gelegenen Ludwigsburg ver-
mittelte der heute als Wildpark dienende Fa-
voritepark mit dem von Frisoni vollendetem
Schlößchen.
Die Zeit rückte heran, da auch in Deutsch-
land sich mit dem Ende des 18. Jahrhunderts
der englische Gartenstil einzubürgern begann,
und damit wurde auch mit den raumkünstleri-
schen Grundsätzen des Barock endgültig aufge-
räumt. Der Stil Louis XVI. und das Empire
führten immer mehr zur Verflachung des räum-
lichen Empfindens. Die Naturschwärmerei und
Romantik traten hinzu. Man zog sich zurück
von dem bewegten öffentlichen Leben in die Ein-
samkeit der Natur.
Audi Ludwigsburg hat ein Stück dieser
116