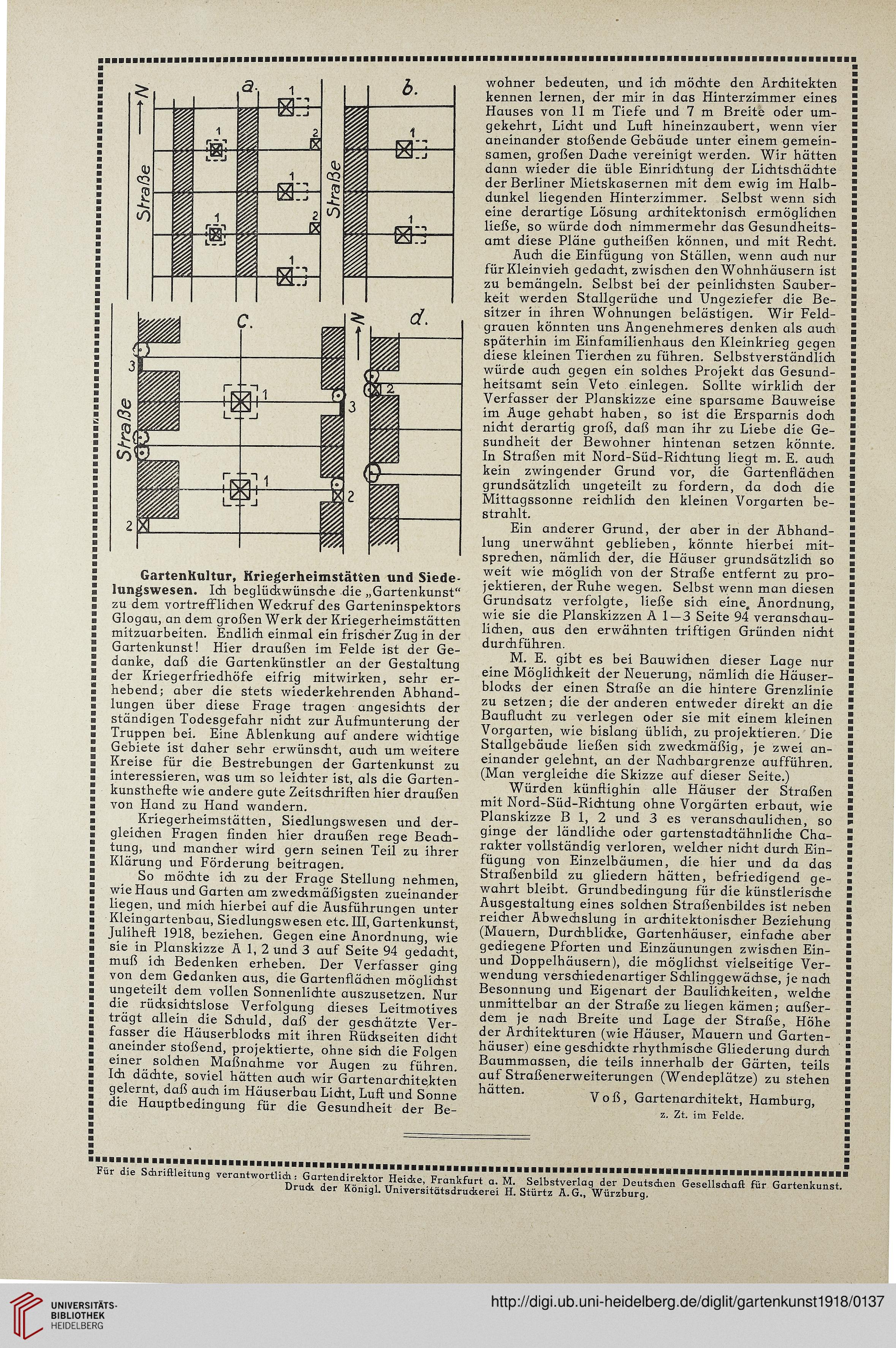GartenKultur, Kriegerheimstätten und Siede-
lungswesen. Ich beglückwünsche die „Gartenkunst“
zu dem vortrefflichen Weckruf des Garteninspektors
Glogau, an dem großen Werk der Kriegerheimstätten
mitzuarbeiten. Endlich einmal ein frischer Zug in der
Gartenkunst! Hier draußen im Felde ist der Ge-
danke, daß die Gartenkünstler an der Gestaltung
der Kriegerfriedhöfe eifrig mitwirken, sehr er-
hebend; aber die stets wiederkehrenden Abhand-
lungen über diese Frage tragen angesichts der
ständigen Todesgefahr nicht zur Aufmunterung der
Truppen bei. Eine Ablenkung auf andere wichtige
Gebiete ist daher sehr erwünscht, auch um weitere
Kreise für die Bestrebungen der Gartenkunst zu
interessieren, was um so leichter ist, als die Garten-
kunsthefte wie andere gute Zeitschriften hier draußen
von Hand zu Hand wandern.
Kriegerheimstätten, Siedlungswesen und der-
gleichen Fragen finden hier draußen rege Beach-
tung, und mancher wird gern seinen Teil zu ihrer
Klärung und Förderung beitragen.
So möchte ich zu der Frage Stellung nehmen,
wie Haus und Garten am zwedcmäßigsten zueinander
liegen, und mich hierbei auf die Ausführungen unter
Kleingartenbau, Siedlungswesen etc. IH, Gartenkunst,
Juliheft 1918, beziehen. Gegen eine Anordnung, wie
sie in Planskizze A 1, 2 und 3 auf Seite 94 gedacht,
muß ich Bedenken erheben. Der Verfasser ging
von dem Gedanken aus, die Gartenflächen möglichst
ungeteilt dem vollen Sonnenlichte auszusetzen. Nur
die rücksichtslose Verfolgung dieses Leitmotives
trägt allein die Schuld, daß der geschätzte Ver-
fasser die Häuserblocks mit ihren Rückseiten dicht
aneinder stoßend, projektierte, ohne sich die Folgen
einer solchen Maßnahme vor Augen zu führen.
Ich dächte, soviel hätten auch wir Gartenarchitekten
gelernt, daß auch im Häuserbau Licht, Luft und Sonne
die Hauptbedingung für die Gesundheit der Be-
wohner bedeuten, und ich möchte den Architekten
kennen lernen, der mir in das Hinterzimmer eines
Hauses von 11 m Tiefe und 7 m Breite oder um-
gekehrt, Licht und Luft hineinzaubert, wenn vier
aneinander stoßende Gebäude unter einem gemein-
samen, großen Dache vereinigt werden. Wir hätten
dann wieder die üble Einrichtung der Lichtschächte
der Berliner Mietskasernen mit dem ewig im Halb-
dunkel liegenden Hinterzimmer. Selbst wenn sich
eine derartige Lösung architektonisch ermöglichen
ließe, so würde doch nimmermehr das Gesundheits-
amt diese Pläne gutheißen können, und mit Recht.
Auch die Einfügung von Ställen, wenn auch nur
für Kleinvieh gedacht, zwischen den Wohnhäusern ist
zu bemängeln. Selbst bei der peinlichsten Sauber-
keit werden Stallgerüche und Ungeziefer die Be-
sitzer in ihren Wohnungen belästigen. Wir Feld-
grauen könnten uns Angenehmeres denken als auch
späterhin im Einfamilienhaus den Kleinkrieg gegen
diese kleinen Tierchen zu führen. Selbstverständlich
würde auch gegen ein solches Projekt das Gesund-
heitsamt sein Veto einlegen. Sollte wirklich der
Verfasser der Planskizze eine sparsame Bauweise
im Auge gehabt haben, so ist die Ersparnis doch
nicht derartig groß, daß man ihr zu Liebe die Ge-
sundheit der Bewohner hintenan setzen könnte.
In Straßen mit Nord-Süd-Richtung liegt m. E. auch
kein zwingender Grund vor, die Gartenflächen
grundsätzlich ungeteilt zu fordern, da doch die
Mittagssonne reichlich den kleinen Vorgarten be-
strahlt.
Ein anderer Grund, der aber in der Abhand-
lung unerwähnt geblieben, könnte hierbei mit-
sprechen, nämlich der, die Häuser grundsätzlich so
weit wie möglich von der Straße entfernt zu pro-
jektieren, der Ruhe wegen. Selbst wenn man diesen
Grundsatz verfolgte, ließe sich eine, Anordnung,
wie sie die Planskizzen A 1 —3 Seite 94 veranschau-
lichen, aus den erwähnten triftigen Gründen nicht
durchführen.
M. E. gibt es bei Bauwichen dieser Lage nur
eine Möglichkeit der Neuerung, nämlich die Häuser-
blodts der einen Straße an die hintere Grenzlinie
zu setzen; die der anderen entweder direkt an die
Bauflucht zu verlegen oder sie mit einem kleinen
Vorgarten, wie bislang üblich, zu projektieren, Die
Stallgebäude ließen sich zweckmäßig, je zwei an-
einander gelehnt, an der Nahbargrenze aufführen.
(Man vergleiche die Skizze auf dieser Seite.)
Würden künftighin alle Häuser der Straßen
mit Nord-Süd-Richtung ohne Vorgärten erbaut, wie
Planskizze B 1, 2 und 3 es veranschaulichen, so
ginge der ländliche oder gartenstadtähnliche Cha-
rakter vollständig verloren, welcher nicht durch Ein-
fügung von Einzelbäumen, die hier und da das
Straßenbild zu gliedern hätten, befriedigend ge-
wahrt bleibt. Grundbedingung für die künstlerische
Ausgestaltung eines solchen Straßenbildes ist neben
reicher Abwechslung in architektonischer Beziehung
(Mauern, Durchblicke, Gartenhäuser, einfache aber
gediegene Pforten und Einzäunungen zwischen Ein-
und Doppelhäusern), die möglichst vielseitige Ver-
wendung verschiedenartiger Schlinggewächse, je nach
Besonnung und Eigenart der Baulichkeiten, welche
unmittelbar an der Straße zu liegen kämen; außer-
dem je nach Breite und Lage der Straße, Höhe
der Architekturen (wie Häuser, Mauern und Garten-
häuser) eine geschickte rhythmische Gliederung durch
Baummassen, die teils innerhalb der Gärten, teils
auf Straßenerweiterungen (Wendeplätze) zu stehen
hätten. Voß, Gartenarchitekt, Hamburg,
z. Zt. im Felde.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen""esel"lsÄaft"fär"Gartenkunst.
Druck der Königl. Universitätsdrudierei H. Stürtz A. G., Würzburg.
lungswesen. Ich beglückwünsche die „Gartenkunst“
zu dem vortrefflichen Weckruf des Garteninspektors
Glogau, an dem großen Werk der Kriegerheimstätten
mitzuarbeiten. Endlich einmal ein frischer Zug in der
Gartenkunst! Hier draußen im Felde ist der Ge-
danke, daß die Gartenkünstler an der Gestaltung
der Kriegerfriedhöfe eifrig mitwirken, sehr er-
hebend; aber die stets wiederkehrenden Abhand-
lungen über diese Frage tragen angesichts der
ständigen Todesgefahr nicht zur Aufmunterung der
Truppen bei. Eine Ablenkung auf andere wichtige
Gebiete ist daher sehr erwünscht, auch um weitere
Kreise für die Bestrebungen der Gartenkunst zu
interessieren, was um so leichter ist, als die Garten-
kunsthefte wie andere gute Zeitschriften hier draußen
von Hand zu Hand wandern.
Kriegerheimstätten, Siedlungswesen und der-
gleichen Fragen finden hier draußen rege Beach-
tung, und mancher wird gern seinen Teil zu ihrer
Klärung und Förderung beitragen.
So möchte ich zu der Frage Stellung nehmen,
wie Haus und Garten am zwedcmäßigsten zueinander
liegen, und mich hierbei auf die Ausführungen unter
Kleingartenbau, Siedlungswesen etc. IH, Gartenkunst,
Juliheft 1918, beziehen. Gegen eine Anordnung, wie
sie in Planskizze A 1, 2 und 3 auf Seite 94 gedacht,
muß ich Bedenken erheben. Der Verfasser ging
von dem Gedanken aus, die Gartenflächen möglichst
ungeteilt dem vollen Sonnenlichte auszusetzen. Nur
die rücksichtslose Verfolgung dieses Leitmotives
trägt allein die Schuld, daß der geschätzte Ver-
fasser die Häuserblocks mit ihren Rückseiten dicht
aneinder stoßend, projektierte, ohne sich die Folgen
einer solchen Maßnahme vor Augen zu führen.
Ich dächte, soviel hätten auch wir Gartenarchitekten
gelernt, daß auch im Häuserbau Licht, Luft und Sonne
die Hauptbedingung für die Gesundheit der Be-
wohner bedeuten, und ich möchte den Architekten
kennen lernen, der mir in das Hinterzimmer eines
Hauses von 11 m Tiefe und 7 m Breite oder um-
gekehrt, Licht und Luft hineinzaubert, wenn vier
aneinander stoßende Gebäude unter einem gemein-
samen, großen Dache vereinigt werden. Wir hätten
dann wieder die üble Einrichtung der Lichtschächte
der Berliner Mietskasernen mit dem ewig im Halb-
dunkel liegenden Hinterzimmer. Selbst wenn sich
eine derartige Lösung architektonisch ermöglichen
ließe, so würde doch nimmermehr das Gesundheits-
amt diese Pläne gutheißen können, und mit Recht.
Auch die Einfügung von Ställen, wenn auch nur
für Kleinvieh gedacht, zwischen den Wohnhäusern ist
zu bemängeln. Selbst bei der peinlichsten Sauber-
keit werden Stallgerüche und Ungeziefer die Be-
sitzer in ihren Wohnungen belästigen. Wir Feld-
grauen könnten uns Angenehmeres denken als auch
späterhin im Einfamilienhaus den Kleinkrieg gegen
diese kleinen Tierchen zu führen. Selbstverständlich
würde auch gegen ein solches Projekt das Gesund-
heitsamt sein Veto einlegen. Sollte wirklich der
Verfasser der Planskizze eine sparsame Bauweise
im Auge gehabt haben, so ist die Ersparnis doch
nicht derartig groß, daß man ihr zu Liebe die Ge-
sundheit der Bewohner hintenan setzen könnte.
In Straßen mit Nord-Süd-Richtung liegt m. E. auch
kein zwingender Grund vor, die Gartenflächen
grundsätzlich ungeteilt zu fordern, da doch die
Mittagssonne reichlich den kleinen Vorgarten be-
strahlt.
Ein anderer Grund, der aber in der Abhand-
lung unerwähnt geblieben, könnte hierbei mit-
sprechen, nämlich der, die Häuser grundsätzlich so
weit wie möglich von der Straße entfernt zu pro-
jektieren, der Ruhe wegen. Selbst wenn man diesen
Grundsatz verfolgte, ließe sich eine, Anordnung,
wie sie die Planskizzen A 1 —3 Seite 94 veranschau-
lichen, aus den erwähnten triftigen Gründen nicht
durchführen.
M. E. gibt es bei Bauwichen dieser Lage nur
eine Möglichkeit der Neuerung, nämlich die Häuser-
blodts der einen Straße an die hintere Grenzlinie
zu setzen; die der anderen entweder direkt an die
Bauflucht zu verlegen oder sie mit einem kleinen
Vorgarten, wie bislang üblich, zu projektieren, Die
Stallgebäude ließen sich zweckmäßig, je zwei an-
einander gelehnt, an der Nahbargrenze aufführen.
(Man vergleiche die Skizze auf dieser Seite.)
Würden künftighin alle Häuser der Straßen
mit Nord-Süd-Richtung ohne Vorgärten erbaut, wie
Planskizze B 1, 2 und 3 es veranschaulichen, so
ginge der ländliche oder gartenstadtähnliche Cha-
rakter vollständig verloren, welcher nicht durch Ein-
fügung von Einzelbäumen, die hier und da das
Straßenbild zu gliedern hätten, befriedigend ge-
wahrt bleibt. Grundbedingung für die künstlerische
Ausgestaltung eines solchen Straßenbildes ist neben
reicher Abwechslung in architektonischer Beziehung
(Mauern, Durchblicke, Gartenhäuser, einfache aber
gediegene Pforten und Einzäunungen zwischen Ein-
und Doppelhäusern), die möglichst vielseitige Ver-
wendung verschiedenartiger Schlinggewächse, je nach
Besonnung und Eigenart der Baulichkeiten, welche
unmittelbar an der Straße zu liegen kämen; außer-
dem je nach Breite und Lage der Straße, Höhe
der Architekturen (wie Häuser, Mauern und Garten-
häuser) eine geschickte rhythmische Gliederung durch
Baummassen, die teils innerhalb der Gärten, teils
auf Straßenerweiterungen (Wendeplätze) zu stehen
hätten. Voß, Gartenarchitekt, Hamburg,
z. Zt. im Felde.
Für die Schriftleitung verantwortlich: Gartendirektor Heicke, Frankfurt a. M. Selbstverlag der Deutschen""esel"lsÄaft"fär"Gartenkunst.
Druck der Königl. Universitätsdrudierei H. Stürtz A. G., Würzburg.