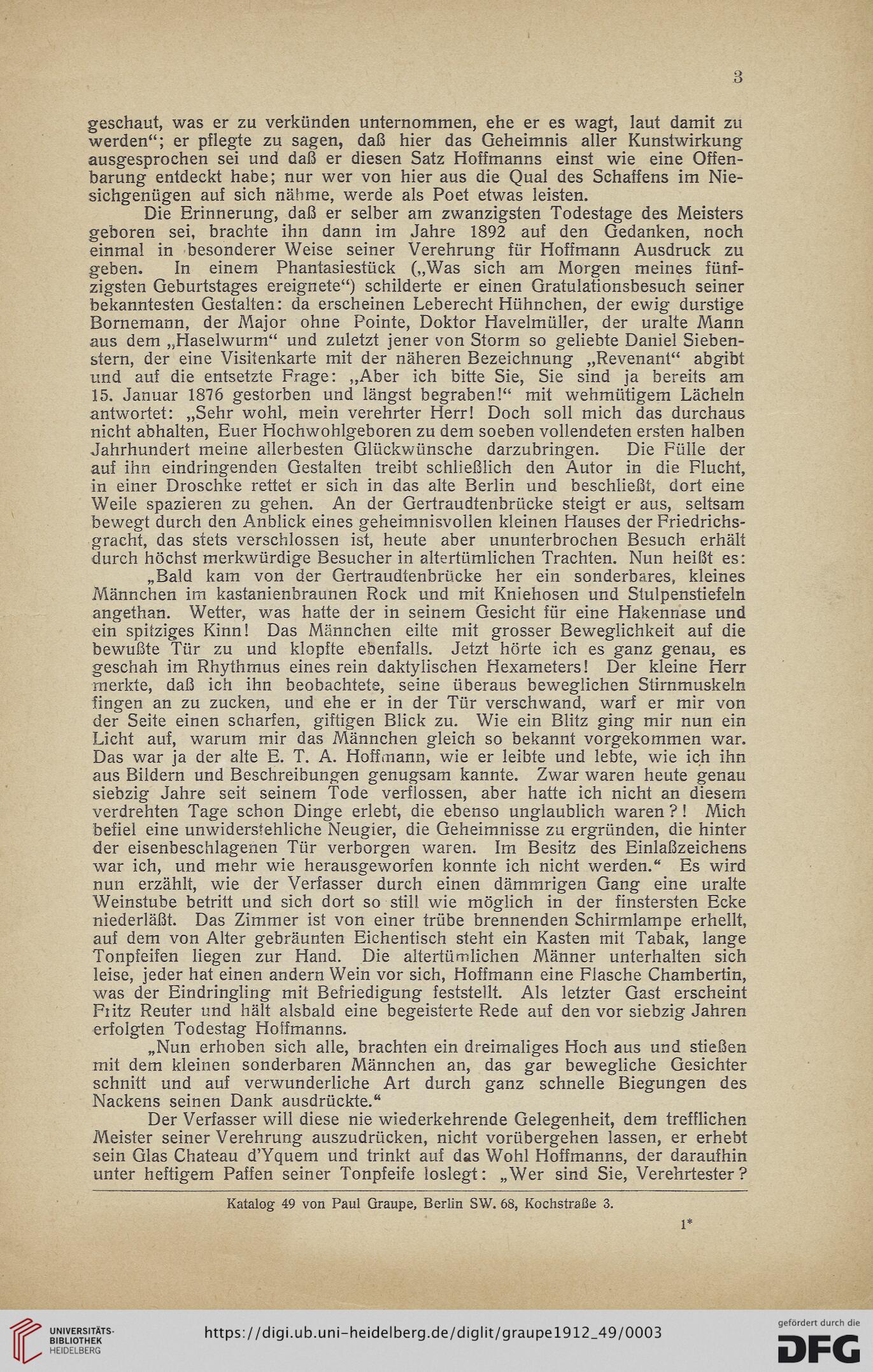3
geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu
werden“; er pflegte zu sagen, daß hier das Geheimnis aller Kunstwirkung
ausgesprochen sei und daß er diesen Satz Hoffmanns einst wie eine Offen-
barung entdeckt habe; nur wer von hier aus die Qual des Schaffens im Nie-
sichgenügen auf sich nähme, werde als Poet etwas leisten.
Die Erinnerung, daß er selber am zwanzigsten Todestage des Meisters
geboren sei, brachte ihn dann im Jahre 1892 auf den Gedanken, noch
einmal in besonderer Weise seiner Verehrung für Hoffmann Ausdruck zu
geben. In einem Phantasiestück („Was sich am Morgen meines fünf-
zigsten Geburtstages ereignete“) schilderte er einen Gratulationsbesuch seiner
bekanntesten Gestalten: da erscheinen Leberecht Hühnchen, der ewig durstige
Bornemann, der Major ohne Pointe, Doktor Havelmüller, der uralte Mann
aus dem „Haselwurm“ und zuletzt jener von Storm so geliebte Daniel Sieben-
stern, der eine Visitenkarte mit der näheren Bezeichnung „Revenant“ abgibt
und auf die entsetzte Frage: „Aber ich bitte Sie, Sie sind ja bereits am
15. Januar 1876 gestorben und längst begraben!“ mit wehmütigem Lächeln
antwortet: „Sehr wohl, mein verehrter Herr! Doch soll mich das durchaus
nicht abhalten, Euer Hochwohlgeboren zu dem soeben vollendeten ersten halben
Jahrhundert meine allerbesten Glückwünsche darzubringen. Die Fülle der
auf ihn eindringenden Gestalten treibt schließlich den Autor in die Flucht,
in einer Droschke rettet er sich in das alte Berlin und beschließt, dort eine
Weile spazieren zu gehen. An der Gertraudtenbrücke steigt er aus, seltsam
bewegt durch den Anblick eines geheimnisvollen kleinen Hauses der Friedrichs-
gracht, das stets verschlossen ist, heute aber ununterbrochen Besuch erhält
durch höchst merkwürdige Besucher in altertümlichen Trachten. Nun heißt es:
„Bald kam von der Gertraudtenbrücke her ein sonderbares, kleines
Männchen im kastanienbraunen Rock und mit Kniehosen und Stulpenstiefeln
angethan. Wetter, was hatte der in seinem Gesicht für eine Hakennase und
ein spitziges Kinn! Das Männchen eilte mit grosser Beweglichkeit auf die
bewußte Tür zu und klopfte ebenfalls. Jetzt hörte ich es ganz genau, es
geschah im Rhythmus eines rein daktylischen Hexameters! Der kleine Herr
merkte, daß ich ihn beobachtete, seine überaus beweglichen Stirnmuskeln
fingen an zu zucken, und ehe er in der Tür verschwand, warf er mir von
der Seite einen scharfen, giftigen Blick zu. Wie ein Blitz ging mir nun ein
Licht auf, warum mir das Männchen gleich so bekannt vorgekommen war.
Das war ja der alte E. T. A. Hoffmann, wie er leibte und lebte, wie ich ihn
aus Bildern und Beschreibungen genugsam kannte. Zwar waren heute genau
siebzig Jahre seit seinem Tode verflossen, aber hatte ich nicht an diesem
verdrehten Tage schon Dinge erlebt, die ebenso unglaublich waren ?! Mich
befiel eine unwiderstehliche Neugier, die Geheimnisse zu ergründen, die hinter
der eisenbeschlagenen Tür verborgen waren. Im Besitz des Einlaßzeichens
war ich, und mehr wie herausgeworfen konnte ich nicht werden.“ Es wird
nun erzählt, wie der Verfasser durch einen dämmrigen Gang eine uralte
Weinstube betritt und sich dort so still wie möglich in der finstersten Ecke
niederläßt. Das Zimmer ist von einer trübe brennenden Schirmlampe erhellt,
auf dem von Alter gebräunten Eichentisch steht ein Kasten mit Tabak, lange
Tonpfeifen liegen zur Hand. Die altertümlichen Männer unterhalten sich
leise, jeder hat einen andern Wein vor sich, Hoffmann eine Flasche Chambertin,
was der Eindringling mit Befriedigung feststellt. Als letzter Gast erscheint
Flitz Reuter und hält alsbald eine begeisterte Rede auf den vor siebzig Jahren
erfolgten Todestag Hoffmanns.
„Nun erhoben sich alle, brachten ein dreimaliges Hoch aus und stießen
mit dem kleinen sonderbaren Männchen an, das gar bewegliche Gesichter
schnitt und auf verwunderliche Art durch ganz schnelle Biegungen des
Nackens seinen Dank ausdrückte.“
Der Verfasser will diese nie wiederkehrende Gelegenheit, dem trefflichen
Meister seiner Verehrung auszudrücken, nicht vorübergehen lassen, er erhebt
sein Glas Chateau d’Yquem und trinkt auf das Wohl Hoffmanns, der daraufhin
unter heftigem Paffen seiner Tonpfeife loslegt: „Wer sind Sie, Verehrtester?
Katalog 49 von Paul Graupe, Berlin SW. 68, Kochstraße 3.
r
geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu
werden“; er pflegte zu sagen, daß hier das Geheimnis aller Kunstwirkung
ausgesprochen sei und daß er diesen Satz Hoffmanns einst wie eine Offen-
barung entdeckt habe; nur wer von hier aus die Qual des Schaffens im Nie-
sichgenügen auf sich nähme, werde als Poet etwas leisten.
Die Erinnerung, daß er selber am zwanzigsten Todestage des Meisters
geboren sei, brachte ihn dann im Jahre 1892 auf den Gedanken, noch
einmal in besonderer Weise seiner Verehrung für Hoffmann Ausdruck zu
geben. In einem Phantasiestück („Was sich am Morgen meines fünf-
zigsten Geburtstages ereignete“) schilderte er einen Gratulationsbesuch seiner
bekanntesten Gestalten: da erscheinen Leberecht Hühnchen, der ewig durstige
Bornemann, der Major ohne Pointe, Doktor Havelmüller, der uralte Mann
aus dem „Haselwurm“ und zuletzt jener von Storm so geliebte Daniel Sieben-
stern, der eine Visitenkarte mit der näheren Bezeichnung „Revenant“ abgibt
und auf die entsetzte Frage: „Aber ich bitte Sie, Sie sind ja bereits am
15. Januar 1876 gestorben und längst begraben!“ mit wehmütigem Lächeln
antwortet: „Sehr wohl, mein verehrter Herr! Doch soll mich das durchaus
nicht abhalten, Euer Hochwohlgeboren zu dem soeben vollendeten ersten halben
Jahrhundert meine allerbesten Glückwünsche darzubringen. Die Fülle der
auf ihn eindringenden Gestalten treibt schließlich den Autor in die Flucht,
in einer Droschke rettet er sich in das alte Berlin und beschließt, dort eine
Weile spazieren zu gehen. An der Gertraudtenbrücke steigt er aus, seltsam
bewegt durch den Anblick eines geheimnisvollen kleinen Hauses der Friedrichs-
gracht, das stets verschlossen ist, heute aber ununterbrochen Besuch erhält
durch höchst merkwürdige Besucher in altertümlichen Trachten. Nun heißt es:
„Bald kam von der Gertraudtenbrücke her ein sonderbares, kleines
Männchen im kastanienbraunen Rock und mit Kniehosen und Stulpenstiefeln
angethan. Wetter, was hatte der in seinem Gesicht für eine Hakennase und
ein spitziges Kinn! Das Männchen eilte mit grosser Beweglichkeit auf die
bewußte Tür zu und klopfte ebenfalls. Jetzt hörte ich es ganz genau, es
geschah im Rhythmus eines rein daktylischen Hexameters! Der kleine Herr
merkte, daß ich ihn beobachtete, seine überaus beweglichen Stirnmuskeln
fingen an zu zucken, und ehe er in der Tür verschwand, warf er mir von
der Seite einen scharfen, giftigen Blick zu. Wie ein Blitz ging mir nun ein
Licht auf, warum mir das Männchen gleich so bekannt vorgekommen war.
Das war ja der alte E. T. A. Hoffmann, wie er leibte und lebte, wie ich ihn
aus Bildern und Beschreibungen genugsam kannte. Zwar waren heute genau
siebzig Jahre seit seinem Tode verflossen, aber hatte ich nicht an diesem
verdrehten Tage schon Dinge erlebt, die ebenso unglaublich waren ?! Mich
befiel eine unwiderstehliche Neugier, die Geheimnisse zu ergründen, die hinter
der eisenbeschlagenen Tür verborgen waren. Im Besitz des Einlaßzeichens
war ich, und mehr wie herausgeworfen konnte ich nicht werden.“ Es wird
nun erzählt, wie der Verfasser durch einen dämmrigen Gang eine uralte
Weinstube betritt und sich dort so still wie möglich in der finstersten Ecke
niederläßt. Das Zimmer ist von einer trübe brennenden Schirmlampe erhellt,
auf dem von Alter gebräunten Eichentisch steht ein Kasten mit Tabak, lange
Tonpfeifen liegen zur Hand. Die altertümlichen Männer unterhalten sich
leise, jeder hat einen andern Wein vor sich, Hoffmann eine Flasche Chambertin,
was der Eindringling mit Befriedigung feststellt. Als letzter Gast erscheint
Flitz Reuter und hält alsbald eine begeisterte Rede auf den vor siebzig Jahren
erfolgten Todestag Hoffmanns.
„Nun erhoben sich alle, brachten ein dreimaliges Hoch aus und stießen
mit dem kleinen sonderbaren Männchen an, das gar bewegliche Gesichter
schnitt und auf verwunderliche Art durch ganz schnelle Biegungen des
Nackens seinen Dank ausdrückte.“
Der Verfasser will diese nie wiederkehrende Gelegenheit, dem trefflichen
Meister seiner Verehrung auszudrücken, nicht vorübergehen lassen, er erhebt
sein Glas Chateau d’Yquem und trinkt auf das Wohl Hoffmanns, der daraufhin
unter heftigem Paffen seiner Tonpfeife loslegt: „Wer sind Sie, Verehrtester?
Katalog 49 von Paul Graupe, Berlin SW. 68, Kochstraße 3.
r