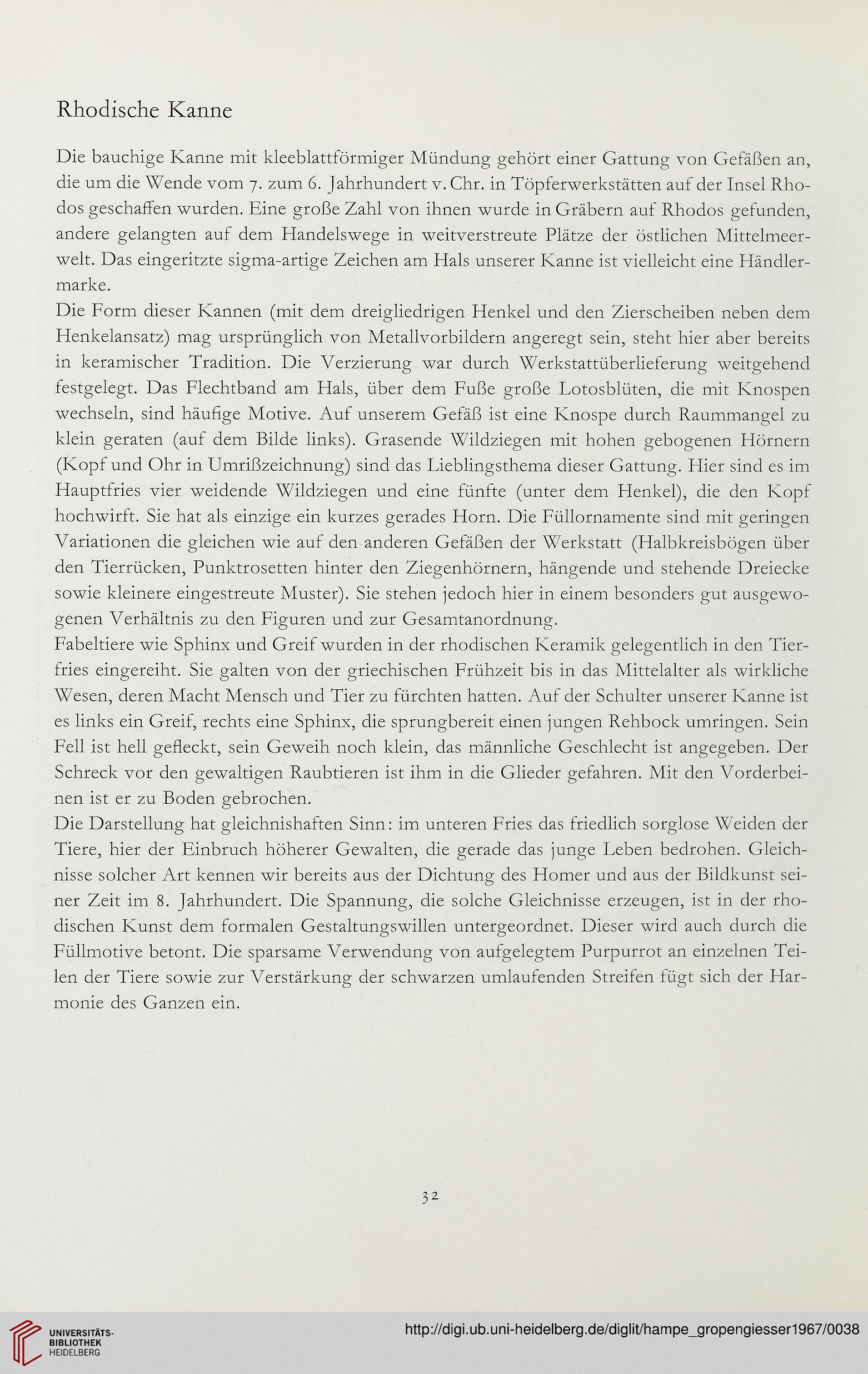Rhodische Kanne
Die bauchige Kanne mit kleeblattförmiger Mündung gehört einer Gattung von Gefäßen an,
die um die Wende vom 7. zum 6. Jahrhundert v. Chr. in Töpferwerkstätten auf der Insel Rho-
dos geschaffen wurden. Eine große Zahl von ihnen wurde in Gräbern auf Rhodos gefunden,
andere gelangten auf dem Handelswege in weitverstreute Plätze der östlichen Mittelmeer-
welt. Das eingeritzte sigma-artige Zeichen am Hals unserer Kanne ist vielleicht eine Fländler-
marke.
Die Form dieser Kannen (mit dem dreigliedrigen Henkel und den Zierscheiben neben dem
Henkelansatz) mag ursprünglich von Metallvorbildern angeregt sein, steht hier aber bereits
in keramischer Tradition. Die Verzierung war durch Werkstattüberlieferung weitgehend
festgelegt. Das Flechtband am Hals, über dem Fuße große Lotosblüten, die mit Knospen
wechseln, sind häufige Motive. Auf unserem Gefäß ist eine Knospe durch Raummangel zu
klein geraten (auf dem Bilde links). Grasende Wildziegen mit hohen gebogenen Hörnern
(Kopf und Ohr in Umrißzeichnung) sind das Lieblingsthema dieser Gattung. Hier sind es im
Hauptfries vier weidende Wildziegen und eine fünfte (unter dem Henkel), die den Kopf
hochwirft. Sie hat als einzige ein kurzes gerades Horn. Die Füllornamente sind mit geringen
Variationen die gleichen wie auf den anderen Gefäßen der Werkstatt (Halbkreisbögen über
den Tierrücken, Punktrosetten hinter den Ziegenhörnern, hängende und stehende Dreiecke
sowie kleinere eingestreute Muster). Sie stehen jedoch hier in einem besonders gut ausgewo-
genen Verhältnis zu den Figuren und zur Gesamtanordnung.
Fabeltiere wie Sphinx und Greif wurden in der rhodischen Keramik gelegentlich in den Tier-
fries eingereiht. Sie galten von der griechischen Frühzeit bis in das Mittelalter als wirkliche
Wesen, deren Macht Mensch und Tier zu fürchten hatten. Auf der Schulter unserer Kanne ist
es links ein Greif, rechts eine Sphinx, die sprungbereit einen jungen Rehbock umringen. Sein
Fell ist hell gefleckt, sein Geweih noch klein, das männliche Geschlecht ist angegeben. Der
Schreck vor den gewaltigen Raubtieren ist ihm in die Glieder gefahren. Mit den Vorderbei-
nen ist er zu Boden gebrochen.
Die Darstellung hat gleichnishaften Sinn: im unteren Fries das friedlich sorglose Weiden der
Tiere, hier der Einbruch höherer Gewalten, die gerade das junge Leben bedrohen. Gleich-
nisse solcher Art kennen wir bereits aus der Dichtung des Homer und aus der Bildkunst sei-
ner Zeit im 8. Jahrhundert. Die Spannung, die solche Gleichnisse erzeugen, ist in der rho-
dischen Kunst dem formalen Gestaltungswillen untergeordnet. Dieser wird auch durch die
Füllmotive betont. Die sparsame Verwendung von aufgelegtem Purpurrot an einzelnen Tei-
len der Tiere sowie zur Verstärkung der schwarzen umlaufenden Streifen fügt sich der Har-
monie des Ganzen ein.
32
Die bauchige Kanne mit kleeblattförmiger Mündung gehört einer Gattung von Gefäßen an,
die um die Wende vom 7. zum 6. Jahrhundert v. Chr. in Töpferwerkstätten auf der Insel Rho-
dos geschaffen wurden. Eine große Zahl von ihnen wurde in Gräbern auf Rhodos gefunden,
andere gelangten auf dem Handelswege in weitverstreute Plätze der östlichen Mittelmeer-
welt. Das eingeritzte sigma-artige Zeichen am Hals unserer Kanne ist vielleicht eine Fländler-
marke.
Die Form dieser Kannen (mit dem dreigliedrigen Henkel und den Zierscheiben neben dem
Henkelansatz) mag ursprünglich von Metallvorbildern angeregt sein, steht hier aber bereits
in keramischer Tradition. Die Verzierung war durch Werkstattüberlieferung weitgehend
festgelegt. Das Flechtband am Hals, über dem Fuße große Lotosblüten, die mit Knospen
wechseln, sind häufige Motive. Auf unserem Gefäß ist eine Knospe durch Raummangel zu
klein geraten (auf dem Bilde links). Grasende Wildziegen mit hohen gebogenen Hörnern
(Kopf und Ohr in Umrißzeichnung) sind das Lieblingsthema dieser Gattung. Hier sind es im
Hauptfries vier weidende Wildziegen und eine fünfte (unter dem Henkel), die den Kopf
hochwirft. Sie hat als einzige ein kurzes gerades Horn. Die Füllornamente sind mit geringen
Variationen die gleichen wie auf den anderen Gefäßen der Werkstatt (Halbkreisbögen über
den Tierrücken, Punktrosetten hinter den Ziegenhörnern, hängende und stehende Dreiecke
sowie kleinere eingestreute Muster). Sie stehen jedoch hier in einem besonders gut ausgewo-
genen Verhältnis zu den Figuren und zur Gesamtanordnung.
Fabeltiere wie Sphinx und Greif wurden in der rhodischen Keramik gelegentlich in den Tier-
fries eingereiht. Sie galten von der griechischen Frühzeit bis in das Mittelalter als wirkliche
Wesen, deren Macht Mensch und Tier zu fürchten hatten. Auf der Schulter unserer Kanne ist
es links ein Greif, rechts eine Sphinx, die sprungbereit einen jungen Rehbock umringen. Sein
Fell ist hell gefleckt, sein Geweih noch klein, das männliche Geschlecht ist angegeben. Der
Schreck vor den gewaltigen Raubtieren ist ihm in die Glieder gefahren. Mit den Vorderbei-
nen ist er zu Boden gebrochen.
Die Darstellung hat gleichnishaften Sinn: im unteren Fries das friedlich sorglose Weiden der
Tiere, hier der Einbruch höherer Gewalten, die gerade das junge Leben bedrohen. Gleich-
nisse solcher Art kennen wir bereits aus der Dichtung des Homer und aus der Bildkunst sei-
ner Zeit im 8. Jahrhundert. Die Spannung, die solche Gleichnisse erzeugen, ist in der rho-
dischen Kunst dem formalen Gestaltungswillen untergeordnet. Dieser wird auch durch die
Füllmotive betont. Die sparsame Verwendung von aufgelegtem Purpurrot an einzelnen Tei-
len der Tiere sowie zur Verstärkung der schwarzen umlaufenden Streifen fügt sich der Har-
monie des Ganzen ein.
32