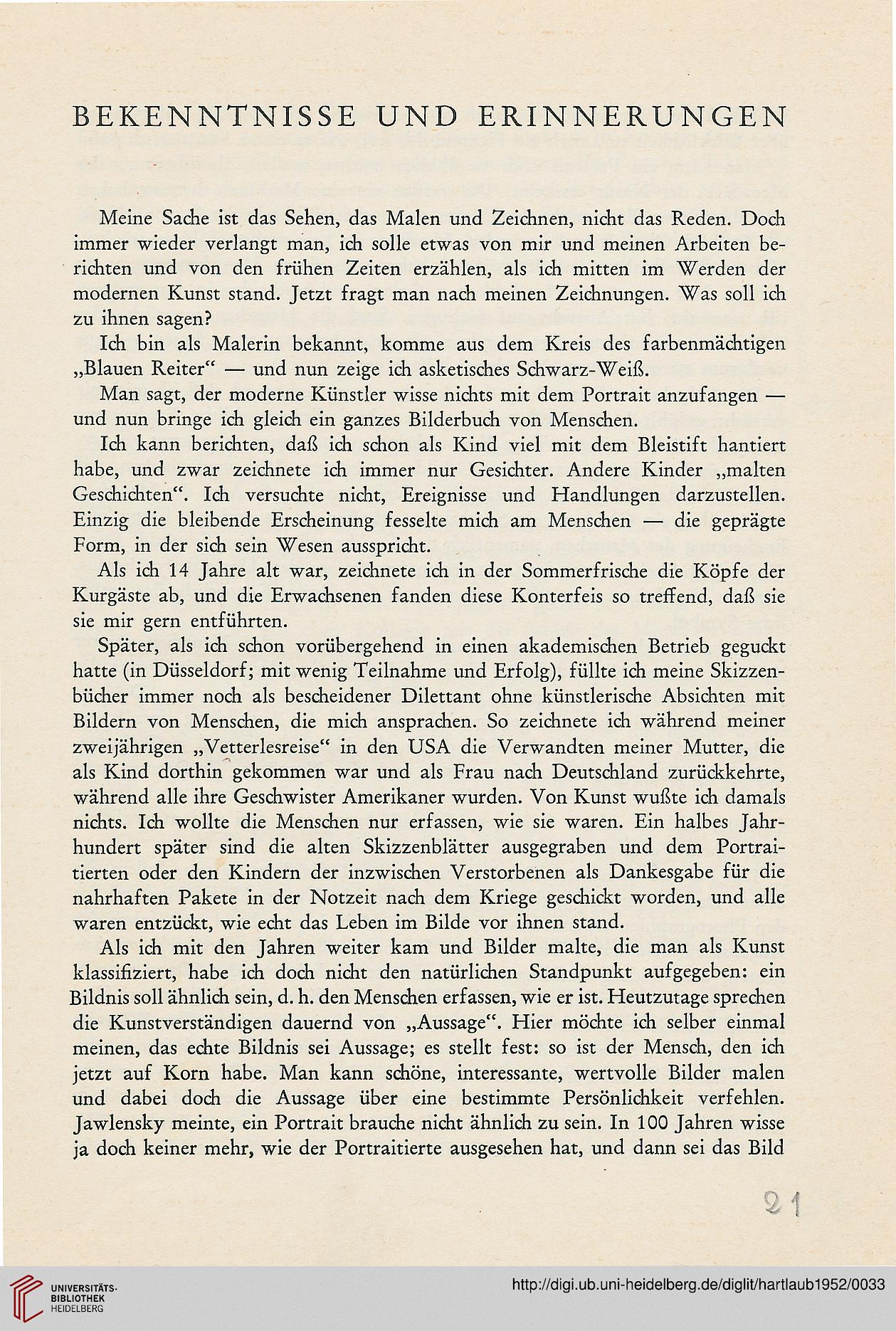BEKENNTNISSE UND ERINNERUNGEN
Meine Sache ist das Sehen, das Malen und Zeichnen, nicht das Reden. Doch
immer wieder verlangt man, ich solle etwas von mir und meinen Arbeiten be-
richten und von den frühen Zeiten erzählen, als ich mitten im Werden der
modernen Kunst stand. Jetzt fragt man nach meinen Zeichnungen. Was soll ich
zu ihnen sagen?
Ich bin als Malerin bekannt, komme aus dem Kreis des farbenmächtigen
„Blauen Reiter“ — und nun zeige ich asketisches Schwarz-Weiß.
Man sagt, der moderne Künstler wisse nichts mit dem Portrait anzufangen —
und nun bringe ich gleich ein ganzes Bilderbuch von Menschen.
Ich kann berichten, daß ich schon als Kind viel mit dem Bleistift hantiert
habe, und zwar zeichnete ich immer nur Gesichter. Andere Kinder „malten
Geschichten“. Ich versuchte nicht, Ereignisse und Handlungen darzustellen.
Einzig die bleibende Erscheinung fesselte mich am Menschen — die geprägte
Form, in der sich sein Wesen ausspricht.
Als ich 14 Jahre alt war, zeichnete ich in der Sommerfrische die Köpfe der
Kurgäste ab, und die Erwachsenen fanden diese Konterfeis so treffend, daß sie
sie mir gern entführten.
Später, als ich schon vorübergehend in einen akademischen Betrieb geguckt
hatte (in Düsseldorf; mit wenig Teilnahme und Erfolg), füllte ich meine Skizzen-
bücher immer noch als bescheidener Dilettant ohne künstlerische Absichten mit
Bildern von Menschen, die mich ansprachen. So zeichnete ich während meiner
zweijährigen „Vetterlesreise“ in den USA die Verwandten meiner Mutter, die
als Kind dorthin gekommen war und als Frau nach Deutschland zurückkehrte,
während alle ihre Geschwister Amerikaner wurden. Von Kunst wußte ich damals
nichts. Ich wollte die Menschen nur erfassen, wie sie waren. Ein halbes Jahr-
hundert später sind die alten Skizzenblätter ausgegraben und dem Portrai-
tierten oder den Kindern der inzwischen Verstorbenen als Dankesgabe für die
nahrhaften Pakete in der Notzeit nach dem Kriege geschickt worden, und alle
waren entzückt, wie echt das Leben im Bilde vor ihnen stand.
Als ich mit den Jahren weiter kam und Bilder malte, die man als Kunst
klassifiziert, habe ich doch nicht den natürlichen Standpunkt aufgegeben: ein
Bildnis soll ähnlich sein, d. h. den Menschen erfassen, wie er ist. Heutzutage sprechen
die Kunstverständigen dauernd von „Aussage“. Hier möchte ich selber einmal
meinen, das echte Bildnis sei Aussage; es stellt fest: so ist der Mensch, den ich
jetzt auf Korn habe. Man kann schöne, interessante, wertvolle Bilder malen
und dabei doch die Aussage über eine bestimmte Persönlichkeit verfehlen.
Jawlensky meinte, ein Portrait brauche nicht ähnlich zu sein. In 100 Jahren wisse
ja doch keiner mehr, wie der Portraitierte ausgesehen hat, und dann sei das Bild
Meine Sache ist das Sehen, das Malen und Zeichnen, nicht das Reden. Doch
immer wieder verlangt man, ich solle etwas von mir und meinen Arbeiten be-
richten und von den frühen Zeiten erzählen, als ich mitten im Werden der
modernen Kunst stand. Jetzt fragt man nach meinen Zeichnungen. Was soll ich
zu ihnen sagen?
Ich bin als Malerin bekannt, komme aus dem Kreis des farbenmächtigen
„Blauen Reiter“ — und nun zeige ich asketisches Schwarz-Weiß.
Man sagt, der moderne Künstler wisse nichts mit dem Portrait anzufangen —
und nun bringe ich gleich ein ganzes Bilderbuch von Menschen.
Ich kann berichten, daß ich schon als Kind viel mit dem Bleistift hantiert
habe, und zwar zeichnete ich immer nur Gesichter. Andere Kinder „malten
Geschichten“. Ich versuchte nicht, Ereignisse und Handlungen darzustellen.
Einzig die bleibende Erscheinung fesselte mich am Menschen — die geprägte
Form, in der sich sein Wesen ausspricht.
Als ich 14 Jahre alt war, zeichnete ich in der Sommerfrische die Köpfe der
Kurgäste ab, und die Erwachsenen fanden diese Konterfeis so treffend, daß sie
sie mir gern entführten.
Später, als ich schon vorübergehend in einen akademischen Betrieb geguckt
hatte (in Düsseldorf; mit wenig Teilnahme und Erfolg), füllte ich meine Skizzen-
bücher immer noch als bescheidener Dilettant ohne künstlerische Absichten mit
Bildern von Menschen, die mich ansprachen. So zeichnete ich während meiner
zweijährigen „Vetterlesreise“ in den USA die Verwandten meiner Mutter, die
als Kind dorthin gekommen war und als Frau nach Deutschland zurückkehrte,
während alle ihre Geschwister Amerikaner wurden. Von Kunst wußte ich damals
nichts. Ich wollte die Menschen nur erfassen, wie sie waren. Ein halbes Jahr-
hundert später sind die alten Skizzenblätter ausgegraben und dem Portrai-
tierten oder den Kindern der inzwischen Verstorbenen als Dankesgabe für die
nahrhaften Pakete in der Notzeit nach dem Kriege geschickt worden, und alle
waren entzückt, wie echt das Leben im Bilde vor ihnen stand.
Als ich mit den Jahren weiter kam und Bilder malte, die man als Kunst
klassifiziert, habe ich doch nicht den natürlichen Standpunkt aufgegeben: ein
Bildnis soll ähnlich sein, d. h. den Menschen erfassen, wie er ist. Heutzutage sprechen
die Kunstverständigen dauernd von „Aussage“. Hier möchte ich selber einmal
meinen, das echte Bildnis sei Aussage; es stellt fest: so ist der Mensch, den ich
jetzt auf Korn habe. Man kann schöne, interessante, wertvolle Bilder malen
und dabei doch die Aussage über eine bestimmte Persönlichkeit verfehlen.
Jawlensky meinte, ein Portrait brauche nicht ähnlich zu sein. In 100 Jahren wisse
ja doch keiner mehr, wie der Portraitierte ausgesehen hat, und dann sei das Bild