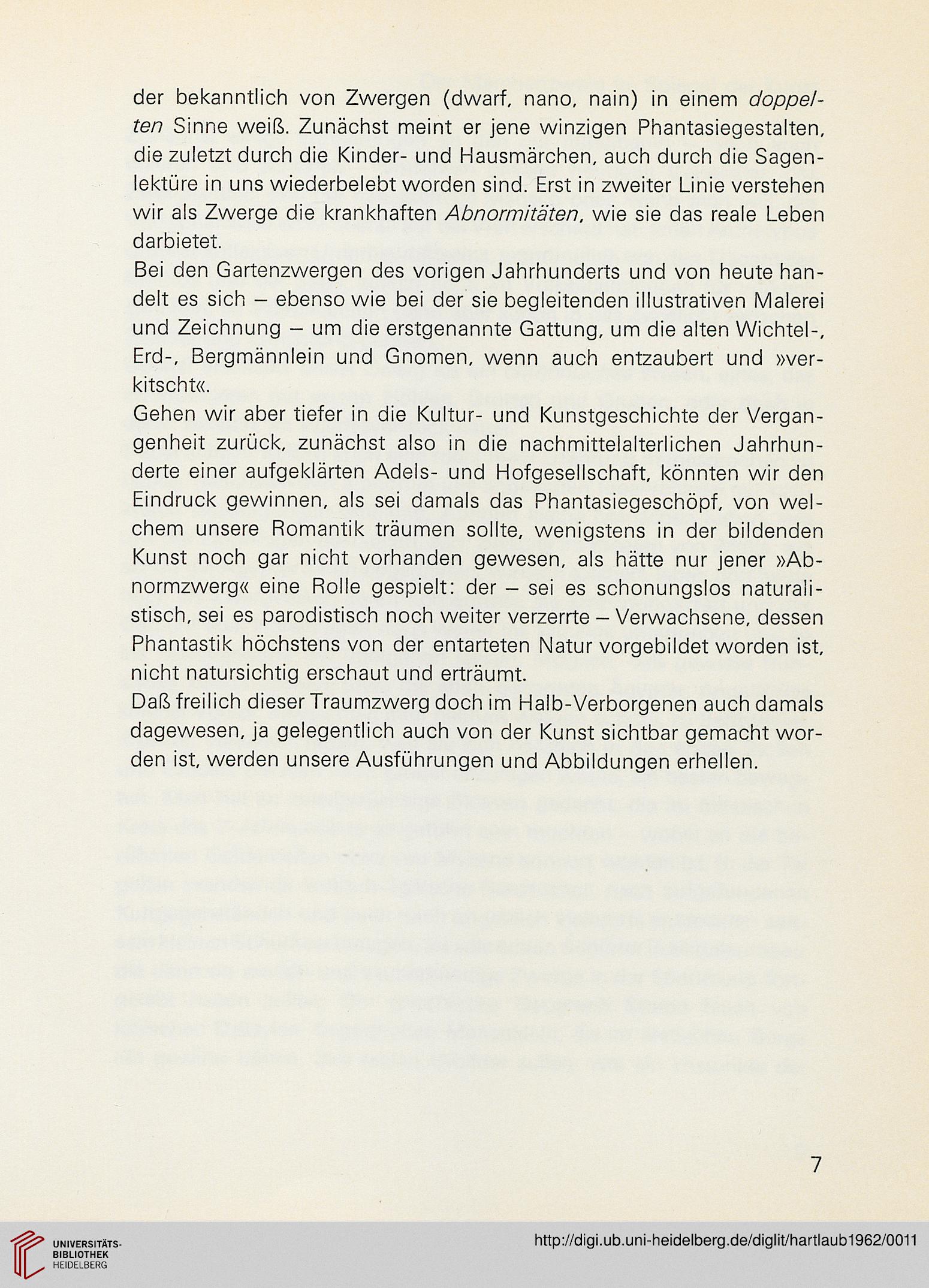der bekanntlich von Zwergen (dwarf, nano. nain) in einem doppel-
ten Sinne weiß. Zunächst meint er jene winzigen Phantasiegestalten,
die zuletzt durch die Kinder- und Hausmärchen, auch durch die Sagen-
lektüre in uns wiederbelebt worden sind. Erst in zweiter Linie verstehen
wir als Zwerge die krankhaften Abnormitäten, wie sie das reale Leben
darbietet.
Bei den Gartenzwergen des vorigen Jahrhunderts und von heute han-
delt es sich - ebenso wie bei der sie begleitenden illustrativen Malerei
und Zeichnung - um die erstgenannte Gattung, um die alten Wichtel-,
Erd-, Bergmännlein und Gnomen, wenn auch entzaubert und »ver-
kitscht«.
Gehen wir aber tiefer in die Kultur- und Kunstgeschichte der Vergan-
genheit zurück, zunächst also in die nachmittelalterlichen Jahrhun-
derte einer aufgeklärten Adels- und Hofgesellschaft, könnten wir den
Eindruck gewinnen, als sei damals das Phantasiegeschöpf, von wel-
chem unsere Romantik träumen sollte, wenigstens in der bildenden
Kunst noch gar nicht vorhanden gewesen, als hätte nur jener »Ab-
normzwerg« eine Rolle gespielt: der - sei es schonungslos naturali-
stisch, sei es parodistisch noch weiter verzerrte - Verwachsene, dessen
Phantastik höchstens von der entarteten Natur vorgebildet worden ist,
nicht natursichtig erschaut und erträumt.
Daß freilich dieser Traumzwerg doch im Halb-Verborgenen auch damals
dagewesen, ja gelegentlich auch von der Kunst sichtbar gemacht wor-
den ist, werden unsere Ausführungen und Abbildungen erhellen.
7
ten Sinne weiß. Zunächst meint er jene winzigen Phantasiegestalten,
die zuletzt durch die Kinder- und Hausmärchen, auch durch die Sagen-
lektüre in uns wiederbelebt worden sind. Erst in zweiter Linie verstehen
wir als Zwerge die krankhaften Abnormitäten, wie sie das reale Leben
darbietet.
Bei den Gartenzwergen des vorigen Jahrhunderts und von heute han-
delt es sich - ebenso wie bei der sie begleitenden illustrativen Malerei
und Zeichnung - um die erstgenannte Gattung, um die alten Wichtel-,
Erd-, Bergmännlein und Gnomen, wenn auch entzaubert und »ver-
kitscht«.
Gehen wir aber tiefer in die Kultur- und Kunstgeschichte der Vergan-
genheit zurück, zunächst also in die nachmittelalterlichen Jahrhun-
derte einer aufgeklärten Adels- und Hofgesellschaft, könnten wir den
Eindruck gewinnen, als sei damals das Phantasiegeschöpf, von wel-
chem unsere Romantik träumen sollte, wenigstens in der bildenden
Kunst noch gar nicht vorhanden gewesen, als hätte nur jener »Ab-
normzwerg« eine Rolle gespielt: der - sei es schonungslos naturali-
stisch, sei es parodistisch noch weiter verzerrte - Verwachsene, dessen
Phantastik höchstens von der entarteten Natur vorgebildet worden ist,
nicht natursichtig erschaut und erträumt.
Daß freilich dieser Traumzwerg doch im Halb-Verborgenen auch damals
dagewesen, ja gelegentlich auch von der Kunst sichtbar gemacht wor-
den ist, werden unsere Ausführungen und Abbildungen erhellen.
7