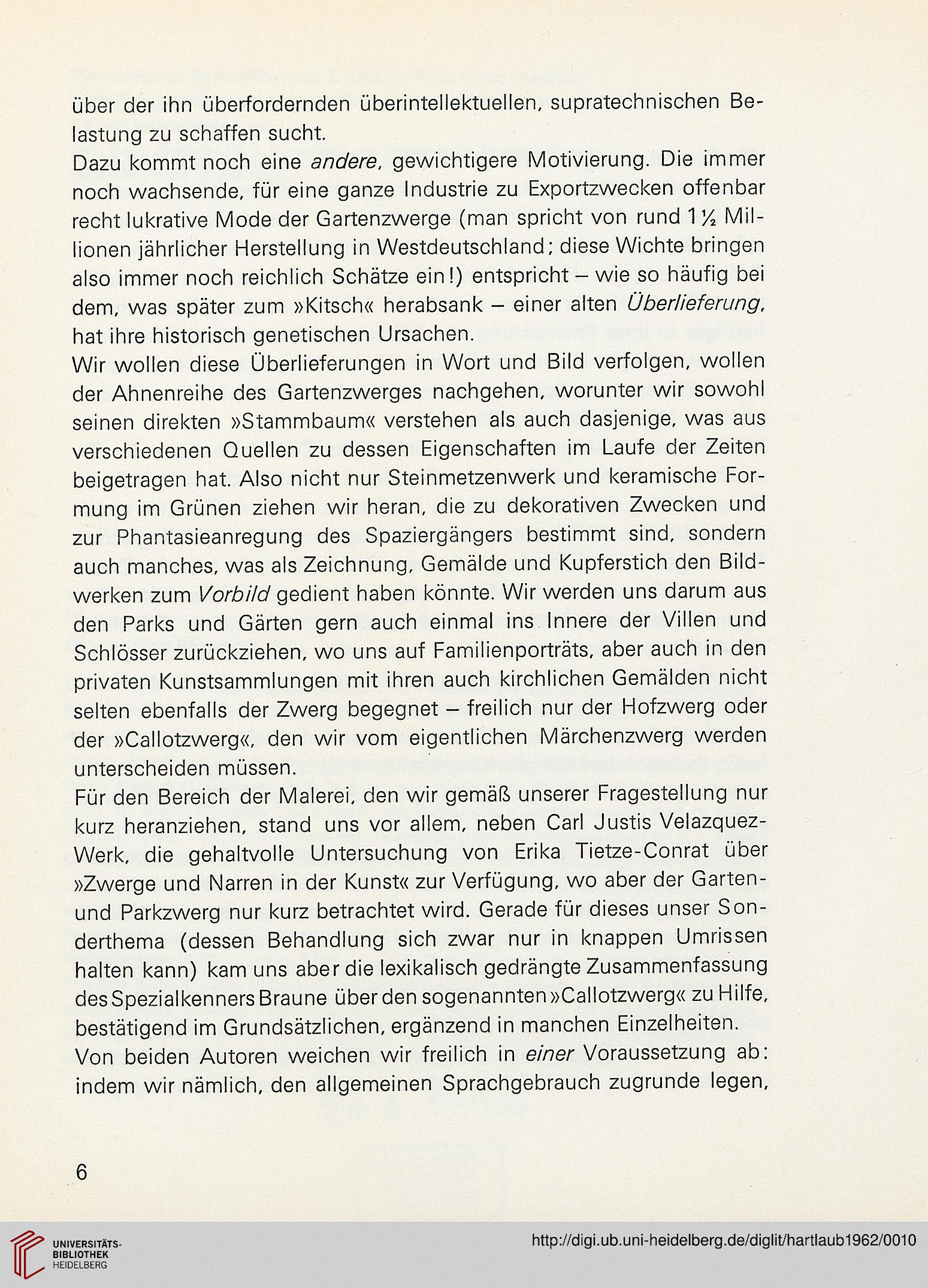über der ihn überfordernden überintellektuellen, supratechnischen Be-
lastung zu schaffen sucht.
Dazu kommt noch eine andere, gewichtigere Motivierung. Die immer
noch wachsende, für eine ganze Industrie zu Exportzwecken offenbar
recht lukrative Mode der Gartenzwerge (man spricht von rund 1 % Mil-
lionen jährlicher Herstellung in Westdeutschland; diese Wichte bringen
also immer noch reichlich Schätze ein!) entspricht - wie so häufig bei
dem, was später zum »Kitsch« herabsank - einer alten Überlieferung,
hat ihre historisch genetischen Ursachen.
Wir wollen diese Überlieferungen in Wort und Bild verfolgen, wollen
der Ahnenreihe des Gartenzwerges nachgehen, worunter wir sowohl
seinen direkten »Stammbaum« verstehen als auch dasjenige, was aus
verschiedenen Quellen zu dessen Eigenschaften im Laufe der Zeiten
beigetragen hat. Also nicht nur Steinmetzenwerk und keramische For-
mung im Grünen ziehen wir heran, die zu dekorativen Zwecken und
zur Phantasieanregung des Spaziergängers bestimmt sind, sondern
auch manches, was als Zeichnung, Gemälde und Kupferstich den Bild-
werken zum Vorbild gedient haben könnte. Wir werden uns darum aus
den Parks und Gärten gern auch einmal ins Innere der Villen und
Schlösser zurückziehen, wo uns auf Familienporträts, aber auch in den
privaten Kunstsammlungen mit ihren auch kirchlichen Gemälden nicht
selten ebenfalls der Zwerg begegnet - freilich nur der Hofzwerg oder
der »Callotzwerg«, den wir vom eigentlichen Märchenzwerg werden
unterscheiden müssen.
Für den Bereich der Malerei, den wir gemäß unserer Fragestellung nur
kurz heranziehen, stand uns vor allem, neben Carl Justis Velazquez-
Werk, die gehaltvolle Untersuchung von Erika Tietze-Conrat über
»Zwerge und Narren in der Kunst« zur Verfügung, wo aber der Garten-
und Parkzwerg nur kurz betrachtet wird. Gerade für dieses unser Son-
derthema (dessen Behandlung sich zwar nur in knappen Umrissen
halten kann) kam uns aber die lexikalisch gedrängte Zusammenfassung
des Spezialkenners Braune über den sogenannten »Callotzwerg« zu Hilfe,
bestätigend im Grundsätzlichen, ergänzend in manchen Einzelheiten.
Von beiden Autoren weichen wir freilich in einer Voraussetzung ab:
indem wir nämlich, den allgemeinen Sprachgebrauch zugrunde legen.
6
lastung zu schaffen sucht.
Dazu kommt noch eine andere, gewichtigere Motivierung. Die immer
noch wachsende, für eine ganze Industrie zu Exportzwecken offenbar
recht lukrative Mode der Gartenzwerge (man spricht von rund 1 % Mil-
lionen jährlicher Herstellung in Westdeutschland; diese Wichte bringen
also immer noch reichlich Schätze ein!) entspricht - wie so häufig bei
dem, was später zum »Kitsch« herabsank - einer alten Überlieferung,
hat ihre historisch genetischen Ursachen.
Wir wollen diese Überlieferungen in Wort und Bild verfolgen, wollen
der Ahnenreihe des Gartenzwerges nachgehen, worunter wir sowohl
seinen direkten »Stammbaum« verstehen als auch dasjenige, was aus
verschiedenen Quellen zu dessen Eigenschaften im Laufe der Zeiten
beigetragen hat. Also nicht nur Steinmetzenwerk und keramische For-
mung im Grünen ziehen wir heran, die zu dekorativen Zwecken und
zur Phantasieanregung des Spaziergängers bestimmt sind, sondern
auch manches, was als Zeichnung, Gemälde und Kupferstich den Bild-
werken zum Vorbild gedient haben könnte. Wir werden uns darum aus
den Parks und Gärten gern auch einmal ins Innere der Villen und
Schlösser zurückziehen, wo uns auf Familienporträts, aber auch in den
privaten Kunstsammlungen mit ihren auch kirchlichen Gemälden nicht
selten ebenfalls der Zwerg begegnet - freilich nur der Hofzwerg oder
der »Callotzwerg«, den wir vom eigentlichen Märchenzwerg werden
unterscheiden müssen.
Für den Bereich der Malerei, den wir gemäß unserer Fragestellung nur
kurz heranziehen, stand uns vor allem, neben Carl Justis Velazquez-
Werk, die gehaltvolle Untersuchung von Erika Tietze-Conrat über
»Zwerge und Narren in der Kunst« zur Verfügung, wo aber der Garten-
und Parkzwerg nur kurz betrachtet wird. Gerade für dieses unser Son-
derthema (dessen Behandlung sich zwar nur in knappen Umrissen
halten kann) kam uns aber die lexikalisch gedrängte Zusammenfassung
des Spezialkenners Braune über den sogenannten »Callotzwerg« zu Hilfe,
bestätigend im Grundsätzlichen, ergänzend in manchen Einzelheiten.
Von beiden Autoren weichen wir freilich in einer Voraussetzung ab:
indem wir nämlich, den allgemeinen Sprachgebrauch zugrunde legen.
6