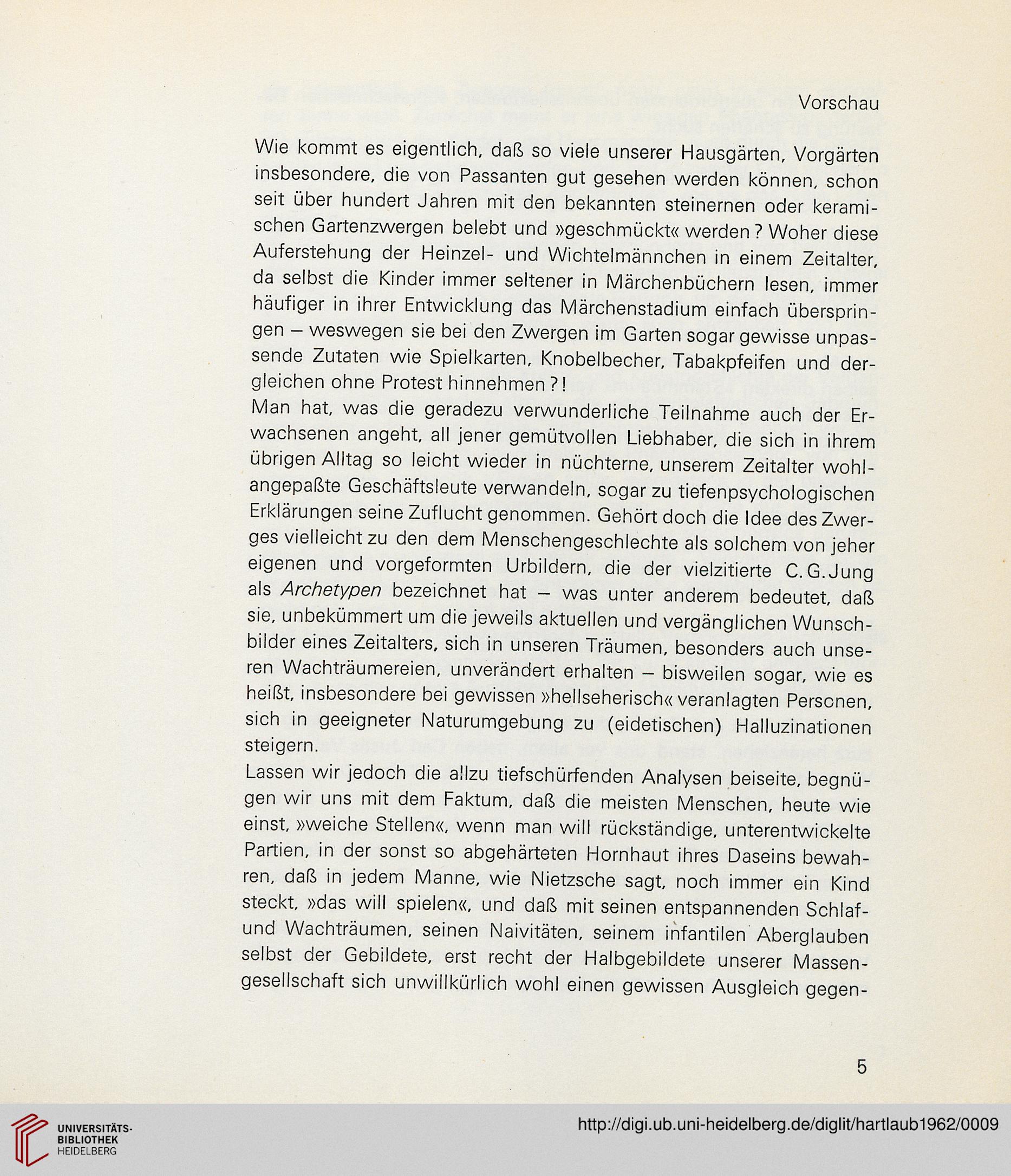Vorschau
Wie kommt es eigentlich, daß so viele unserer Hausgärten, Vorgärten
insbesondere, die von Passanten gut gesehen werden können, schon
seit über hundert Jahren mit den bekannten steinernen oder kerami-
schen Gartenzwergen belebt und »geschmückt« werden ? Woher diese
Auferstehung der Heinzel- und Wichtelmännchen in einem Zeitalter,
da selbst die Kinder immer seltener in Märchenbüchern lesen, immer
häufiger in ihrer Entwicklung das Märchenstadium einfach übersprin-
gen - weswegen sie bei den Zwergen im Garten sogar gewisse unpas-
sende Zutaten wie Spielkarten, Knobelbecher, Tabakpfeifen und der-
gleichen ohne Protest hinnehmen ?!
Man hat, was die geradezu verwunderliche Teilnahme auch der Er-
wachsenen angeht, all jener gemütvollen Liebhaber, die sich in ihrem
übrigen Alltag so leicht wieder in nüchterne, unserem Zeitalter wohl-
angepaßte Geschäftsleute verwandeln, sogar zu tiefenpsychologischen
Erklärungen seine Zuflucht genommen. Gehört doch die Idee des Zwer-
ges vielleicht zu den dem Menschengeschlechte als solchem von jeher
eigenen und vorgeformten Urbildern, die der vielzitierte CG.Jung
als Archetypen bezeichnet hat - was unter anderem bedeutet, daß
sie, unbekümmert um die jeweils aktuellen und vergänglichen Wunsch-
bilder eines Zeitalters, sich in unseren Träumen, besonders auch unse-
ren Wachträumereien, unverändert erhalten - bisweilen sogar, wie es
heißt, insbesondere bei gewissen »hellseherisch« veranlagten Personen,
sich in geeigneter Naturumgebung zu (eidetischen) Halluzinationen
steigern.
Lassen wir jedoch die allzu tiefschürfenden Analysen beiseite, begnü-
gen wir uns mit dem Faktum, daß die meisten Menschen, heute wie
einst, »weiche Stellen«, wenn man will rückständige, unterentwickelte
Partien, in der sonst so abgehärteten Hornhaut ihres Daseins bewah-
ren, daß in jedem Manne, wie Nietzsche sagt, noch immer ein Kind
steckt, »das will spielen«, und daß mit seinen entspannenden Schlaf-
und Wachträumen, seinen Naivitäten, seinem infantilen Aberglauben
selbst der Gebildete, erst recht der Halbgebildete unserer Massen-
gesellschaft sich unwillkürlich wohl einen gewissen Ausgleich gegen-
5
Wie kommt es eigentlich, daß so viele unserer Hausgärten, Vorgärten
insbesondere, die von Passanten gut gesehen werden können, schon
seit über hundert Jahren mit den bekannten steinernen oder kerami-
schen Gartenzwergen belebt und »geschmückt« werden ? Woher diese
Auferstehung der Heinzel- und Wichtelmännchen in einem Zeitalter,
da selbst die Kinder immer seltener in Märchenbüchern lesen, immer
häufiger in ihrer Entwicklung das Märchenstadium einfach übersprin-
gen - weswegen sie bei den Zwergen im Garten sogar gewisse unpas-
sende Zutaten wie Spielkarten, Knobelbecher, Tabakpfeifen und der-
gleichen ohne Protest hinnehmen ?!
Man hat, was die geradezu verwunderliche Teilnahme auch der Er-
wachsenen angeht, all jener gemütvollen Liebhaber, die sich in ihrem
übrigen Alltag so leicht wieder in nüchterne, unserem Zeitalter wohl-
angepaßte Geschäftsleute verwandeln, sogar zu tiefenpsychologischen
Erklärungen seine Zuflucht genommen. Gehört doch die Idee des Zwer-
ges vielleicht zu den dem Menschengeschlechte als solchem von jeher
eigenen und vorgeformten Urbildern, die der vielzitierte CG.Jung
als Archetypen bezeichnet hat - was unter anderem bedeutet, daß
sie, unbekümmert um die jeweils aktuellen und vergänglichen Wunsch-
bilder eines Zeitalters, sich in unseren Träumen, besonders auch unse-
ren Wachträumereien, unverändert erhalten - bisweilen sogar, wie es
heißt, insbesondere bei gewissen »hellseherisch« veranlagten Personen,
sich in geeigneter Naturumgebung zu (eidetischen) Halluzinationen
steigern.
Lassen wir jedoch die allzu tiefschürfenden Analysen beiseite, begnü-
gen wir uns mit dem Faktum, daß die meisten Menschen, heute wie
einst, »weiche Stellen«, wenn man will rückständige, unterentwickelte
Partien, in der sonst so abgehärteten Hornhaut ihres Daseins bewah-
ren, daß in jedem Manne, wie Nietzsche sagt, noch immer ein Kind
steckt, »das will spielen«, und daß mit seinen entspannenden Schlaf-
und Wachträumen, seinen Naivitäten, seinem infantilen Aberglauben
selbst der Gebildete, erst recht der Halbgebildete unserer Massen-
gesellschaft sich unwillkürlich wohl einen gewissen Ausgleich gegen-
5