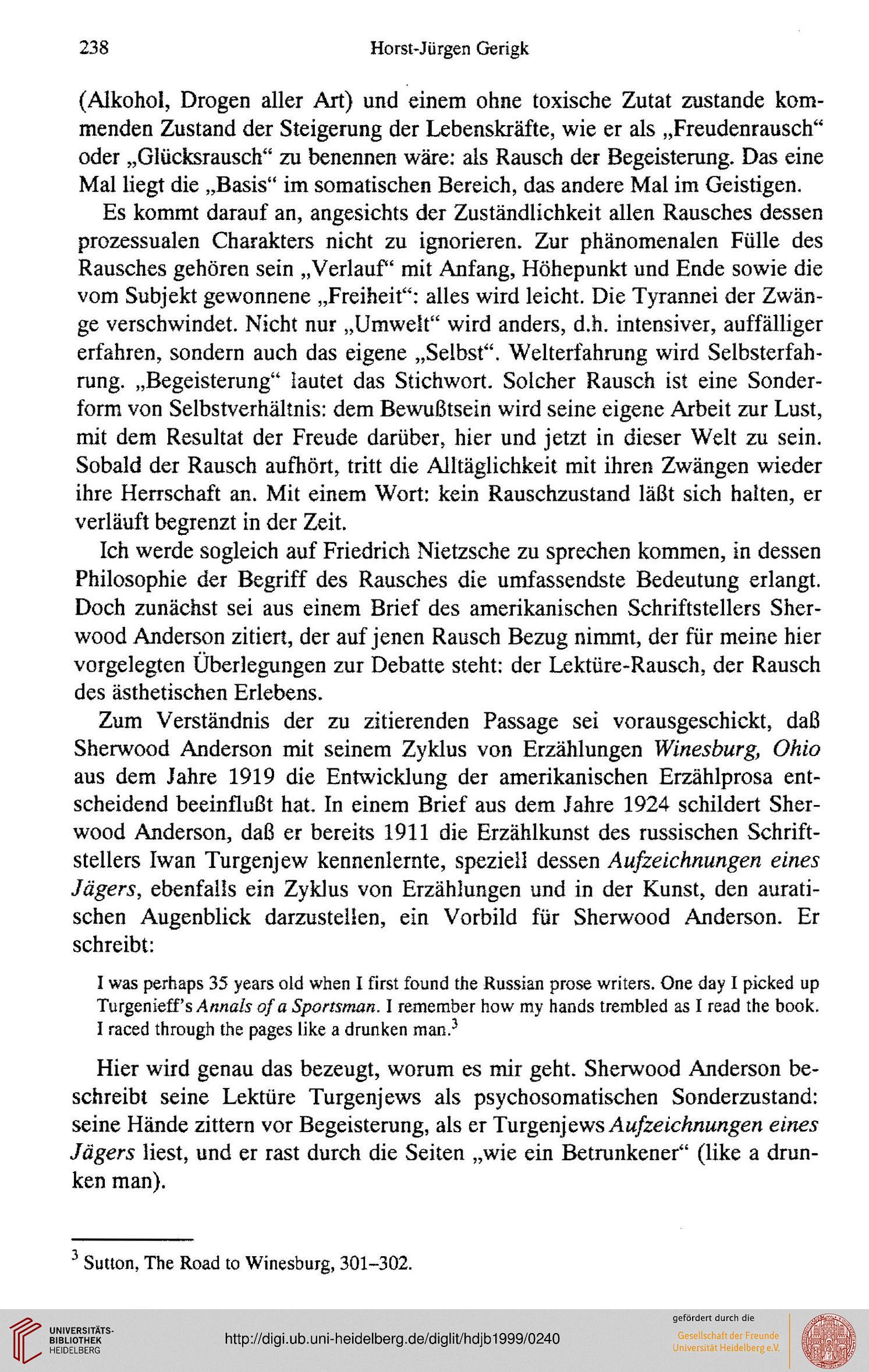238 Horst-Jürgen Gerigk
(Alkohol, Drogen aller Art) und einem ohne toxische Zutat zustande kom-
menden Zustand der Steigerung der Lebenskräfte, wie er als „Freudenrausch"
oder „Glücksrausch" zu benennen wäre: als Rausch der Begeisterung. Das eine
Mal liegt die „Basis" im somatischen Bereich, das andere Mal im Geistigen.
Es kommt darauf an, angesichts der Zuständlichkeit allen Rausches dessen
prozessualen Charakters nicht zu ignorieren. Zur phänomenalen Fülle des
Rausches gehören sein „Verlauf mit Anfang, Höhepunkt und Ende sowie die
vom Subjekt gewonnene „Freiheit": alles wird leicht. Die Tyrannei der Zwän-
ge verschwindet. Nicht nur „Umwelt" wird anders, d.h. intensiver, auffälliger
erfahren, sondern auch das eigene „Selbst". Welterfahrung wird Selbsterfah-
rung. „Begeisterung" lautet das Stichwort. Solcher Rausch ist eine Sonder-
form von Selbstverhältnis: dem Bewußtsein wird seine eigene Arbeit zur Lust,
mit dem Resultat der Freude darüber, hier und jetzt in dieser Welt zu sein.
Sobald der Rausch aufhört, tritt die Alltäglichkeit mit ihren Zwängen wieder
ihre Herrschaft an. Mit einem Wort: kein Rauschzustand läßt sich halten, er
verläuft begrenzt in der Zeit.
Ich werde sogleich auf Friedrich Nietzsche zu sprechen kommen, in dessen
Philosophie der Begriff des Rausches die umfassendste Bedeutung erlangt.
Doch zunächst sei aus einem Brief des amerikanischen Schriftstellers Sher-
wood Anderson zitiert, der auf jenen Rausch Bezug nimmt, der für meine hier
vorgelegten Überlegungen zur Debatte steht: der Lektüre-Rausch, der Rausch
des ästhetischen Erlebens.
Zum Verständnis der zu zitierenden Passage sei vorausgeschickt, daß
Sherwood Anderson mit seinem Zyklus von Erzählungen Winesburg, Ohio
aus dem Jahre 1919 die Entwicklung der amerikanischen Erzählprosa ent-
scheidend beeinflußt hat. In einem Brief aus dem Jahre 1924 schildert Sher-
wood Anderson, daß er bereits 1911 die Erzählkunst des russischen Schrift-
stellers Iwan Turgenjew kennenlernte, speziell dessen Aufzeichnungen eines
Jägers, ebenfalls ein Zyklus von Erzählungen und in der Kunst, den aurati-
schen Augenblick darzustellen, ein Vorbild für Sherwood Anderson. Er
schreibt:
I was perhaps 35 years old when I first found the Russian prose writers. One day I picked up
Turgenieff's Annais of a Sportsman. I remember how my hands trembled as I read the book.
I raced through the pages like a drunken man.3
Hier wird genau das bezeugt, worum es mir geht. Sherwood Anderson be-
schreibt seine Lektüre Turgenjews als psychosomatischen Sonderzustand:
seine Hände zittern vor Begeisterung, als er Turgenjews Aufzeichnungen eines
Jägers liest, und er rast durch die Seiten „wie ein Betrunkener" (like a drun-
ken man).
3 Sutton, The Road to Winesburg, 301-302.
(Alkohol, Drogen aller Art) und einem ohne toxische Zutat zustande kom-
menden Zustand der Steigerung der Lebenskräfte, wie er als „Freudenrausch"
oder „Glücksrausch" zu benennen wäre: als Rausch der Begeisterung. Das eine
Mal liegt die „Basis" im somatischen Bereich, das andere Mal im Geistigen.
Es kommt darauf an, angesichts der Zuständlichkeit allen Rausches dessen
prozessualen Charakters nicht zu ignorieren. Zur phänomenalen Fülle des
Rausches gehören sein „Verlauf mit Anfang, Höhepunkt und Ende sowie die
vom Subjekt gewonnene „Freiheit": alles wird leicht. Die Tyrannei der Zwän-
ge verschwindet. Nicht nur „Umwelt" wird anders, d.h. intensiver, auffälliger
erfahren, sondern auch das eigene „Selbst". Welterfahrung wird Selbsterfah-
rung. „Begeisterung" lautet das Stichwort. Solcher Rausch ist eine Sonder-
form von Selbstverhältnis: dem Bewußtsein wird seine eigene Arbeit zur Lust,
mit dem Resultat der Freude darüber, hier und jetzt in dieser Welt zu sein.
Sobald der Rausch aufhört, tritt die Alltäglichkeit mit ihren Zwängen wieder
ihre Herrschaft an. Mit einem Wort: kein Rauschzustand läßt sich halten, er
verläuft begrenzt in der Zeit.
Ich werde sogleich auf Friedrich Nietzsche zu sprechen kommen, in dessen
Philosophie der Begriff des Rausches die umfassendste Bedeutung erlangt.
Doch zunächst sei aus einem Brief des amerikanischen Schriftstellers Sher-
wood Anderson zitiert, der auf jenen Rausch Bezug nimmt, der für meine hier
vorgelegten Überlegungen zur Debatte steht: der Lektüre-Rausch, der Rausch
des ästhetischen Erlebens.
Zum Verständnis der zu zitierenden Passage sei vorausgeschickt, daß
Sherwood Anderson mit seinem Zyklus von Erzählungen Winesburg, Ohio
aus dem Jahre 1919 die Entwicklung der amerikanischen Erzählprosa ent-
scheidend beeinflußt hat. In einem Brief aus dem Jahre 1924 schildert Sher-
wood Anderson, daß er bereits 1911 die Erzählkunst des russischen Schrift-
stellers Iwan Turgenjew kennenlernte, speziell dessen Aufzeichnungen eines
Jägers, ebenfalls ein Zyklus von Erzählungen und in der Kunst, den aurati-
schen Augenblick darzustellen, ein Vorbild für Sherwood Anderson. Er
schreibt:
I was perhaps 35 years old when I first found the Russian prose writers. One day I picked up
Turgenieff's Annais of a Sportsman. I remember how my hands trembled as I read the book.
I raced through the pages like a drunken man.3
Hier wird genau das bezeugt, worum es mir geht. Sherwood Anderson be-
schreibt seine Lektüre Turgenjews als psychosomatischen Sonderzustand:
seine Hände zittern vor Begeisterung, als er Turgenjews Aufzeichnungen eines
Jägers liest, und er rast durch die Seiten „wie ein Betrunkener" (like a drun-
ken man).
3 Sutton, The Road to Winesburg, 301-302.