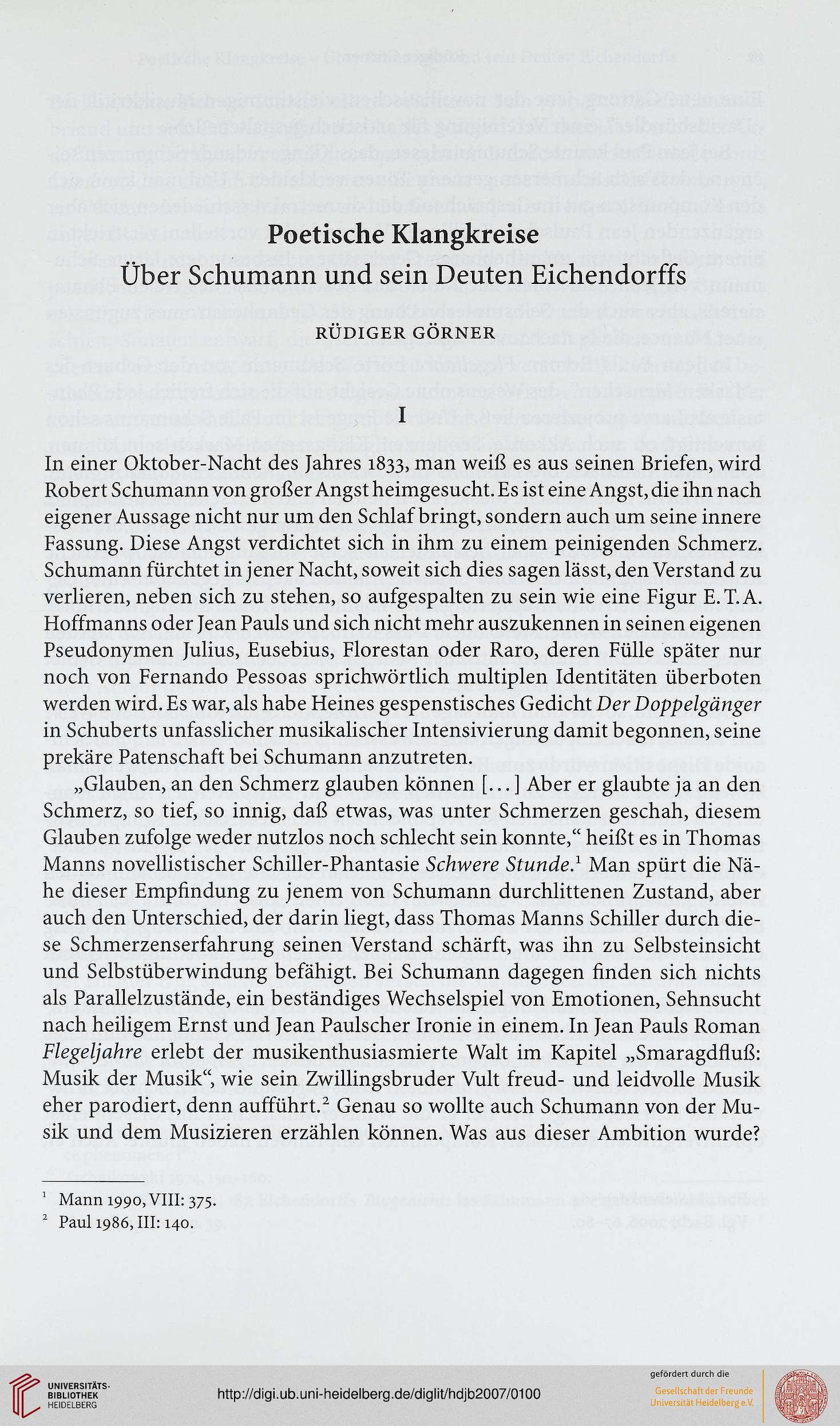Poetische Klangkreise
Über Schumann und sein Deuten Eichendorffs
RÜDIGER GÖRNER
I
In einer Oktober-Nacht des Jahres 1833, man weiß es aus seinen Briefen, wird
Robert Schumann von großer Angst heimgesucht. Es ist eine Angst, die ihn nach
eigener Aussage nicht nur um den Schlaf bringt, sondern auch um seine innere
Fassung. Diese Angst verdichtet sich in ihm zu einem peinigenden Schmerz.
Schumann fürchtet in jener Nacht, soweit sich dies sagen lässt, den Verstand zu
verlieren, neben sich zu stehen, so aufgespalten zu sein wie eine Figur E.T.A.
Hoffmanns oder Jean Pauls und sich nicht mehr auszukennen in seinen eigenen
Pseudonymen Julius, Eusebius, Florestan oder Raro, deren Fülle später nur
noch von Fernando Pessoas sprichwörtlich multiplen Identitäten überboten
werden wird. Es war, als habe Heines gespenstisches Gedicht Der Doppelgänger
in Schuberts unfasslicher musikalischer Intensivierung damit begonnen, seine
prekäre Patenschaft bei Schumann anzutreten.
„Glauben, an den Schmerz glauben können [... ] Aber er glaubte ja an den
Schmerz, so tief, so innig, daß etwas, was unter Schmerzen geschah, diesem
Glauben zufolge weder nutzlos noch schlecht sein konnte," heißt es in Thomas
Manns novellistischer Schiller-Phantasie Schwere Stunde.1 Man spürt die Nä-
he dieser Empfindung zu jenem von Schumann durchlittenen Zustand, aber
auch den Unterschied, der darin liegt, dass Thomas Manns Schiller durch die-
se Schmerzenserfahrung seinen Verstand schärft, was ihn zu Selbsteinsicht
und Selbstüberwindung befähigt. Bei Schumann dagegen finden sich nichts
als Parallelzustände, ein beständiges Wechselspiel von Emotionen, Sehnsucht
nach heiligem Ernst und Jean Paulscher Ironie in einem. In Jean Pauls Roman
Flegeljahre erlebt der musikenthusiasmierte Walt im Kapitel „Smaragdfluß:
Musik der Musik", wie sein Zwillingsbruder Vult freud- und leidvolle Musik
eher parodiert, denn aufführt.2 Genau so wollte auch Schumann von der Mu-
sik und dem Musizieren erzählen können. Was aus dieser Ambition wurde?
1 Mann 1990, VIII: 375.
2 Paul 1986, III: 140.
Über Schumann und sein Deuten Eichendorffs
RÜDIGER GÖRNER
I
In einer Oktober-Nacht des Jahres 1833, man weiß es aus seinen Briefen, wird
Robert Schumann von großer Angst heimgesucht. Es ist eine Angst, die ihn nach
eigener Aussage nicht nur um den Schlaf bringt, sondern auch um seine innere
Fassung. Diese Angst verdichtet sich in ihm zu einem peinigenden Schmerz.
Schumann fürchtet in jener Nacht, soweit sich dies sagen lässt, den Verstand zu
verlieren, neben sich zu stehen, so aufgespalten zu sein wie eine Figur E.T.A.
Hoffmanns oder Jean Pauls und sich nicht mehr auszukennen in seinen eigenen
Pseudonymen Julius, Eusebius, Florestan oder Raro, deren Fülle später nur
noch von Fernando Pessoas sprichwörtlich multiplen Identitäten überboten
werden wird. Es war, als habe Heines gespenstisches Gedicht Der Doppelgänger
in Schuberts unfasslicher musikalischer Intensivierung damit begonnen, seine
prekäre Patenschaft bei Schumann anzutreten.
„Glauben, an den Schmerz glauben können [... ] Aber er glaubte ja an den
Schmerz, so tief, so innig, daß etwas, was unter Schmerzen geschah, diesem
Glauben zufolge weder nutzlos noch schlecht sein konnte," heißt es in Thomas
Manns novellistischer Schiller-Phantasie Schwere Stunde.1 Man spürt die Nä-
he dieser Empfindung zu jenem von Schumann durchlittenen Zustand, aber
auch den Unterschied, der darin liegt, dass Thomas Manns Schiller durch die-
se Schmerzenserfahrung seinen Verstand schärft, was ihn zu Selbsteinsicht
und Selbstüberwindung befähigt. Bei Schumann dagegen finden sich nichts
als Parallelzustände, ein beständiges Wechselspiel von Emotionen, Sehnsucht
nach heiligem Ernst und Jean Paulscher Ironie in einem. In Jean Pauls Roman
Flegeljahre erlebt der musikenthusiasmierte Walt im Kapitel „Smaragdfluß:
Musik der Musik", wie sein Zwillingsbruder Vult freud- und leidvolle Musik
eher parodiert, denn aufführt.2 Genau so wollte auch Schumann von der Mu-
sik und dem Musizieren erzählen können. Was aus dieser Ambition wurde?
1 Mann 1990, VIII: 375.
2 Paul 1986, III: 140.