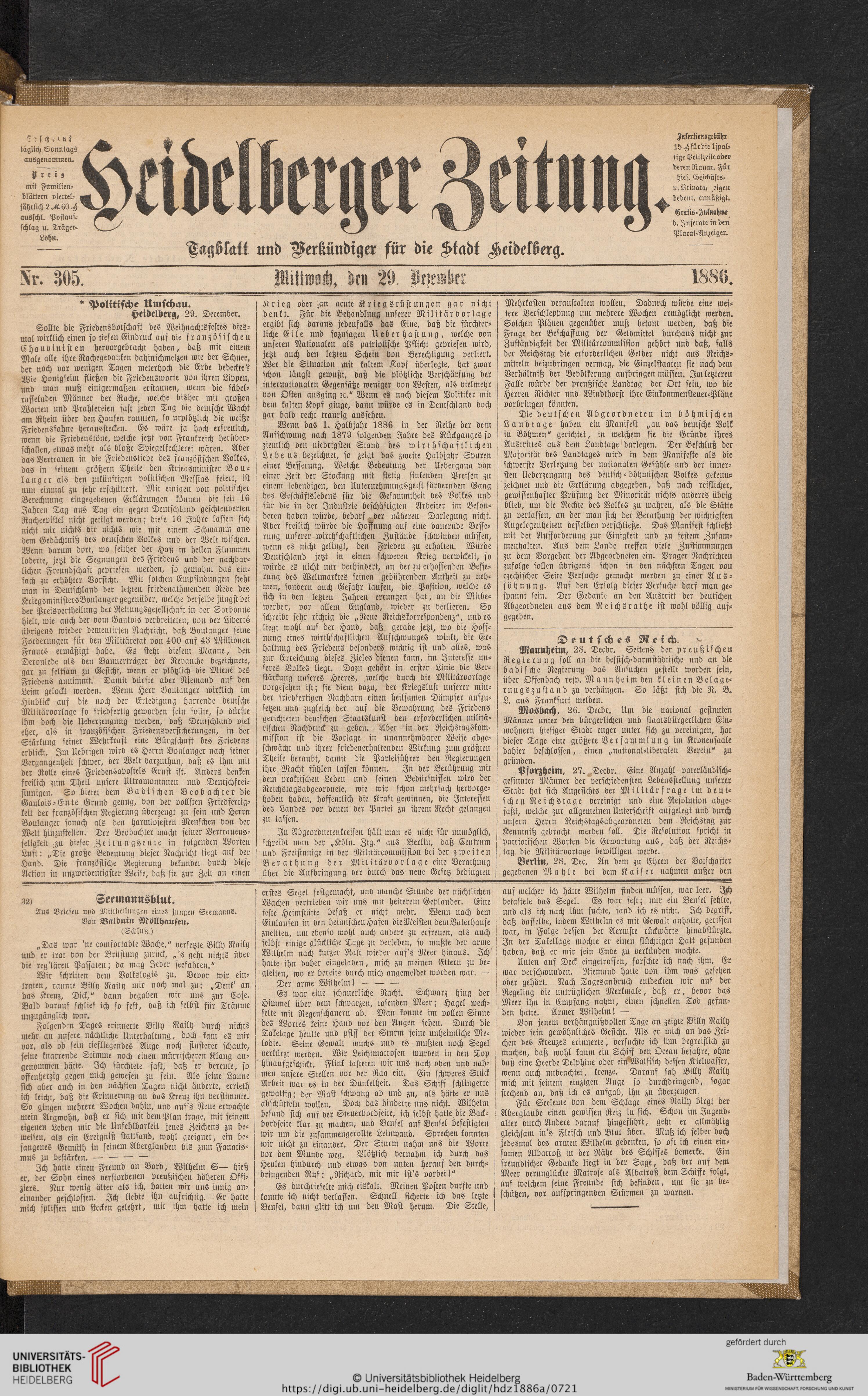. . 6 58
Wl — 4 —— —— — —— 55 8*
Tuyſchrint Jaſertionogebühr
täglich Sonntags 15.9fürdie 1ſpal-
ausgenommen. tige Petitzeile oder
Freis
mit Familien-
blättern viertel-
jährlich 24.60½
ausſchl. Poſtauf-
ſchlag u. Träger-
Lohn.
Oeidelberger
Tagblatt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg.
cilung.
deren Raum. Für
hieſ. Geſchäfts-
u. Privatal eigen
bedeut. ermäßigt.
„Aufnahue
d. Inſerate in den
Placat⸗Anzeiger.
Ir.
305.
Mittwoch, den 29. Vezember
1886.
*Politiſche Umſchau.
Heidelberg, 29. December.
Sollte die Friedensbotſchaft des Weihnachtsfeſtes dies-
mal wirklich einen ſo tiefen Eindruck auf die franzöſiſchen
Chauviniſten hervorgebracht haben, daß mit einem
Male alle ihre Rachegedanken dahinſchmelzen wie der Schnee,
der noch vor wenigen Tagen meterhoch die Erde bedeckte?
Wie Honigſeim fließen die Friedensworte von ihren Lippen,
und man muß einigermaßen erſtauuen, wenn die ſäbel-
raſſelnden Männer der Rache, welche bisher mit großen
Worten und Prahlereien faſt jeden Tag die deutſche Wacht
am Rhein über den Haufen rannten, ſo urplötzlich die weiße
Friedensfahne herausſtecken. Es wäre ja hoch erfreulich,
wenn die Friedenstöne, welche jetzt von Frankreich herüber-
ſchallen, etwas mehr als bloße Spiegelfechterei wären. Aber
das Vertrauen in die Friedensliebe des franzöſiſchen Volkes,
das in ſeinem größern Theile den Kriegsminiſter Bou-
langer als den zukünftigen politiſchen Meſſias feiert, iſt
nun einmal zu ſehr erſchüttert. Mit einigen von politiſcher
Berechnung eingegebenen Erklärungen können die ſeit 16
Jahren Tag aus Tag ein gegen Deutſchland geſchleuderten
Racheepiſtel nicht getilgt werden; dieſe 16 Jahre laſſen ſich
nicht mir nichts dir nichts wie mit einem Schwamm aus
dem Gedächtniß des deurſchen Volkes und der Welt wiſchen.
Wenn darum dort, wo ſeither der Haß in hellen Flammen
loderte, jetzt die Segnungen des Friedens und der nachbar-
lichen Freundſchaft geprieſen werden, ſo gemahnt das ein-
jſach zu erhöhter Vorſicht. Mit ſolchen Empfindungen ſteht
man in Deutſchland der letzten friedenathmenden Rede des
Kriegsminiſters Boulanger gegenüber, welche derſelbe jüngſt bei
der Preisvertheilung der Rettungsgeſellſchaft in der Sorbonne
hielt, wie auch der vom Gaulois verbreiteten, von der Liberté
übrigens wieder dementirten Nachricht, daß Boulanger ſeine
Forderungen für den Militäretat von 400 auf 43 Millionen
Francs ermäßigt habe. Es ſteht dieſem Manne, den
Deroulede als den Bannerträger der Revanche bezeichnete,
gar zu ſeltſam zu Geſicht, wenn er plötzlich die Miene des
Friedens annimmt. Damit dürfte aber Niemand auf den
Leim gelockt werden. Wenn Herr Boulanger wirklich im
Hinblick auf die noch der Erledigung harrende deutſche
Militärvorlage ſo friedfertig geworden ſein ſollte, ſo dürfte
ihm doch die Ueberzeugung werden, daß Deuliſchland viel
eher, als in franzöſiſchen Friedensverſicherungen, in der
Stärkung ſeiner Wehrkraft eine Bürgſchaft des Friedens
erblickt. Im Uebrigen wird es Herrn Boulanger nach ſeiner
Vergangenheit ſchwer, der Welt darzuthun, daß es ihm mit
der Rolle eines Friedensapoſtels Ernſt iſt. Anders denken
freilich zum Theil unſere Ultramontanen und Deutſchfrei-
ſinnigen. So bietet dem Badiſchen Beobachter die
Gaulois⸗Ente Grund genug, von der vollſten Friedfertig-
keit der franzöſiſchen Regierung überzeugt zu ſein und Herrn
Boulanger ſonach als den harmloſeſten Menſchen von der
Welt hinzuſtellen. Der Beobachter macht ſeiner Vertrauens-
ſeligkeit zu dieſer Zeitungsente in folgenden Worten
Luft: „Die große Bedeutung dieſer Nachricht liegt auf der
Hand. Die franzöſiſche Regierung bekundet durch dieſe
Action in unzweideutigſter Weiſe, daß ſie zur Zeit an einen
RKrieg oder zan acute Krieg srüſt ungen gar nicht
denkt. Für die Behandlung unſerer Militär vorlage
ergibt ſich daraus jedenfalls das Eine, daß die fürchter-
liche Gile und ſozuſagen Ueber haſtung, welche von
unferen Nationalen als patriotiſche Pflicht geprieſen wird,
jetzt auch den letzten Schein von Berechtigung verliert.
Wer die Situation mit kaltem Kopf überlegte, hat zwar
ſchon längſt gewußt, daß die plötzliche Verſchärfung der
interaationalen Gegenſätze weniger von Weſten, als vielmehr
von Oſten ausging ꝛc.“ Wenn es nach dieſem Politiker mit
dem kalten Kopf ginge, dann würde es in Deutſchland doch
gar bald recht traurig ausſehen.
Wenn das 1. Halbjahr 1886 in der Reihe der dem
Aufſchwung nach 1879 folgenden Jahre des Rückganges ſo
ziemlich den niedrigſten Stand des wirthſchaftlichen
Lebens bezeichnet, ſo zeigt das zweite Halbjahr Spuren
einer Beſſerung. Welche Bedeutung der Uebergang von
einer Zeit der Stockung mit ſtetig ſinkenden Preiſen zu
einem lebendigen, den Unternehmungsgeiſt fördernden Gang
des Geſchäftslebens für die Geſammtheit des Volkes und
für die in der Induſtrie beſchäftigten Arbeiter im Beſon-
deren haben würde, bedarf, der näheren Darlegung nicht.
Aber freilich würde die Hoffnung auf eine dauernde Beſſe-
rung unſerer wirthſchaftlichen Zuſtände ſchwinden müſſen,
wenn es nicht gelingt, den Frieden zu erhalten. Würde
Deutſchland jetzt in einen ſchweren Krieg verwickelt, ſo
würde es nicht nur verhindert, an der zu erhoffenden Beſſe-
rung des Weltmarktes ſeinen gebührenden Antheil zu neh-
men, ſondern auch Gefahr laufen, die Poſition, welche es
ſich in den letzten Jahren errungen hat, an die Mitbe-
werber, vor allem England, wieder zu verlieren. So
ſchreibt ſehr richtig die „Neue Reichskorreſpondenz“, und es
liegt wohl auf der Hand, daß gerade jetzt, wo die Hoff-
nung eines wirthſchaftlichen Aufſchwunges winkt, die Er-
haltung des Friedens beſonders wichtig iſt und alles, was
zur Erreichung dieſes Zieles dienen kann, im Intereſſe un-
ſeres Volkes liegt. Dazu gehört in erſter Linie die Ver-
ſtärkung unſeres Heeres, welche durch die Militärvorlage
vorgeſehen iſt; ſie dient dazu, der Kriegsluſt unſerer min-
der friedfertigen Nachbarn einen heilſamen Dämpfer aufzu-
ſetzen und zugleich der auf die Bewahrung des Friedens
gerichteten deutſchen Staatskunſt den erforderlichen militä-
riſchen Nachdruck zu geben. Aber in der Reichstagskom-
miſſion iſt die Vorlage in unannehmbarer Weiſe abge-
ſchwächt und ihrer friedenerhaltenden Wirkung zum größten
Theile beraubt, damit die Parteiführer den Regierungen
ihre Macht fühlen laſſen können. In der Berührung mit
dem praktiſchen Leben und ſeinen Bedürfniſſen wird der
Reichstagsabgeordnete, wie wir ſchon mehrfach hervorge-
hoben haben, hoffentlich die Kraft gewinnen, die Intereſſen
des Landes vor denen der Partei zu ihrem Recht gelangen
zu laſſen.
In Abgeordnetenkreiſen hält man es nicht für unmöglich,
ſchreibt man der „Köln. Ztg.“ aus Berlin, daß Centrum
und Freiſinnige in der Militärcommiſſion bei der zweiten
Berathung der Militärvorlage eine Berathung
über die Aufbringung der durch das neue Geſetz bedingten
Mehrkoſten veranſtalten wollen. Dadurch würde eine wei-
tere Verſchleppung um mehrere Wochen ermöglicht werden.
Solchen Plänen gegenüber muß betont werden, daß die
Frage der Beſchaffung der Geldmittel durchaus nicht zur
Zuſtändigkeit der Militärcommiſſton gehört und daß, falls
der Reichstag die erforderlichen Gelder nicht aus Reichs-
mitteln beizubringen vermag, die Einzelſtaaten ſie nach dem
Verhältniß der Bevölkerung aufbringen müſſen. Im letzteren
Falle würde der preußiſche Landtag der Ort ſein, wo die
Herren Richter und Windthorſt ihre Einkommenſteuer⸗Pläne
vorbringen könnten.
Die deutſchen Abgeordneten im böhmiſchen
Landtage haben ein Manifeſt „an das deutſche Volk
in Böhmen“ gerichtet, in welchem ſie die Gründe ihres
Austrittes aus dem Landtage darlegen. Der Beſchluß der
Majorität des Landtages wird in dem Manifeſte als die
ſchwerſte Verletzung der nationalen Gefühle und der inner-
ſten Ueberzeugung des deutſch⸗ böhmiſchen Volkes gekenn-
zeichnet und die Erklärung abgegeben, daß nach reiflicher,
gewiſſenhafter Prüfung der Minorität nichts anderes übrig
blieb, um die Rechte des Volkes zu wahren, als die Stätte
zu verlaſſen, an der man ſich der Berathung der wichtigſten
Angelegenheiten deſſelben verſchließe. Das Manifeſt ſchließt
mit der Aufforderung zur Einigkeit und zu feſtem Zuſam-
menhalten. Aus dem Lande treffen viele Zuſtimmungen
zu dem Vorgehen der Abgeordneten ein. Prager Nachrichten
zufolge ſollen übrigens ſchon in den nächſten Tagen von
czechiſcher Seite Verſuche gemacht werden zu einer Aus-
ſöhnung. Auf den Erfolg dieſer Verſuche darf man ge-
ſpannt ſein. Der Gedanke an den Austritt der deutſchen
Abgeordneten aus dem Reichsrathe iſt wohl völlig auf-
gegeben.
Deutſches Rei ch.
Mannheim, 28. Decbr. Seitens der preußiſchen
Regierung ſoll an die heſſiſch⸗darmſtädtiſche und an die
badiſche Regierung das Anſuchen geſtellt worden ſein,
über Offenbach reſpv. Mann heim den kleinen Belage-
rungszuſtand zu verhängen. So läßt ſich die N. B.
L. aus Frankfurt melden.
Mosbach, 26. Decbr. Um die national geſinnten
Männer unter den bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Ein-
wohnern hieſiger Stadt enger unter ſich zu vereinigen, hat
dieſer Tage eine größere Verſammlung im Kronenſaale
dahier beſchloſſen, einen „national⸗liberalen Verein“ zu
gründen.
Pforzheim, 27. Decbr. Eine Anzahl vaterländiſch-
geſinnter Männer der „erſchiedenſten Lebensſtellung unſerer
Stadt hat ſich Angeſichts der Militärfrage im deut-
ſchen Reichstage vereinigt und eine Reſolution abge-
faßt, welche zur allgemeinen Unterſchrift aufgelegt und durch
unſern Herrn Reichstagsabgeordneten dem Reichstag zur
Kenntniß gebracht werden ſoll. Die Reſolution ſpricht in
patriotiſchen Worten die Erwartung aus, daß der Reichs-
tag die Militärvorlage bewilligen werde.
Berlin, 28. Dec. An dem zu Ehren der Botſchafter
gegebenen Mahle bei dem Kaiſer nahmen außer den
———
32 Seemannsblut.
Aus Briefen und Mittheilungen eines jungen Seemanns.
Von Balduin Möllhauſen.
(Schluß.)
„Das war 'ne comfortable Wache,“ verſetzt Billy Raily
und er trat von der Brüſtung zurück, „'s geht nichts über
die reg'lären Paſſaten; da mag Jeder ſeefahren.“
Wir ſchritten dem Volkslogis zu. Bevor wir ein-
traten, raunte Billy Railh mir noch mal zu: „Denk' an
das Kreuz, Dick,“ dann begaben wir uns zur Coje.
Bald darauf ſchlief ich ſo feſt, daß ich ſelbſt für Träume
unzugänglich war.
Folgenden Tages erinnerte Billy Railh durch nichts
mehr an unſere nächtliche Unterhaltung, doch kam es mir
vor, als ob ſein tiefliegendes Auge noch finſterer ſchaute,
ſeine knarrende Stimme noch einen mürriſcheren Klang an-
genommen hätte. Ich fürchtete faſt, daß er bereute, ſo
offenherzig gegen mich geweſen zu ſein. Als ſeine Laune
ſich aber auch in den nächſten Tagen nicht änderte, errieth
ich leicht, daß die Erinnerung an das Kreuz ihn verſtimmte.
So gingen mehrere Wochen dahin, und auf's Neue erwachte
mein Argwohn, daß er ſich mit dem Plan trage, mit ſeinem
eigenen Leben mir die Unfehlbarkeit jenes Zeichens zu be-
weiſen, als ein Ereigniß ſtattfand, wohl geeignet, ein be-
fangenes Gemüth in ſeinem Aberglauben bis zum Fanatis-
mus zu beſtärken. — — — —
Ich hatie einen Freund an Bord, Wilhelm S— hieß
er, der Sohn eines verſtorbenen preußiſchen höheren Offi-
ziers. Nur wenig älter als ich, hatten wir uns innig an-
einander geſchloſſen. Ich liebte ihn aufrichtig. Er hatte
mich ſpliſſen und ſtecken gelehrt, mit ihm hatte ich mein
hinaufgeſchickt.
erſtes Segel feſtgemacht, und manche Stunde der nächtlichen
Wachen vertrieben wir uns mit heiterem Geplauder. Eine
feſte Heimſtätte beſaß er nicht mehr.
Einlaufen in den heimiſchen Hafen die Meiſten dem Vaterhauſe
zueilten, um ebenſo wohl auch andere zu erfreuen, als auch
ſelbſt einige glückliche Tage zu verleben, ſo mußte der arme
Wilhelm nach kurzer Raſt wieder auf's Meer hinaus.
hatte ihn daher eingeladen, mich zu meinen Eltern zu be-
gleiten, wo er bereits durch mich angemeldet worden war. —
Der arme Wilhelm! — — —
Es war eine ſchauerliche Nacht. Schwarz hing der
Himmel über dem ſchwarzen, toſenden Meer; Hagel wech-
ſelte mit Regenſchauern ab. Man konnte im vollen Sinne
des Wortes keine Hand vor den Augen ſehen. Durch die
Takelage heulte und pfiff der Sturm ſeine unheimliche Me-
lodie. Seine Gewalt wuchs und es mußten noch Segel
verkürzt werden. Wir Leichtmatroſen wurden in den Top
Flink taſteten wir uns nach oben und nah-
men unſere Stellen vor der Raa ein. Ein ſchweres Stück
Arbeit war es in der Dunkelheit. Das Schiff ſchlingerte
gewaltig; der Maſt ſchwang ab und zu, als hätte er uns
abſchütteln wollen. Doch das hinderte uns nicht. Wilhelm
befand ſich auf der Steuerbordſeite, ich ſelbſt hatte die Backö-
bordſeite klar zu machen, und Benſel auf Benſel befeſtigten
wir um die zuſammengerollte Leinwand. Sprechen konnten
wir nicht zu einander. Der Sturm nahm uns die Worte
vor dem Munde weg. Plötzlich vernahm ich durch das
Heulen hindurch und etwas von unten herauf den durch-
dringenden Ruf: „Richard, mit mir iſt's vorbei!“
Es durchrieſelte mich eiskalt. Meinen Poſten durfte und
konnte ich nicht verlaſſen. Schnell ſicherte ich das letzte
Ich
auf welcher ich hätte Wilhelm finden müſſen, war leer. Ich
Wenn nach dem ö
nur ein Benſel fehlte,
betaſtete das Segel. Es war feſt;
Ich begriff,
und als ich nach ihm ſuchte, fand ich es nicht.
daß daſſelbe, indem Wilhelm es mit Gewalt anholte, geriſſen
Benſel, dann glitt ich um den Maſt herum. Die Stelle,
war, in Folge deſſen der Aermſte rückwärts hinabſtürzte.
In der Takellage mochte er einen flüchtigen Halt gefunden
haben, daß er mir ſein Ende zu verkünden mochte.
Unten auf Deck eingetroffen, forſchte ich nach ihm. Er
war verſchwunden. Niemand hatte von ihm was geſehen
oder gehört. Nach Tagesanbruch entdeckten wir auf der
Regeling die untrüglichen Merkmale, daß er, bevor das
Meer ihn in Empfang nahm, einen ſchnellen Tod gefun-
den hatte. Armer Wilhelm! —
Von jenem verhängnißvollen Tage an zeigte Billy Raily
wieder ſein gewöhnliches Geſicht. Als er mich an das Zei-
chen des Kreuzes erinnerte, verſuchte ich ihm begreiflich zu
machen, daß wohl kaum ein Schiff den Ocean befahre, ohne
daß eine Heerde Delphine oder ein Walfiſch deſſen Kielwaſſer,
wenn auch unbeachtet, kreuze. Darauf ſah Billy Raily
mich mit ſeinem einzigen Auge ſo durchdringend, ſogar
ſtechend an, daß ich es aufgab, ihn zu überzeugen.
Für Seeleute von dem Schlage eines Raily birgt der
Aberglaube einen gewiſſen Reiz in ſich. Schon im Jugend-
alter durch Andere darauf hingeführt, geht er allmählig
gleichſam in's Fleiſch und Blut über. Muß ich ſelber doch
jedesmal des armen Wilhelm gedenken, ſo oft ich einen ein-
ſamen Albatroß in der Nähe des Schiffes bemerke. Ein
freundlicher Gedanke liegt in der Sage, daß der auf dem
Meer verunglückte Matroſe als Albatroß dem Schiffe folgt,
auf welchem ſeine Freunde ſich befinden, um ſie zu be-
ſchützen, vor aufſpringenden Stürmen zu warnen.
Wl — 4 —— —— — —— 55 8*
Tuyſchrint Jaſertionogebühr
täglich Sonntags 15.9fürdie 1ſpal-
ausgenommen. tige Petitzeile oder
Freis
mit Familien-
blättern viertel-
jährlich 24.60½
ausſchl. Poſtauf-
ſchlag u. Träger-
Lohn.
Oeidelberger
Tagblatt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg.
cilung.
deren Raum. Für
hieſ. Geſchäfts-
u. Privatal eigen
bedeut. ermäßigt.
„Aufnahue
d. Inſerate in den
Placat⸗Anzeiger.
Ir.
305.
Mittwoch, den 29. Vezember
1886.
*Politiſche Umſchau.
Heidelberg, 29. December.
Sollte die Friedensbotſchaft des Weihnachtsfeſtes dies-
mal wirklich einen ſo tiefen Eindruck auf die franzöſiſchen
Chauviniſten hervorgebracht haben, daß mit einem
Male alle ihre Rachegedanken dahinſchmelzen wie der Schnee,
der noch vor wenigen Tagen meterhoch die Erde bedeckte?
Wie Honigſeim fließen die Friedensworte von ihren Lippen,
und man muß einigermaßen erſtauuen, wenn die ſäbel-
raſſelnden Männer der Rache, welche bisher mit großen
Worten und Prahlereien faſt jeden Tag die deutſche Wacht
am Rhein über den Haufen rannten, ſo urplötzlich die weiße
Friedensfahne herausſtecken. Es wäre ja hoch erfreulich,
wenn die Friedenstöne, welche jetzt von Frankreich herüber-
ſchallen, etwas mehr als bloße Spiegelfechterei wären. Aber
das Vertrauen in die Friedensliebe des franzöſiſchen Volkes,
das in ſeinem größern Theile den Kriegsminiſter Bou-
langer als den zukünftigen politiſchen Meſſias feiert, iſt
nun einmal zu ſehr erſchüttert. Mit einigen von politiſcher
Berechnung eingegebenen Erklärungen können die ſeit 16
Jahren Tag aus Tag ein gegen Deutſchland geſchleuderten
Racheepiſtel nicht getilgt werden; dieſe 16 Jahre laſſen ſich
nicht mir nichts dir nichts wie mit einem Schwamm aus
dem Gedächtniß des deurſchen Volkes und der Welt wiſchen.
Wenn darum dort, wo ſeither der Haß in hellen Flammen
loderte, jetzt die Segnungen des Friedens und der nachbar-
lichen Freundſchaft geprieſen werden, ſo gemahnt das ein-
jſach zu erhöhter Vorſicht. Mit ſolchen Empfindungen ſteht
man in Deutſchland der letzten friedenathmenden Rede des
Kriegsminiſters Boulanger gegenüber, welche derſelbe jüngſt bei
der Preisvertheilung der Rettungsgeſellſchaft in der Sorbonne
hielt, wie auch der vom Gaulois verbreiteten, von der Liberté
übrigens wieder dementirten Nachricht, daß Boulanger ſeine
Forderungen für den Militäretat von 400 auf 43 Millionen
Francs ermäßigt habe. Es ſteht dieſem Manne, den
Deroulede als den Bannerträger der Revanche bezeichnete,
gar zu ſeltſam zu Geſicht, wenn er plötzlich die Miene des
Friedens annimmt. Damit dürfte aber Niemand auf den
Leim gelockt werden. Wenn Herr Boulanger wirklich im
Hinblick auf die noch der Erledigung harrende deutſche
Militärvorlage ſo friedfertig geworden ſein ſollte, ſo dürfte
ihm doch die Ueberzeugung werden, daß Deuliſchland viel
eher, als in franzöſiſchen Friedensverſicherungen, in der
Stärkung ſeiner Wehrkraft eine Bürgſchaft des Friedens
erblickt. Im Uebrigen wird es Herrn Boulanger nach ſeiner
Vergangenheit ſchwer, der Welt darzuthun, daß es ihm mit
der Rolle eines Friedensapoſtels Ernſt iſt. Anders denken
freilich zum Theil unſere Ultramontanen und Deutſchfrei-
ſinnigen. So bietet dem Badiſchen Beobachter die
Gaulois⸗Ente Grund genug, von der vollſten Friedfertig-
keit der franzöſiſchen Regierung überzeugt zu ſein und Herrn
Boulanger ſonach als den harmloſeſten Menſchen von der
Welt hinzuſtellen. Der Beobachter macht ſeiner Vertrauens-
ſeligkeit zu dieſer Zeitungsente in folgenden Worten
Luft: „Die große Bedeutung dieſer Nachricht liegt auf der
Hand. Die franzöſiſche Regierung bekundet durch dieſe
Action in unzweideutigſter Weiſe, daß ſie zur Zeit an einen
RKrieg oder zan acute Krieg srüſt ungen gar nicht
denkt. Für die Behandlung unſerer Militär vorlage
ergibt ſich daraus jedenfalls das Eine, daß die fürchter-
liche Gile und ſozuſagen Ueber haſtung, welche von
unferen Nationalen als patriotiſche Pflicht geprieſen wird,
jetzt auch den letzten Schein von Berechtigung verliert.
Wer die Situation mit kaltem Kopf überlegte, hat zwar
ſchon längſt gewußt, daß die plötzliche Verſchärfung der
interaationalen Gegenſätze weniger von Weſten, als vielmehr
von Oſten ausging ꝛc.“ Wenn es nach dieſem Politiker mit
dem kalten Kopf ginge, dann würde es in Deutſchland doch
gar bald recht traurig ausſehen.
Wenn das 1. Halbjahr 1886 in der Reihe der dem
Aufſchwung nach 1879 folgenden Jahre des Rückganges ſo
ziemlich den niedrigſten Stand des wirthſchaftlichen
Lebens bezeichnet, ſo zeigt das zweite Halbjahr Spuren
einer Beſſerung. Welche Bedeutung der Uebergang von
einer Zeit der Stockung mit ſtetig ſinkenden Preiſen zu
einem lebendigen, den Unternehmungsgeiſt fördernden Gang
des Geſchäftslebens für die Geſammtheit des Volkes und
für die in der Induſtrie beſchäftigten Arbeiter im Beſon-
deren haben würde, bedarf, der näheren Darlegung nicht.
Aber freilich würde die Hoffnung auf eine dauernde Beſſe-
rung unſerer wirthſchaftlichen Zuſtände ſchwinden müſſen,
wenn es nicht gelingt, den Frieden zu erhalten. Würde
Deutſchland jetzt in einen ſchweren Krieg verwickelt, ſo
würde es nicht nur verhindert, an der zu erhoffenden Beſſe-
rung des Weltmarktes ſeinen gebührenden Antheil zu neh-
men, ſondern auch Gefahr laufen, die Poſition, welche es
ſich in den letzten Jahren errungen hat, an die Mitbe-
werber, vor allem England, wieder zu verlieren. So
ſchreibt ſehr richtig die „Neue Reichskorreſpondenz“, und es
liegt wohl auf der Hand, daß gerade jetzt, wo die Hoff-
nung eines wirthſchaftlichen Aufſchwunges winkt, die Er-
haltung des Friedens beſonders wichtig iſt und alles, was
zur Erreichung dieſes Zieles dienen kann, im Intereſſe un-
ſeres Volkes liegt. Dazu gehört in erſter Linie die Ver-
ſtärkung unſeres Heeres, welche durch die Militärvorlage
vorgeſehen iſt; ſie dient dazu, der Kriegsluſt unſerer min-
der friedfertigen Nachbarn einen heilſamen Dämpfer aufzu-
ſetzen und zugleich der auf die Bewahrung des Friedens
gerichteten deutſchen Staatskunſt den erforderlichen militä-
riſchen Nachdruck zu geben. Aber in der Reichstagskom-
miſſion iſt die Vorlage in unannehmbarer Weiſe abge-
ſchwächt und ihrer friedenerhaltenden Wirkung zum größten
Theile beraubt, damit die Parteiführer den Regierungen
ihre Macht fühlen laſſen können. In der Berührung mit
dem praktiſchen Leben und ſeinen Bedürfniſſen wird der
Reichstagsabgeordnete, wie wir ſchon mehrfach hervorge-
hoben haben, hoffentlich die Kraft gewinnen, die Intereſſen
des Landes vor denen der Partei zu ihrem Recht gelangen
zu laſſen.
In Abgeordnetenkreiſen hält man es nicht für unmöglich,
ſchreibt man der „Köln. Ztg.“ aus Berlin, daß Centrum
und Freiſinnige in der Militärcommiſſion bei der zweiten
Berathung der Militärvorlage eine Berathung
über die Aufbringung der durch das neue Geſetz bedingten
Mehrkoſten veranſtalten wollen. Dadurch würde eine wei-
tere Verſchleppung um mehrere Wochen ermöglicht werden.
Solchen Plänen gegenüber muß betont werden, daß die
Frage der Beſchaffung der Geldmittel durchaus nicht zur
Zuſtändigkeit der Militärcommiſſton gehört und daß, falls
der Reichstag die erforderlichen Gelder nicht aus Reichs-
mitteln beizubringen vermag, die Einzelſtaaten ſie nach dem
Verhältniß der Bevölkerung aufbringen müſſen. Im letzteren
Falle würde der preußiſche Landtag der Ort ſein, wo die
Herren Richter und Windthorſt ihre Einkommenſteuer⸗Pläne
vorbringen könnten.
Die deutſchen Abgeordneten im böhmiſchen
Landtage haben ein Manifeſt „an das deutſche Volk
in Böhmen“ gerichtet, in welchem ſie die Gründe ihres
Austrittes aus dem Landtage darlegen. Der Beſchluß der
Majorität des Landtages wird in dem Manifeſte als die
ſchwerſte Verletzung der nationalen Gefühle und der inner-
ſten Ueberzeugung des deutſch⸗ böhmiſchen Volkes gekenn-
zeichnet und die Erklärung abgegeben, daß nach reiflicher,
gewiſſenhafter Prüfung der Minorität nichts anderes übrig
blieb, um die Rechte des Volkes zu wahren, als die Stätte
zu verlaſſen, an der man ſich der Berathung der wichtigſten
Angelegenheiten deſſelben verſchließe. Das Manifeſt ſchließt
mit der Aufforderung zur Einigkeit und zu feſtem Zuſam-
menhalten. Aus dem Lande treffen viele Zuſtimmungen
zu dem Vorgehen der Abgeordneten ein. Prager Nachrichten
zufolge ſollen übrigens ſchon in den nächſten Tagen von
czechiſcher Seite Verſuche gemacht werden zu einer Aus-
ſöhnung. Auf den Erfolg dieſer Verſuche darf man ge-
ſpannt ſein. Der Gedanke an den Austritt der deutſchen
Abgeordneten aus dem Reichsrathe iſt wohl völlig auf-
gegeben.
Deutſches Rei ch.
Mannheim, 28. Decbr. Seitens der preußiſchen
Regierung ſoll an die heſſiſch⸗darmſtädtiſche und an die
badiſche Regierung das Anſuchen geſtellt worden ſein,
über Offenbach reſpv. Mann heim den kleinen Belage-
rungszuſtand zu verhängen. So läßt ſich die N. B.
L. aus Frankfurt melden.
Mosbach, 26. Decbr. Um die national geſinnten
Männer unter den bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Ein-
wohnern hieſiger Stadt enger unter ſich zu vereinigen, hat
dieſer Tage eine größere Verſammlung im Kronenſaale
dahier beſchloſſen, einen „national⸗liberalen Verein“ zu
gründen.
Pforzheim, 27. Decbr. Eine Anzahl vaterländiſch-
geſinnter Männer der „erſchiedenſten Lebensſtellung unſerer
Stadt hat ſich Angeſichts der Militärfrage im deut-
ſchen Reichstage vereinigt und eine Reſolution abge-
faßt, welche zur allgemeinen Unterſchrift aufgelegt und durch
unſern Herrn Reichstagsabgeordneten dem Reichstag zur
Kenntniß gebracht werden ſoll. Die Reſolution ſpricht in
patriotiſchen Worten die Erwartung aus, daß der Reichs-
tag die Militärvorlage bewilligen werde.
Berlin, 28. Dec. An dem zu Ehren der Botſchafter
gegebenen Mahle bei dem Kaiſer nahmen außer den
———
32 Seemannsblut.
Aus Briefen und Mittheilungen eines jungen Seemanns.
Von Balduin Möllhauſen.
(Schluß.)
„Das war 'ne comfortable Wache,“ verſetzt Billy Raily
und er trat von der Brüſtung zurück, „'s geht nichts über
die reg'lären Paſſaten; da mag Jeder ſeefahren.“
Wir ſchritten dem Volkslogis zu. Bevor wir ein-
traten, raunte Billy Railh mir noch mal zu: „Denk' an
das Kreuz, Dick,“ dann begaben wir uns zur Coje.
Bald darauf ſchlief ich ſo feſt, daß ich ſelbſt für Träume
unzugänglich war.
Folgenden Tages erinnerte Billy Railh durch nichts
mehr an unſere nächtliche Unterhaltung, doch kam es mir
vor, als ob ſein tiefliegendes Auge noch finſterer ſchaute,
ſeine knarrende Stimme noch einen mürriſcheren Klang an-
genommen hätte. Ich fürchtete faſt, daß er bereute, ſo
offenherzig gegen mich geweſen zu ſein. Als ſeine Laune
ſich aber auch in den nächſten Tagen nicht änderte, errieth
ich leicht, daß die Erinnerung an das Kreuz ihn verſtimmte.
So gingen mehrere Wochen dahin, und auf's Neue erwachte
mein Argwohn, daß er ſich mit dem Plan trage, mit ſeinem
eigenen Leben mir die Unfehlbarkeit jenes Zeichens zu be-
weiſen, als ein Ereigniß ſtattfand, wohl geeignet, ein be-
fangenes Gemüth in ſeinem Aberglauben bis zum Fanatis-
mus zu beſtärken. — — — —
Ich hatie einen Freund an Bord, Wilhelm S— hieß
er, der Sohn eines verſtorbenen preußiſchen höheren Offi-
ziers. Nur wenig älter als ich, hatten wir uns innig an-
einander geſchloſſen. Ich liebte ihn aufrichtig. Er hatte
mich ſpliſſen und ſtecken gelehrt, mit ihm hatte ich mein
hinaufgeſchickt.
erſtes Segel feſtgemacht, und manche Stunde der nächtlichen
Wachen vertrieben wir uns mit heiterem Geplauder. Eine
feſte Heimſtätte beſaß er nicht mehr.
Einlaufen in den heimiſchen Hafen die Meiſten dem Vaterhauſe
zueilten, um ebenſo wohl auch andere zu erfreuen, als auch
ſelbſt einige glückliche Tage zu verleben, ſo mußte der arme
Wilhelm nach kurzer Raſt wieder auf's Meer hinaus.
hatte ihn daher eingeladen, mich zu meinen Eltern zu be-
gleiten, wo er bereits durch mich angemeldet worden war. —
Der arme Wilhelm! — — —
Es war eine ſchauerliche Nacht. Schwarz hing der
Himmel über dem ſchwarzen, toſenden Meer; Hagel wech-
ſelte mit Regenſchauern ab. Man konnte im vollen Sinne
des Wortes keine Hand vor den Augen ſehen. Durch die
Takelage heulte und pfiff der Sturm ſeine unheimliche Me-
lodie. Seine Gewalt wuchs und es mußten noch Segel
verkürzt werden. Wir Leichtmatroſen wurden in den Top
Flink taſteten wir uns nach oben und nah-
men unſere Stellen vor der Raa ein. Ein ſchweres Stück
Arbeit war es in der Dunkelheit. Das Schiff ſchlingerte
gewaltig; der Maſt ſchwang ab und zu, als hätte er uns
abſchütteln wollen. Doch das hinderte uns nicht. Wilhelm
befand ſich auf der Steuerbordſeite, ich ſelbſt hatte die Backö-
bordſeite klar zu machen, und Benſel auf Benſel befeſtigten
wir um die zuſammengerollte Leinwand. Sprechen konnten
wir nicht zu einander. Der Sturm nahm uns die Worte
vor dem Munde weg. Plötzlich vernahm ich durch das
Heulen hindurch und etwas von unten herauf den durch-
dringenden Ruf: „Richard, mit mir iſt's vorbei!“
Es durchrieſelte mich eiskalt. Meinen Poſten durfte und
konnte ich nicht verlaſſen. Schnell ſicherte ich das letzte
Ich
auf welcher ich hätte Wilhelm finden müſſen, war leer. Ich
Wenn nach dem ö
nur ein Benſel fehlte,
betaſtete das Segel. Es war feſt;
Ich begriff,
und als ich nach ihm ſuchte, fand ich es nicht.
daß daſſelbe, indem Wilhelm es mit Gewalt anholte, geriſſen
Benſel, dann glitt ich um den Maſt herum. Die Stelle,
war, in Folge deſſen der Aermſte rückwärts hinabſtürzte.
In der Takellage mochte er einen flüchtigen Halt gefunden
haben, daß er mir ſein Ende zu verkünden mochte.
Unten auf Deck eingetroffen, forſchte ich nach ihm. Er
war verſchwunden. Niemand hatte von ihm was geſehen
oder gehört. Nach Tagesanbruch entdeckten wir auf der
Regeling die untrüglichen Merkmale, daß er, bevor das
Meer ihn in Empfang nahm, einen ſchnellen Tod gefun-
den hatte. Armer Wilhelm! —
Von jenem verhängnißvollen Tage an zeigte Billy Raily
wieder ſein gewöhnliches Geſicht. Als er mich an das Zei-
chen des Kreuzes erinnerte, verſuchte ich ihm begreiflich zu
machen, daß wohl kaum ein Schiff den Ocean befahre, ohne
daß eine Heerde Delphine oder ein Walfiſch deſſen Kielwaſſer,
wenn auch unbeachtet, kreuze. Darauf ſah Billy Raily
mich mit ſeinem einzigen Auge ſo durchdringend, ſogar
ſtechend an, daß ich es aufgab, ihn zu überzeugen.
Für Seeleute von dem Schlage eines Raily birgt der
Aberglaube einen gewiſſen Reiz in ſich. Schon im Jugend-
alter durch Andere darauf hingeführt, geht er allmählig
gleichſam in's Fleiſch und Blut über. Muß ich ſelber doch
jedesmal des armen Wilhelm gedenken, ſo oft ich einen ein-
ſamen Albatroß in der Nähe des Schiffes bemerke. Ein
freundlicher Gedanke liegt in der Sage, daß der auf dem
Meer verunglückte Matroſe als Albatroß dem Schiffe folgt,
auf welchem ſeine Freunde ſich befinden, um ſie zu be-
ſchützen, vor aufſpringenden Stürmen zu warnen.