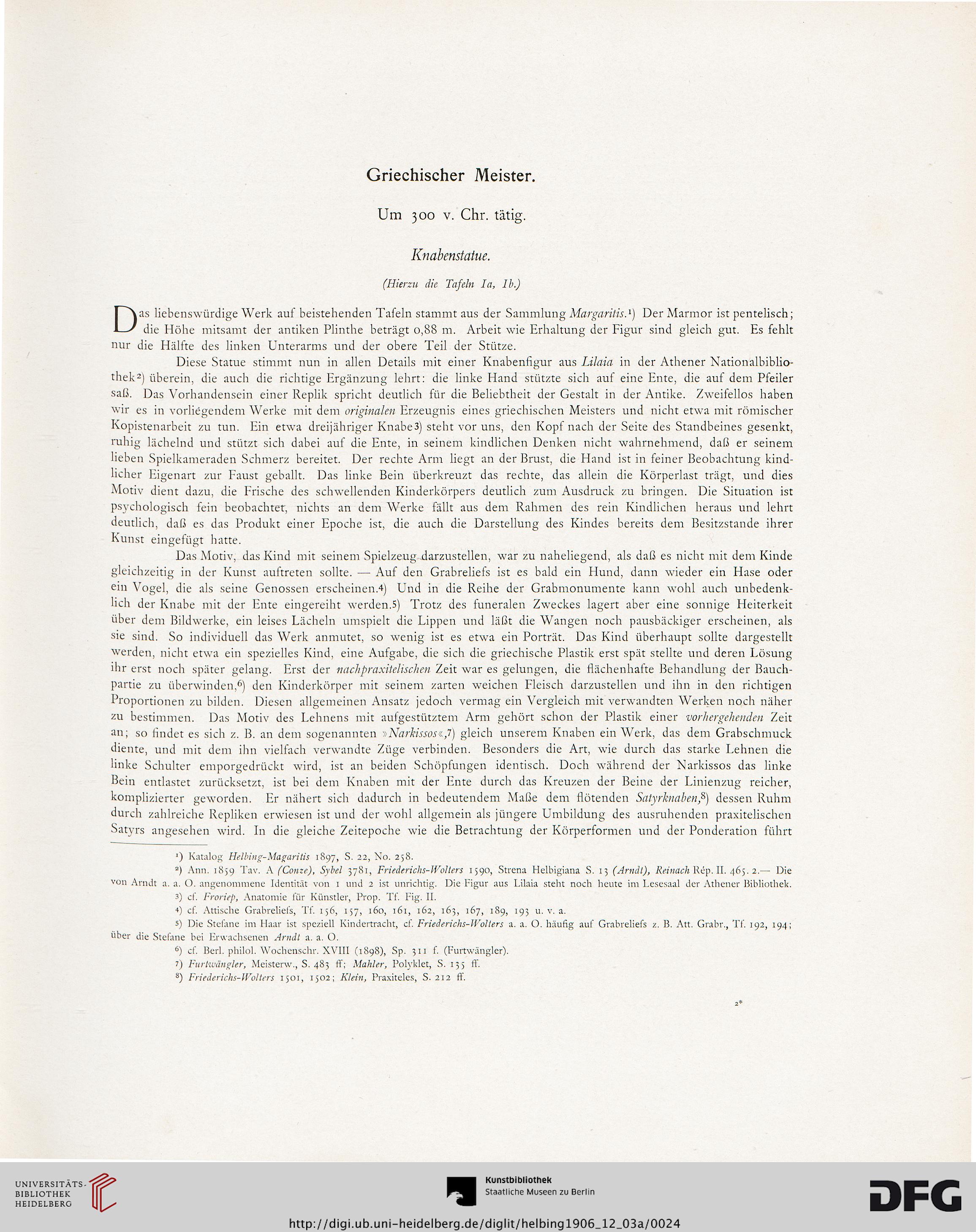Griechischer Meister.
Um 300 v. Chr. tätig.
Knabenstatue.
(Hierzu die Tafeln Ia, lb.)
Das liebenswürdige Werk auf beistehenden Tafeln stammt aus der Sammlung Margaritis.1) Der Marmor ist pentelisch;
die Höhe mitsamt der antiken Plinthe beträgt 0,88 m. Arbeit wie Erhaltung der Figur sind gleich gut. Es fehlt
nur die Hälfte des linken Unterarms und der obere Teil der Stütze.
Diese Statue stimmt nun in allen Details mit einer Knabenfigur aus Lilaia in der Athener Nationalbiblio-
thek2) überein, die auch die richtige Ergänzung lehrt: die linke Hand stützte sich auf eine Ente, die auf dem Pfeiler
saß. Das Vorhandensein einer Replik spricht deutlich für die Beliebtheit der Gestalt in der Antike. Zweifellos haben
wir es in vorliegendem Werke mit dem originalen Erzeugnis eines griechischen Meisters und nicht etwa mit römischer
Kopistenarbeit zu tun. Ein etwa dreijähriger Knabe3) steht vor uns, den Kopf nach der Seite des Standbeines gesenkt,
ruhig lächelnd und stützt sich dabei auf die Ente, in seinem kindlichen Denken nicht wahrnehmend, daß er seinem
lieben Spielkameraden Schmerz bereitet. Der rechte Arm liegt an der Brust, die Hand ist in feiner Beobachtung kind-
licher Eigenart zur Faust geballt. Das linke Bein überkreuzt das rechte, das allein die Körperlast trägt, und dies
Motiv dient dazu, die Frische des schwellenden Kinderkörpers deutlich zum Ausdruck zu bringen. Die Situation ist
psychologisch fein beobachtet, nichts an dem Werke fällt aus dem Rahmen des rein Kindlichen heraus und lehrt
deutlich, daß es das Produkt einer Epoche ist, die auch die Darstellung des Kindes bereits dem Besitzstande ihrer
Kunst eingefügt hatte.
Das Motiv, das Kind mit seinem Spielzeug darzustellen, war zu naheliegend, als daß es nicht mit dem Kinde
gleichzeitig in der Kunst auftreten sollte. — Auf den Grabreliefs ist es bald ein Hund, dann wieder ein Hase oder
ein Vogel, die als seine Genossen erscheinen.4) Und in die Reihe der Grabmonumente kann wohl auch unbedenk-
lich der Knabe mit der Ente eingereiht werden.5) Trotz des funeralen Zweckes lagert aber eine sonnige Heiterkeit
über dem Bildwerke, ein leises Lächeln umspielt die Lippen und läßt die Wangen noch pausbäckiger erscheinen, als
sie sind. So individuell das Werk anmutet, so wenig ist es etwa ein Porträt. Das Kind überhaupt sollte dargestellt
werden, nicht etwa ein spezielles Kind, eine Aufgabe, die sich die griechische Plastik erst spät stellte und deren Lösung
ihr erst noch später gelang. Erst der naclipraxitelischen Zeit war es gelungen, die flächenhafte Behandlung der Bauch-
partie zu überwinden,6) den Kinderkörper mit seinem zarten weichen Fleisch darzustellen und ihn in den richtigen
Proportionen zu bilden. Diesen allgemeinen Ansatz jedoch vermag ein Vergleich mit verwandten Werken noch näher
zu bestimmen. Das Motiv des Lehnens mit aufgestütztem Arm gehört schon der Plastik einer vorhergehenden Zeit
an; so findet es sich z. B. an dem sogenannten y>Narkissos«,7) gleich unserem Knaben ein Werk, das dem Grabschmuck
diente, und mit dem ihn vielfach verwandte Züge verbinden. Besonders die Art, wie durch das starke Lehnen die
linke Schulter emporgedrückt wird, ist an beiden Schöpfungen identisch. Doch während der Narkissos das linke
Bein entlastet zurücksetzt, ist bei dem Knaben mit der Ente durch das Kreuzen der Beine der Linienzug reicher,
komplizierter geworden. Er nähert sich dadurch in bedeutendem Maße dem flötenden Satyrknaben?) dessen Ruhm
durch zahlreiche Repliken erwiesen ist und der wohl allgemein als jüngere Umbildung des ausruhenden praxitelischen
Satyrs angesehen wird. In die gleiche Zeitepoche wie die Betrachtung der Körperformen und der Ponderation führt
') Katalog Helbing-Magaritis 1897, S. 22, No. 258.
2) Ann. 1859 Tav. A (Conze), Sybel 3781, Friederichs-Wolters 1590, Strena Helbigiana S. 13 (Arndt), Reinach Rep. II. 465. 2.— Die
von Arndt a. a. O. angenommene Identität von 1 und 2 ist unrichtig. Die Figur aus Lilaia steht noch heute im Lesesaal der Athener Bibliothek.
3) cf. Froriep, Anatomie für Künstler, Prop. Tf. Fig. II.
*) cf. Attische Grabreliefs, Tf. 156, 157, 160, 161, 162, 163, 167, 189, 193 u.v.a.
s) Die Stefane im Haar ist speziell Kindertracht, cf. Friederichs-Wolters a. a. Ü. häufig auf Grabreliefs z. B. Att. Grabr., Tf. 192, 194;
über die Stefane bei Erwachsenen Arndt a. a. O.
6) cf. Herl, philol. Wochenschr. XVIII (1898), Sp. 3 11 f. (Furtwängler).
7) Furtwängler, Meisterw., S. 483 ff; Mahler, Polyklet, S. 135 ff.
8) Friederichs-Wolters 1501, 1502; Klein, Praxiteles, S. 212 ff.
Um 300 v. Chr. tätig.
Knabenstatue.
(Hierzu die Tafeln Ia, lb.)
Das liebenswürdige Werk auf beistehenden Tafeln stammt aus der Sammlung Margaritis.1) Der Marmor ist pentelisch;
die Höhe mitsamt der antiken Plinthe beträgt 0,88 m. Arbeit wie Erhaltung der Figur sind gleich gut. Es fehlt
nur die Hälfte des linken Unterarms und der obere Teil der Stütze.
Diese Statue stimmt nun in allen Details mit einer Knabenfigur aus Lilaia in der Athener Nationalbiblio-
thek2) überein, die auch die richtige Ergänzung lehrt: die linke Hand stützte sich auf eine Ente, die auf dem Pfeiler
saß. Das Vorhandensein einer Replik spricht deutlich für die Beliebtheit der Gestalt in der Antike. Zweifellos haben
wir es in vorliegendem Werke mit dem originalen Erzeugnis eines griechischen Meisters und nicht etwa mit römischer
Kopistenarbeit zu tun. Ein etwa dreijähriger Knabe3) steht vor uns, den Kopf nach der Seite des Standbeines gesenkt,
ruhig lächelnd und stützt sich dabei auf die Ente, in seinem kindlichen Denken nicht wahrnehmend, daß er seinem
lieben Spielkameraden Schmerz bereitet. Der rechte Arm liegt an der Brust, die Hand ist in feiner Beobachtung kind-
licher Eigenart zur Faust geballt. Das linke Bein überkreuzt das rechte, das allein die Körperlast trägt, und dies
Motiv dient dazu, die Frische des schwellenden Kinderkörpers deutlich zum Ausdruck zu bringen. Die Situation ist
psychologisch fein beobachtet, nichts an dem Werke fällt aus dem Rahmen des rein Kindlichen heraus und lehrt
deutlich, daß es das Produkt einer Epoche ist, die auch die Darstellung des Kindes bereits dem Besitzstande ihrer
Kunst eingefügt hatte.
Das Motiv, das Kind mit seinem Spielzeug darzustellen, war zu naheliegend, als daß es nicht mit dem Kinde
gleichzeitig in der Kunst auftreten sollte. — Auf den Grabreliefs ist es bald ein Hund, dann wieder ein Hase oder
ein Vogel, die als seine Genossen erscheinen.4) Und in die Reihe der Grabmonumente kann wohl auch unbedenk-
lich der Knabe mit der Ente eingereiht werden.5) Trotz des funeralen Zweckes lagert aber eine sonnige Heiterkeit
über dem Bildwerke, ein leises Lächeln umspielt die Lippen und läßt die Wangen noch pausbäckiger erscheinen, als
sie sind. So individuell das Werk anmutet, so wenig ist es etwa ein Porträt. Das Kind überhaupt sollte dargestellt
werden, nicht etwa ein spezielles Kind, eine Aufgabe, die sich die griechische Plastik erst spät stellte und deren Lösung
ihr erst noch später gelang. Erst der naclipraxitelischen Zeit war es gelungen, die flächenhafte Behandlung der Bauch-
partie zu überwinden,6) den Kinderkörper mit seinem zarten weichen Fleisch darzustellen und ihn in den richtigen
Proportionen zu bilden. Diesen allgemeinen Ansatz jedoch vermag ein Vergleich mit verwandten Werken noch näher
zu bestimmen. Das Motiv des Lehnens mit aufgestütztem Arm gehört schon der Plastik einer vorhergehenden Zeit
an; so findet es sich z. B. an dem sogenannten y>Narkissos«,7) gleich unserem Knaben ein Werk, das dem Grabschmuck
diente, und mit dem ihn vielfach verwandte Züge verbinden. Besonders die Art, wie durch das starke Lehnen die
linke Schulter emporgedrückt wird, ist an beiden Schöpfungen identisch. Doch während der Narkissos das linke
Bein entlastet zurücksetzt, ist bei dem Knaben mit der Ente durch das Kreuzen der Beine der Linienzug reicher,
komplizierter geworden. Er nähert sich dadurch in bedeutendem Maße dem flötenden Satyrknaben?) dessen Ruhm
durch zahlreiche Repliken erwiesen ist und der wohl allgemein als jüngere Umbildung des ausruhenden praxitelischen
Satyrs angesehen wird. In die gleiche Zeitepoche wie die Betrachtung der Körperformen und der Ponderation führt
') Katalog Helbing-Magaritis 1897, S. 22, No. 258.
2) Ann. 1859 Tav. A (Conze), Sybel 3781, Friederichs-Wolters 1590, Strena Helbigiana S. 13 (Arndt), Reinach Rep. II. 465. 2.— Die
von Arndt a. a. O. angenommene Identität von 1 und 2 ist unrichtig. Die Figur aus Lilaia steht noch heute im Lesesaal der Athener Bibliothek.
3) cf. Froriep, Anatomie für Künstler, Prop. Tf. Fig. II.
*) cf. Attische Grabreliefs, Tf. 156, 157, 160, 161, 162, 163, 167, 189, 193 u.v.a.
s) Die Stefane im Haar ist speziell Kindertracht, cf. Friederichs-Wolters a. a. Ü. häufig auf Grabreliefs z. B. Att. Grabr., Tf. 192, 194;
über die Stefane bei Erwachsenen Arndt a. a. O.
6) cf. Herl, philol. Wochenschr. XVIII (1898), Sp. 3 11 f. (Furtwängler).
7) Furtwängler, Meisterw., S. 483 ff; Mahler, Polyklet, S. 135 ff.
8) Friederichs-Wolters 1501, 1502; Klein, Praxiteles, S. 212 ff.