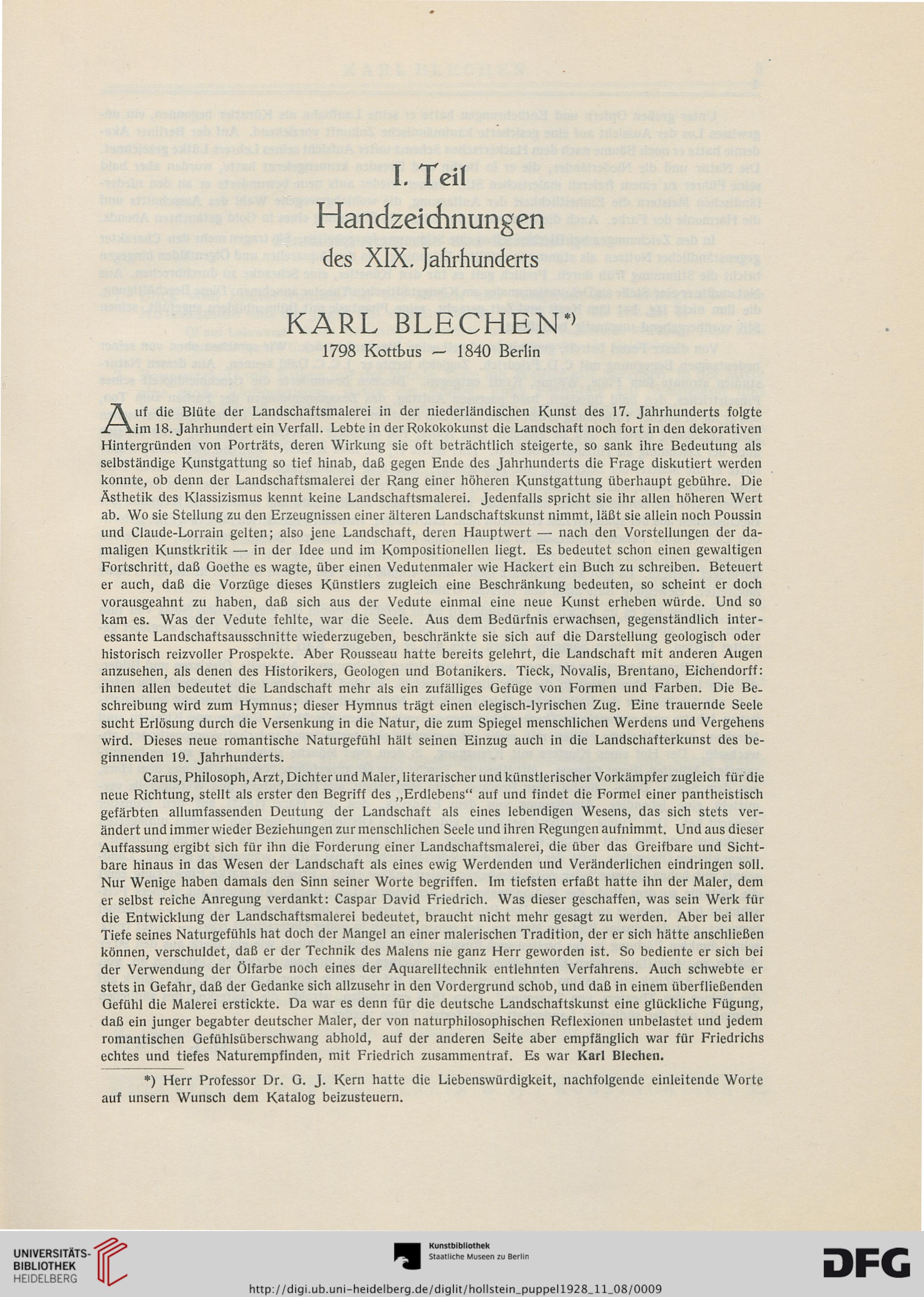I. Teil
Handzeichnungen
des XIX. Jahrhunderts
KARL BLECHEN*}
1798 Kottbus — 1840 Berlin
Auf die Blüte der Landschaftsmalerei in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts folgte
im 18. Jahrhundert ein Verfall. Lebte in der Rokokokunst die Landschaft noch fort in den dekorativen
Hintergründen von Porträts, deren Wirkung sie oft beträchtlich steigerte, so sank ihre Bedeutung als
selbständige Kunstgattung so tief hinab, daß gegen Ende des Jahrhunderts die Frage diskutiert werden
konnte, ob denn der Landschaftsmalerei der Rang einer höheren Kunstgattung überhaupt gebühre. Die
Ästhetik des Klassizismus kennt keine Landschaftsmalerei. Jedenfalls spricht sie ihr allen höheren Wert
ab. Wo sie Stellung zu den Erzeugnissen einer älteren Landschaftskunst nimmt, Iäßt sie allein noch Poussin
und Claude-Lorrain gelten; aiso jene Landschaft, deren Hauptwert — nach den Vorstellungen der da-
maligen Kunstkritik — in der Idee und im Kompositionellen liegt. Es bedeutet schon einen gewaltigen
Fortschritt, daß Qoethe es wagte, über einen Vedutenmaler wie Hackert ein Buch zu schreiben. Beteuert
er auch, daß die Vorzüge dieses Künstlers zugleich eine Beschränkung bedeuten, so scheint er doch
vorausgeahnt zu haben, daß sich aus der Vedute einmal eine neue Kunst erheben würde. Und so
kam es. Was der Vedute fehlte, war die Seele. Aus dem Bedürfnis erwachsen, gegenständlich inter-
essante Landschaftsausschnitte wiederzugeben, beschränkte sie sich auf die Darstellung geologisch oder
historisch reizvoller Prospekte. Aber Rousseau hatte bereits gelehrt, die Landschaft mit anderen Augen
anzusehen, als denen des Historikers, Geologen und Botanikers. Tieck, Novalis, Brentano, Eichendorff:
ihnen allen bedeutet die Landschaft mehr als ein zufälliges Qefüge von Formen und Farben. Die Be-
schreibung wird zum Hymnus; dieser Hymnus trägt einen elegisch-lyrischen Zug. Eine trauernde Seele
sucht Erlösung durch die Versenkung in die Natur, die zum Spiegel menschlichen Werdens und Vergehens
wird. Dieses neue romantische Naturgefühl hält seinen Einzug auch in die Landschafterkunst des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts.
Carus, Philosoph, Arzt, Dichter und Maler, literarischer und künstlerischer Vorkämpfer zugleich für die
neue Richtung, stellt als erster den Begriff des „Erdlebens“ auf und findet die Formel einer pantheistisch
gefärbten allumfassenden Deutung der Landschaft als eines lebendigen Wesens, das sich stets ver-
ändert und immer wieder Beziehungen zur menschlichen Seele und ihren Regungen aufnimmt. Und aus dieser
Auffassung ergibt sich für ihn die Forderung einer Landschaftsmalerei, die über das Greifbare und Sicht-
bare hinaus in das Wesen der Landschaft als eines ewig Werdenden und Veränderlichen eindringen soll.
Nur Wenige haben damals den Sinn seiner Worte begriffen. Im tiefsten erfaßt hatte ihn der Maler, dem
er selbst reiche Anregung verdankt: Caspar David Friedrich. Was dieser geschaffen, was sein Werk für
die Entwicklung der Landschaftsmalerei bedeutet, braucht nicht mehr gesagt zu werden. Aber bei aller
Tiefe seines Naturgefühls hat doch der Mangei an einer malerischen Tradition, der er sich hätte anschließen
können, verschuldet, daß er der Technik des Malens nie ganz Herr geworden ist. So bediente er sich bei
der Verwendung der Ölfarbe noch eines der Aquarelltechnik entlehnten Verfahrens. Auch schwebte er
stets in Gefahr, daß der Gedanke sich allzusehr in den Vordergrund schob, und daß in einem überfließenden
Gefühl die Malerei erstickte. Da war es denn für die deutsche Landschaftskunst eine glückliche Fügung,
daß ein junger begabter deutscher Maler, der von naturphilosophischen Reflexionen unbelastet und jedem
romantischen Gefühlsüberschwang abhold, auf der anderen Seite aber empfänglich war für Friedrichs
echtes und tiefes Naturempfinden, mit Friedrich zusammentraf. Es war Karl Blechen.
*) Herr Professor Dr. G. J. Kern hatte die Liebenswürdigkeit, nachfolgende einleitende Worte
auf unsern Wunsch dem Katalog beizusteuern.
Handzeichnungen
des XIX. Jahrhunderts
KARL BLECHEN*}
1798 Kottbus — 1840 Berlin
Auf die Blüte der Landschaftsmalerei in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts folgte
im 18. Jahrhundert ein Verfall. Lebte in der Rokokokunst die Landschaft noch fort in den dekorativen
Hintergründen von Porträts, deren Wirkung sie oft beträchtlich steigerte, so sank ihre Bedeutung als
selbständige Kunstgattung so tief hinab, daß gegen Ende des Jahrhunderts die Frage diskutiert werden
konnte, ob denn der Landschaftsmalerei der Rang einer höheren Kunstgattung überhaupt gebühre. Die
Ästhetik des Klassizismus kennt keine Landschaftsmalerei. Jedenfalls spricht sie ihr allen höheren Wert
ab. Wo sie Stellung zu den Erzeugnissen einer älteren Landschaftskunst nimmt, Iäßt sie allein noch Poussin
und Claude-Lorrain gelten; aiso jene Landschaft, deren Hauptwert — nach den Vorstellungen der da-
maligen Kunstkritik — in der Idee und im Kompositionellen liegt. Es bedeutet schon einen gewaltigen
Fortschritt, daß Qoethe es wagte, über einen Vedutenmaler wie Hackert ein Buch zu schreiben. Beteuert
er auch, daß die Vorzüge dieses Künstlers zugleich eine Beschränkung bedeuten, so scheint er doch
vorausgeahnt zu haben, daß sich aus der Vedute einmal eine neue Kunst erheben würde. Und so
kam es. Was der Vedute fehlte, war die Seele. Aus dem Bedürfnis erwachsen, gegenständlich inter-
essante Landschaftsausschnitte wiederzugeben, beschränkte sie sich auf die Darstellung geologisch oder
historisch reizvoller Prospekte. Aber Rousseau hatte bereits gelehrt, die Landschaft mit anderen Augen
anzusehen, als denen des Historikers, Geologen und Botanikers. Tieck, Novalis, Brentano, Eichendorff:
ihnen allen bedeutet die Landschaft mehr als ein zufälliges Qefüge von Formen und Farben. Die Be-
schreibung wird zum Hymnus; dieser Hymnus trägt einen elegisch-lyrischen Zug. Eine trauernde Seele
sucht Erlösung durch die Versenkung in die Natur, die zum Spiegel menschlichen Werdens und Vergehens
wird. Dieses neue romantische Naturgefühl hält seinen Einzug auch in die Landschafterkunst des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts.
Carus, Philosoph, Arzt, Dichter und Maler, literarischer und künstlerischer Vorkämpfer zugleich für die
neue Richtung, stellt als erster den Begriff des „Erdlebens“ auf und findet die Formel einer pantheistisch
gefärbten allumfassenden Deutung der Landschaft als eines lebendigen Wesens, das sich stets ver-
ändert und immer wieder Beziehungen zur menschlichen Seele und ihren Regungen aufnimmt. Und aus dieser
Auffassung ergibt sich für ihn die Forderung einer Landschaftsmalerei, die über das Greifbare und Sicht-
bare hinaus in das Wesen der Landschaft als eines ewig Werdenden und Veränderlichen eindringen soll.
Nur Wenige haben damals den Sinn seiner Worte begriffen. Im tiefsten erfaßt hatte ihn der Maler, dem
er selbst reiche Anregung verdankt: Caspar David Friedrich. Was dieser geschaffen, was sein Werk für
die Entwicklung der Landschaftsmalerei bedeutet, braucht nicht mehr gesagt zu werden. Aber bei aller
Tiefe seines Naturgefühls hat doch der Mangei an einer malerischen Tradition, der er sich hätte anschließen
können, verschuldet, daß er der Technik des Malens nie ganz Herr geworden ist. So bediente er sich bei
der Verwendung der Ölfarbe noch eines der Aquarelltechnik entlehnten Verfahrens. Auch schwebte er
stets in Gefahr, daß der Gedanke sich allzusehr in den Vordergrund schob, und daß in einem überfließenden
Gefühl die Malerei erstickte. Da war es denn für die deutsche Landschaftskunst eine glückliche Fügung,
daß ein junger begabter deutscher Maler, der von naturphilosophischen Reflexionen unbelastet und jedem
romantischen Gefühlsüberschwang abhold, auf der anderen Seite aber empfänglich war für Friedrichs
echtes und tiefes Naturempfinden, mit Friedrich zusammentraf. Es war Karl Blechen.
*) Herr Professor Dr. G. J. Kern hatte die Liebenswürdigkeit, nachfolgende einleitende Worte
auf unsern Wunsch dem Katalog beizusteuern.