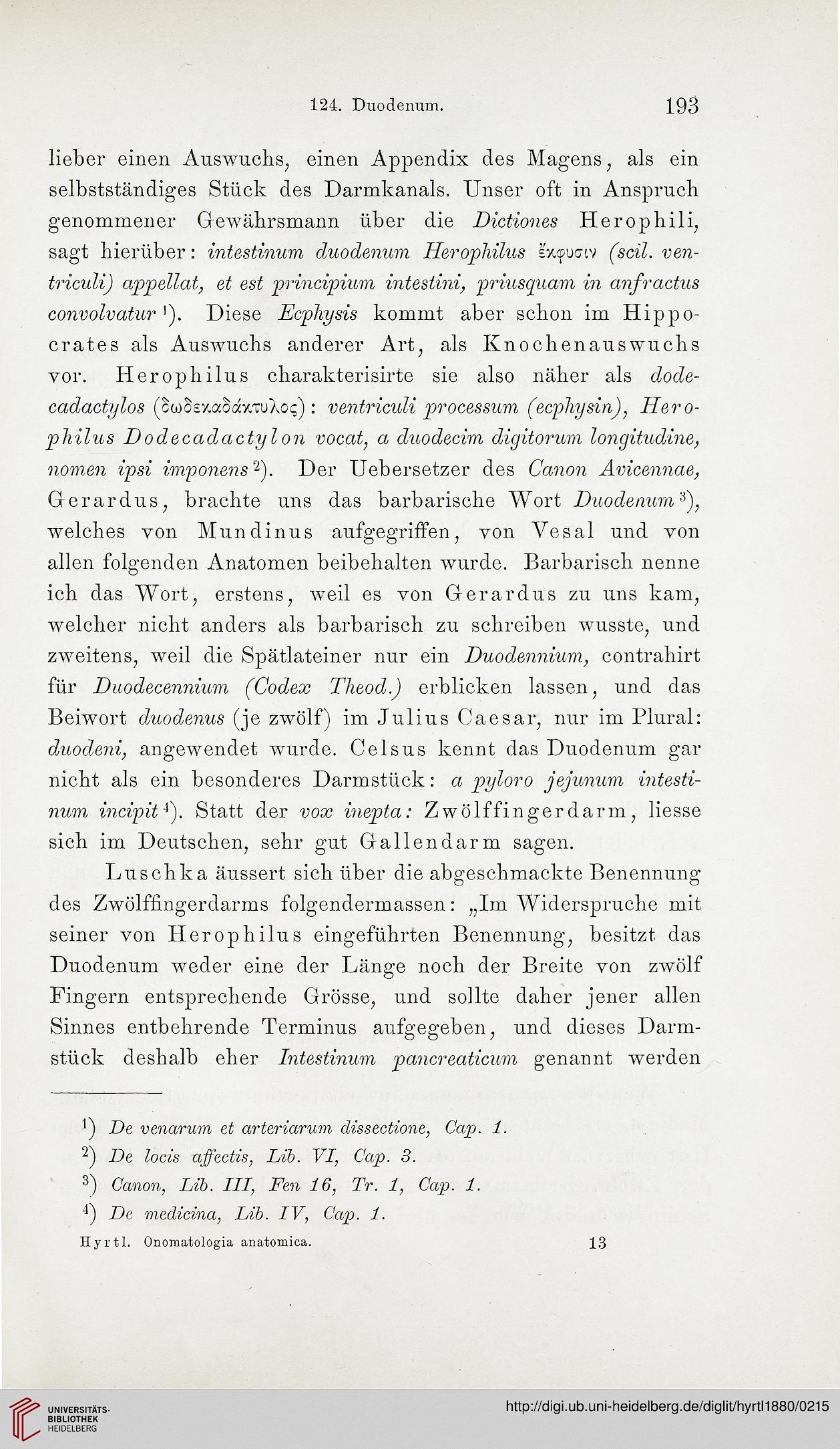124. Duodenum.
193
lieber einen Auswuchs, einen Appendix des Magens , als ein
selbstständiges Stück des Darmkanals. Unser oft in Anspruch
genommener Gewährsmann über die Dictiones Herophili,
sagt hierüber: intestinum duodenum Herophilus sxipuatv (seil, ven-
triculi) appellat, et est prineipium intestini, priusquam in anfractus
convolvatur '). Diese Ecpliysis kommt aber schon im Hippo-
crates als Auswuchs anderer Art, als Knochenauswuchs
vor. Herophilus charakterisirte sie also näher als dode-
cadactylos (SwocxaBcbauXoc;) : ventriadi processum (eephysin), Hero-
philus Dodecadaetylon vocat, a duodeeim digitorurn longitudine,
nomen ipsi imponens2). Der Uebersetzer des Canon Avicennae,
Gerardus, brachte uns das barbarische Wort Duodenum'^,
welches von Mundinus aufgegriffen, von Vesal und von
allen folgenden Anatomen beibehalten wurde. Barbarisch nenne
ich das Wort, erstens, weil es von Gerardus zu uns kam,
welcher nicht anders als barbarisch zu schreiben wusste, und
zweitens, weil die Spätlateiner nur ein Duodennium, contrahirt
für Duodecennium (Codex Theod.) erblicken lassen, und das
Beiwort duodenus (je zwölf) im Julius Caesar, nur im Plural:
duodeni, angewendet wurde. Celsus kennt das Duodenum gar
nicht als ein besonderes Darmstück: a pyloro jejunum intesti-
num ineipit4). Statt der vox inepta: Zwölffingerdarm, Hesse
sich im Deutschen, sehr gut Gallendarm sagen.
Luschka äussert sich über die abgeschmackte Benennung
des Zwölffingerdarms folgendermassen: „Im Widerspruche mit
seiner von Herophilus eingeführten Benennung, besitzt das
Duodenum weder eine der Länge noch der Breite von zwölf
Fingern entsprechende Grösse, und sollte daher jener allen
Sinnes entbehrende Terminus aufgegeben, und dieses Darm-
stück deshalb eher Intestinum pancreaticum genannt werden
M De venarum et arteriarum dissectione, Cap. 1.
2) De locis affectis, Lib. VI, Cap. 3.
3) Canon, Lib. III, Fen 16, Tr. 1, Cap. 1.
4) De medicina, Lib. IV, Cap). 1.
Hyrtl. Onomatologia anatomica. 13
193
lieber einen Auswuchs, einen Appendix des Magens , als ein
selbstständiges Stück des Darmkanals. Unser oft in Anspruch
genommener Gewährsmann über die Dictiones Herophili,
sagt hierüber: intestinum duodenum Herophilus sxipuatv (seil, ven-
triculi) appellat, et est prineipium intestini, priusquam in anfractus
convolvatur '). Diese Ecpliysis kommt aber schon im Hippo-
crates als Auswuchs anderer Art, als Knochenauswuchs
vor. Herophilus charakterisirte sie also näher als dode-
cadactylos (SwocxaBcbauXoc;) : ventriadi processum (eephysin), Hero-
philus Dodecadaetylon vocat, a duodeeim digitorurn longitudine,
nomen ipsi imponens2). Der Uebersetzer des Canon Avicennae,
Gerardus, brachte uns das barbarische Wort Duodenum'^,
welches von Mundinus aufgegriffen, von Vesal und von
allen folgenden Anatomen beibehalten wurde. Barbarisch nenne
ich das Wort, erstens, weil es von Gerardus zu uns kam,
welcher nicht anders als barbarisch zu schreiben wusste, und
zweitens, weil die Spätlateiner nur ein Duodennium, contrahirt
für Duodecennium (Codex Theod.) erblicken lassen, und das
Beiwort duodenus (je zwölf) im Julius Caesar, nur im Plural:
duodeni, angewendet wurde. Celsus kennt das Duodenum gar
nicht als ein besonderes Darmstück: a pyloro jejunum intesti-
num ineipit4). Statt der vox inepta: Zwölffingerdarm, Hesse
sich im Deutschen, sehr gut Gallendarm sagen.
Luschka äussert sich über die abgeschmackte Benennung
des Zwölffingerdarms folgendermassen: „Im Widerspruche mit
seiner von Herophilus eingeführten Benennung, besitzt das
Duodenum weder eine der Länge noch der Breite von zwölf
Fingern entsprechende Grösse, und sollte daher jener allen
Sinnes entbehrende Terminus aufgegeben, und dieses Darm-
stück deshalb eher Intestinum pancreaticum genannt werden
M De venarum et arteriarum dissectione, Cap. 1.
2) De locis affectis, Lib. VI, Cap. 3.
3) Canon, Lib. III, Fen 16, Tr. 1, Cap. 1.
4) De medicina, Lib. IV, Cap). 1.
Hyrtl. Onomatologia anatomica. 13