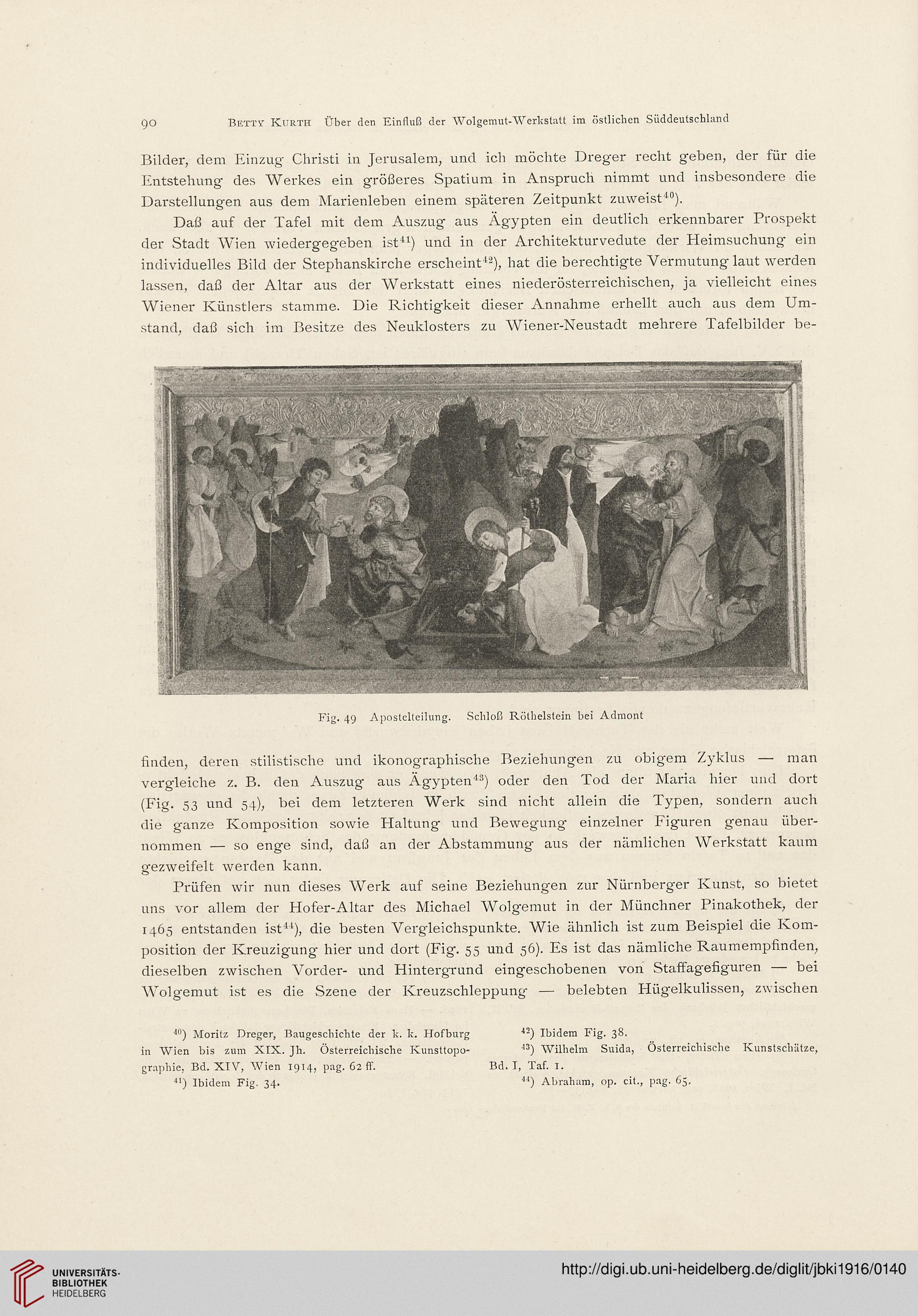9°
Betty Kurth Über den Einfluß der Wolgemut-Werkstatt im östlichen Süddeutschland
Bilder, dem Einzug Christi in Jerusalem, und ich möchte Dreger recht geben, der für die
Entstehung des Werkes ein größeres Spatium in Anspruch nimmt und insbesondere die
Darstellungen aus dem Marienleben einem späteren Zeitpunkt zuweist40).
Daß auf der Tafel mit dem Auszug aus Ägypten ein deutlich erkennbarer Prospekt
der Stadt Wien wiedergegeben ist41) und in der Architekturvedute der Fleimsuchung ein
individuelles Bild der Stephanskirche erscheint42), hat die berechtigte Vermutung laut werden
lassen, daß der Altar aus der Werkstatt eines niederösterreichischen, ja vielleicht eines
Wiener Künstlers stamme. Die Richtigkeit dieser Annahme erhellt auch aus dem Um-
stand, daß sich im Besitze des Neuklosters zu Wiener-Neustadt mehrere Tafelbilder be-
Fig. 49 Apostelteilung. Schloß Röthelstein bei Admont
finden, deren stilistische und ikonographische Beziehungen zu obigem Zyklus — man
vergleiche z. B. den Auszug’ aus Ägypten'13) oder den Tod der Maria hier und dort
(Fig. 53 und 54), bei dem letzteren Werk sind nicht allein die Typen, sondern auch
die ganze Komposition sowie Haltung und Bewegung einzelner Figuren genau über-
nommen — so enge sind, daß an der Abstammung aus der nämlichen Werkstatt kaum
gezweifelt werden kann.
Prüfen wir nun dieses Werk auf seine Beziehungen zur Nürnberger Kunst, so bietet
uns vor allem der Hofer-Altar des Michael Wolgemut in der Münchner Pinakothek, der
1465 entstanden ist14), die besten Vergleichspunkte. Wie ähnlich ist zum Beispiel die Kom-
position der Kreuzigung hier und dort (Fig. 55 und 56). Es ist das nämliche Raumempfinden,
dieselben zwischen Vorder- und Hintergrund eingeschobenen von Staffagefiguren — bei
Wolgemut ist es die Szene der Kreuzschleppung- — belebten Hügelkulissen, zwischen
40) Moritz Dreger, Baugeschichte der k. k. Hofburg
in Wien bis zum XIX. Jh. Österreichische Kunsttopo-
graphie, Bd. XIV, Wien 1914, pag. 62 ff.
41) Ibidem Fig. 34.
42) Ibidem Fig. 38.
43) Wilhelm Suida, Österreichische
Bd. I, Taf. I.
44) Abraham, op. eit-, pag. 65.
Kunstschätze,
Betty Kurth Über den Einfluß der Wolgemut-Werkstatt im östlichen Süddeutschland
Bilder, dem Einzug Christi in Jerusalem, und ich möchte Dreger recht geben, der für die
Entstehung des Werkes ein größeres Spatium in Anspruch nimmt und insbesondere die
Darstellungen aus dem Marienleben einem späteren Zeitpunkt zuweist40).
Daß auf der Tafel mit dem Auszug aus Ägypten ein deutlich erkennbarer Prospekt
der Stadt Wien wiedergegeben ist41) und in der Architekturvedute der Fleimsuchung ein
individuelles Bild der Stephanskirche erscheint42), hat die berechtigte Vermutung laut werden
lassen, daß der Altar aus der Werkstatt eines niederösterreichischen, ja vielleicht eines
Wiener Künstlers stamme. Die Richtigkeit dieser Annahme erhellt auch aus dem Um-
stand, daß sich im Besitze des Neuklosters zu Wiener-Neustadt mehrere Tafelbilder be-
Fig. 49 Apostelteilung. Schloß Röthelstein bei Admont
finden, deren stilistische und ikonographische Beziehungen zu obigem Zyklus — man
vergleiche z. B. den Auszug’ aus Ägypten'13) oder den Tod der Maria hier und dort
(Fig. 53 und 54), bei dem letzteren Werk sind nicht allein die Typen, sondern auch
die ganze Komposition sowie Haltung und Bewegung einzelner Figuren genau über-
nommen — so enge sind, daß an der Abstammung aus der nämlichen Werkstatt kaum
gezweifelt werden kann.
Prüfen wir nun dieses Werk auf seine Beziehungen zur Nürnberger Kunst, so bietet
uns vor allem der Hofer-Altar des Michael Wolgemut in der Münchner Pinakothek, der
1465 entstanden ist14), die besten Vergleichspunkte. Wie ähnlich ist zum Beispiel die Kom-
position der Kreuzigung hier und dort (Fig. 55 und 56). Es ist das nämliche Raumempfinden,
dieselben zwischen Vorder- und Hintergrund eingeschobenen von Staffagefiguren — bei
Wolgemut ist es die Szene der Kreuzschleppung- — belebten Hügelkulissen, zwischen
40) Moritz Dreger, Baugeschichte der k. k. Hofburg
in Wien bis zum XIX. Jh. Österreichische Kunsttopo-
graphie, Bd. XIV, Wien 1914, pag. 62 ff.
41) Ibidem Fig. 34.
42) Ibidem Fig. 38.
43) Wilhelm Suida, Österreichische
Bd. I, Taf. I.
44) Abraham, op. eit-, pag. 65.
Kunstschätze,