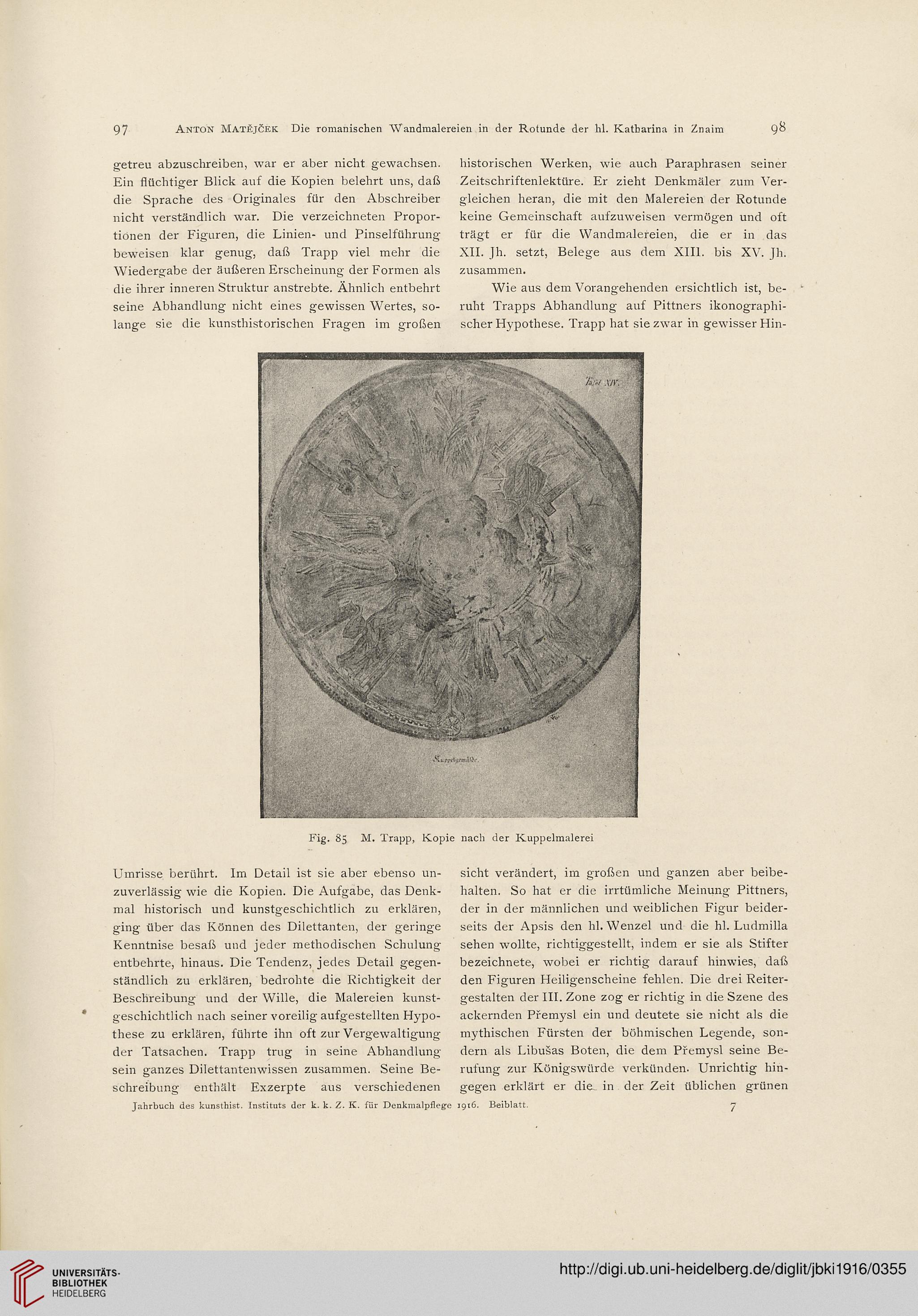97
Anton MatejCek Die romanischen Wandmalereien in der Rotunde der hl. Katharina in Znaim
98
getreu abzuschreiben, war er aber nicht gewachsen.
Ein flüchtiger Blick auf die Kopien belehrt uns, daß
die Sprache des Originales für den Abschreiber
nicht verständlich war. Die verzeichneten Propor-
tionen der Figuren, die Linien- und Pinselführung
beweisen klar genug, daß Trapp viel mehr die
Wiedergabe der äußeren Erscheinung der Formen als
die ihrer inneren Struktur anstrebte. Ähnlich entbehrt
seine Abhandlung nicht eines gewissen Wertes, so-
lange sie die kunsthistorischen Fragen im großen
historischen Werken, wie auch Paraphrasen seiner
Zeitschriftenlektüre. Er zieht Denkmäler zum Ver-
gleichen heran, die mit den Malereien der Rotunde
keine Gemeinschaft aufzuweisen vermögen und oft
trägt er für die Wandmalereien, die er in das
XII. Jh. setzt, Belege aus dem XIII. bis XV. Jh.
zusammen.
Wie aus dem Vorangehenden ersichtlich ist, be-
ruht Trapps Abhandlung auf Pittners ikonographi-
scher Hypothese. Trapp hat sie zwar in gewisser Hin-
Fig. 85 M. Trapp, Kopie nach der Kuppelmalerei
Umrisse berührt. Im Detail ist sie aber ebenso un-
zuverlässig wie die Kopien. Die Aufgabe, das Denk-
mal historisch und kunstgeschichtlich zu erklären,
ging über das Können des Dilettanten, der geringe
Kenntnise besaß und jeder methodischen Schulung
entbehrte, hinaus. Die Tendenz, jedes Detail gegen-
ständlich zu erklären, bedrohte die Richtigkeit der
Beschreibung und der Wille, die Malereien kunst-
geschichtlich nach seiner voreilig aufgestellten Hypo-
these zu erklären, führte ihn oft zur Vergewaltigung
der Tatsachen. Trapp trug in seine Abhandlung
sein ganzes Dilettantenwissen zusammen. Seine Be-
schreibung enthält Exzerpte aus verschiedenen
Jahrbuch des kunsthist. Instituts der k. k. Z. K. für Denkmalpflege 1916.
sicht verändert, im großen und ganzen aber beibe-
halten. So hat er die irrtümliche Meinung Pittners,
der in der männlichen und weiblichen Figur beider-
seits der Apsis den hl. Wenzel und die hl. Ludmilla
sehen wollte, richtiggestellt, indem er sie als Stifter
bezeichnete, wobei er richtig darauf hinwies, daß
den Figuren Heiligenscheine fehlen. Die drei Reiter-
gestalten der III. Zone zog er richtig in die Szene des
ackernden Pfemysl ein und deutete sie nicht als die
mythischen Fürsten der böhmischen Legende, son-
dern als Libusas Boten, die dem Pfemysl seine Be-
rufung zur Königswürde verkünden. Unrichtig hin-
gegen erklärt er die- in der Zeit üblichen grünen
Beiblatt. 7
Anton MatejCek Die romanischen Wandmalereien in der Rotunde der hl. Katharina in Znaim
98
getreu abzuschreiben, war er aber nicht gewachsen.
Ein flüchtiger Blick auf die Kopien belehrt uns, daß
die Sprache des Originales für den Abschreiber
nicht verständlich war. Die verzeichneten Propor-
tionen der Figuren, die Linien- und Pinselführung
beweisen klar genug, daß Trapp viel mehr die
Wiedergabe der äußeren Erscheinung der Formen als
die ihrer inneren Struktur anstrebte. Ähnlich entbehrt
seine Abhandlung nicht eines gewissen Wertes, so-
lange sie die kunsthistorischen Fragen im großen
historischen Werken, wie auch Paraphrasen seiner
Zeitschriftenlektüre. Er zieht Denkmäler zum Ver-
gleichen heran, die mit den Malereien der Rotunde
keine Gemeinschaft aufzuweisen vermögen und oft
trägt er für die Wandmalereien, die er in das
XII. Jh. setzt, Belege aus dem XIII. bis XV. Jh.
zusammen.
Wie aus dem Vorangehenden ersichtlich ist, be-
ruht Trapps Abhandlung auf Pittners ikonographi-
scher Hypothese. Trapp hat sie zwar in gewisser Hin-
Fig. 85 M. Trapp, Kopie nach der Kuppelmalerei
Umrisse berührt. Im Detail ist sie aber ebenso un-
zuverlässig wie die Kopien. Die Aufgabe, das Denk-
mal historisch und kunstgeschichtlich zu erklären,
ging über das Können des Dilettanten, der geringe
Kenntnise besaß und jeder methodischen Schulung
entbehrte, hinaus. Die Tendenz, jedes Detail gegen-
ständlich zu erklären, bedrohte die Richtigkeit der
Beschreibung und der Wille, die Malereien kunst-
geschichtlich nach seiner voreilig aufgestellten Hypo-
these zu erklären, führte ihn oft zur Vergewaltigung
der Tatsachen. Trapp trug in seine Abhandlung
sein ganzes Dilettantenwissen zusammen. Seine Be-
schreibung enthält Exzerpte aus verschiedenen
Jahrbuch des kunsthist. Instituts der k. k. Z. K. für Denkmalpflege 1916.
sicht verändert, im großen und ganzen aber beibe-
halten. So hat er die irrtümliche Meinung Pittners,
der in der männlichen und weiblichen Figur beider-
seits der Apsis den hl. Wenzel und die hl. Ludmilla
sehen wollte, richtiggestellt, indem er sie als Stifter
bezeichnete, wobei er richtig darauf hinwies, daß
den Figuren Heiligenscheine fehlen. Die drei Reiter-
gestalten der III. Zone zog er richtig in die Szene des
ackernden Pfemysl ein und deutete sie nicht als die
mythischen Fürsten der böhmischen Legende, son-
dern als Libusas Boten, die dem Pfemysl seine Be-
rufung zur Königswürde verkünden. Unrichtig hin-
gegen erklärt er die- in der Zeit üblichen grünen
Beiblatt. 7