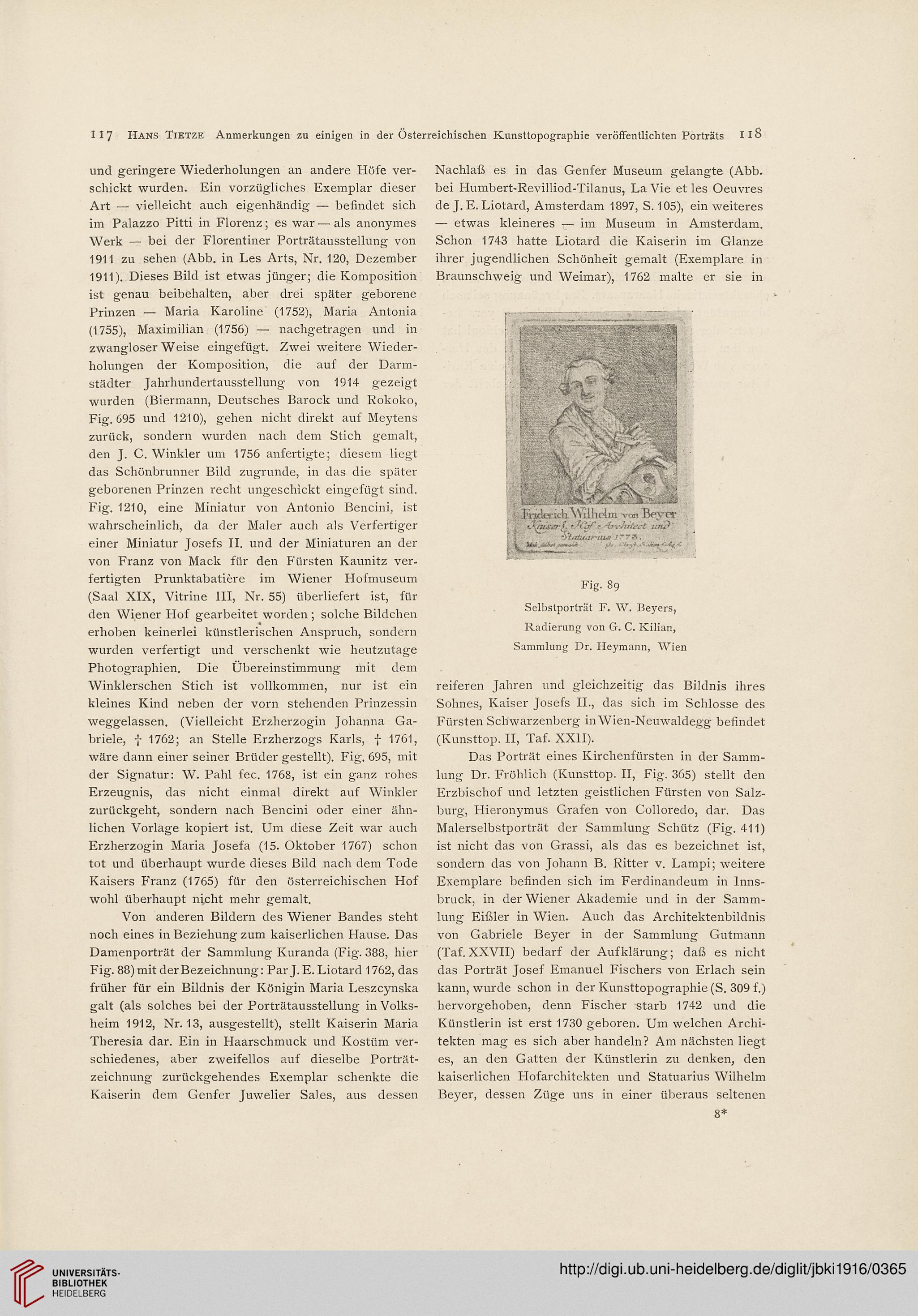I 17 Hans Tietze Anmerkungen zu einigen in der Österreichischen Kunsttopographie veröffentlichten Porträts I iS
und geringere Wiederholungen an andere Höfe ver-
schickt wurden. Ein vorzügliches Exemplar dieser
Art — vielleicht auch eigenhändig — befindet sich
im Palazzo Pitti in Florenz; es war — als anonymes
Werk — bei der Florentiner Porträtausstellung von
1911 zu sehen (Abb. in Les Arts, Nr. 120, Dezember
1911). Dieses Bild ist etwas jünger; die Komposition
ist genau beibehalten, aber drei später geborene
Prinzen — Maria Karoline (1752), Maria Antonia
(1755), Maximilian (1756) — nachgetragen und in
zwangloser Weise eingefügt. Zwei weitere Wieder-
holungen der Komposition, die auf der Darm-
städter Jahrhundertausstellung von 1914 gezeigt
wurden (Biermann, Deutsches Barock und Rokoko,
Fig. 695 und 1210), gehen nicht direkt auf Meytens
zurück, sondern wurden nach dem Stich gemalt,
den J. C. Winkler um 1756 anfertigte; diesem liegt
das Schönbrunner Bild zugrunde, in das die später
geborenen Prinzen recht ungeschickt eingefügt sind.
Fig, 1210, eine Miniatur von Antonio Bencini, ist
wahrscheinlich, da der Maler auch als Verfertiger
einer Miniatur Josefs II. und der Miniaturen an der
von Franz von Mack für den Fürsten Kaunitz ver-
fertigten Prunktabatiere im Wiener Hofmuseum
(Saal XIX, Vitrine III, Nr. 55) überliefert ist, für
den Wiener Hof gearbeitet worden; solche Bildchen
erhoben keinerlei künstlerischen Anspruch, sondern
wurden verfertigt und verschenkt wie heutzutage
Photographien. Die Übereinstimmung mit dem
Winklerschen Stich ist vollkommen, nur ist ein
kleines Kind neben der vorn stehenden Prinzessin
weggelassen. (Vielleicht Erzherzogin Johanna Ga-
briele, j- 1762; an Stelle Erzherzogs Karls, f 1761,
wäre dann einer seiner Brüder gestellt). Fig. 695, mit
der Signatur: W. Pahl fec. 1768, ist ein ganz rohes
Erzeugnis, das nicht einmal direkt auf Winkler
zurückgeht, sondern nach Bencini oder einer ähn-
lichen Vorlage kopiert ist. Um diese Zeit war auch
Erzherzogin Maria Josefa (15. Oktober 1767) schon
tot und überhaupt wurde dieses Bild nach dem Tode
Kaisers Franz (1765) für den österreichischen Hof
wohl überhaupt nicht mehr gemalt.
Von anderen Bildern des Wiener Bandes steht
noch eines in Beziehung zum kaiserlichen Hause. Das
Damenporträt der Sammlung Kuranda (Fig. 388, hier
Fig. 88) mit derBezeichnung: Par J. E. Liotard 1762, das
früher für ein Bildnis der Königin Maria Leszcynska
galt (als solches bei der Porträtausstellung in Volks-
heim 1912, Nr. 13, ausgestellt), stellt Kaiserin Maria
Theresia dar. Ein in Haarschmuck und Kostüm ver-
schiedenes, aber zweifellos auf dieselbe Porträt-
zeichnung zurückgehendes Exemplar schenkte die
Kaiserin dem Genfer Juwelier Sales, aus dessen
Nachlaß es in das Genfer Museum gelangte (Abb.
bei Humbert-Revilliod-Tilanus, La Vie et les Oeuvres
de J. E. Liotard, Amsterdam 1897, S. 105), ein weiteres
— etwas kleineres — im Museum in Amsterdam.
Schon 1743 hatte Liotard die Kaiserin im Glanze
ihrer jugendlichen Schönheit gemalt (Exemplare in
Braunschweig und Weimar), 1762 malte er sie in
Fig- 89
Selbstporträt F. W. Beyers,
Radierung von G. C. Kilian,
Sammlung Dr. Heymann, Wien
reiferen Jahren und gleichzeitig das Bildnis ihres
Sohnes, Kaiser Josefs II., das sich im Schlosse des
Fürsten Schwarzenberg inWien-Neuwaldegg befindet
(Kunsttop. II, Taf. XXII).
Das Porträt eines Kirchenfürsten in der Samm-
lung Dr. Fröhlich (Kunsttop. II, Fig. 365) stellt den
Erzbischof und letzten geistlichen Fürsten von Salz-
burg, Hieronymus Grafen von Colloredo, dar. Das
Malerselbstporträt der Sammlung Schütz (Fig. 411)
ist nicht das von Grassi, als das es bezeichnet ist,
sondern das von Johann B. Ritter v. Lampi; weitere
Exemplare befinden sich im Ferdinandeum in Inns-
bruck, in der Wiener Akademie und in der Samm-
lung Eißler in Wien. Auch das Architektenbildnis
von Gabriele Beyer in der Sammlung Gutmann
(Taf. XXVII) bedarf der Aufklärung; daß es nicht
das Porträt Josef Emanuel Fischers von Erlach sein
kann, wurde schon in der Kunsttopographie (S. 309 f.)
hervorgehoben, denn Fischer starb 1742 und die
Künstlerin ist erst 1730 geboren. Um welchen Archi-
tekten mag es sich aber handeln? Am nächsten liegt
es, an den Gatten der Künstlerin zu denken, den
kaiserlichen Hofarchitekten und Statuarius Wilhelm
Beyer, dessen Züge uns in einer überaus seltenen
8*
und geringere Wiederholungen an andere Höfe ver-
schickt wurden. Ein vorzügliches Exemplar dieser
Art — vielleicht auch eigenhändig — befindet sich
im Palazzo Pitti in Florenz; es war — als anonymes
Werk — bei der Florentiner Porträtausstellung von
1911 zu sehen (Abb. in Les Arts, Nr. 120, Dezember
1911). Dieses Bild ist etwas jünger; die Komposition
ist genau beibehalten, aber drei später geborene
Prinzen — Maria Karoline (1752), Maria Antonia
(1755), Maximilian (1756) — nachgetragen und in
zwangloser Weise eingefügt. Zwei weitere Wieder-
holungen der Komposition, die auf der Darm-
städter Jahrhundertausstellung von 1914 gezeigt
wurden (Biermann, Deutsches Barock und Rokoko,
Fig. 695 und 1210), gehen nicht direkt auf Meytens
zurück, sondern wurden nach dem Stich gemalt,
den J. C. Winkler um 1756 anfertigte; diesem liegt
das Schönbrunner Bild zugrunde, in das die später
geborenen Prinzen recht ungeschickt eingefügt sind.
Fig, 1210, eine Miniatur von Antonio Bencini, ist
wahrscheinlich, da der Maler auch als Verfertiger
einer Miniatur Josefs II. und der Miniaturen an der
von Franz von Mack für den Fürsten Kaunitz ver-
fertigten Prunktabatiere im Wiener Hofmuseum
(Saal XIX, Vitrine III, Nr. 55) überliefert ist, für
den Wiener Hof gearbeitet worden; solche Bildchen
erhoben keinerlei künstlerischen Anspruch, sondern
wurden verfertigt und verschenkt wie heutzutage
Photographien. Die Übereinstimmung mit dem
Winklerschen Stich ist vollkommen, nur ist ein
kleines Kind neben der vorn stehenden Prinzessin
weggelassen. (Vielleicht Erzherzogin Johanna Ga-
briele, j- 1762; an Stelle Erzherzogs Karls, f 1761,
wäre dann einer seiner Brüder gestellt). Fig. 695, mit
der Signatur: W. Pahl fec. 1768, ist ein ganz rohes
Erzeugnis, das nicht einmal direkt auf Winkler
zurückgeht, sondern nach Bencini oder einer ähn-
lichen Vorlage kopiert ist. Um diese Zeit war auch
Erzherzogin Maria Josefa (15. Oktober 1767) schon
tot und überhaupt wurde dieses Bild nach dem Tode
Kaisers Franz (1765) für den österreichischen Hof
wohl überhaupt nicht mehr gemalt.
Von anderen Bildern des Wiener Bandes steht
noch eines in Beziehung zum kaiserlichen Hause. Das
Damenporträt der Sammlung Kuranda (Fig. 388, hier
Fig. 88) mit derBezeichnung: Par J. E. Liotard 1762, das
früher für ein Bildnis der Königin Maria Leszcynska
galt (als solches bei der Porträtausstellung in Volks-
heim 1912, Nr. 13, ausgestellt), stellt Kaiserin Maria
Theresia dar. Ein in Haarschmuck und Kostüm ver-
schiedenes, aber zweifellos auf dieselbe Porträt-
zeichnung zurückgehendes Exemplar schenkte die
Kaiserin dem Genfer Juwelier Sales, aus dessen
Nachlaß es in das Genfer Museum gelangte (Abb.
bei Humbert-Revilliod-Tilanus, La Vie et les Oeuvres
de J. E. Liotard, Amsterdam 1897, S. 105), ein weiteres
— etwas kleineres — im Museum in Amsterdam.
Schon 1743 hatte Liotard die Kaiserin im Glanze
ihrer jugendlichen Schönheit gemalt (Exemplare in
Braunschweig und Weimar), 1762 malte er sie in
Fig- 89
Selbstporträt F. W. Beyers,
Radierung von G. C. Kilian,
Sammlung Dr. Heymann, Wien
reiferen Jahren und gleichzeitig das Bildnis ihres
Sohnes, Kaiser Josefs II., das sich im Schlosse des
Fürsten Schwarzenberg inWien-Neuwaldegg befindet
(Kunsttop. II, Taf. XXII).
Das Porträt eines Kirchenfürsten in der Samm-
lung Dr. Fröhlich (Kunsttop. II, Fig. 365) stellt den
Erzbischof und letzten geistlichen Fürsten von Salz-
burg, Hieronymus Grafen von Colloredo, dar. Das
Malerselbstporträt der Sammlung Schütz (Fig. 411)
ist nicht das von Grassi, als das es bezeichnet ist,
sondern das von Johann B. Ritter v. Lampi; weitere
Exemplare befinden sich im Ferdinandeum in Inns-
bruck, in der Wiener Akademie und in der Samm-
lung Eißler in Wien. Auch das Architektenbildnis
von Gabriele Beyer in der Sammlung Gutmann
(Taf. XXVII) bedarf der Aufklärung; daß es nicht
das Porträt Josef Emanuel Fischers von Erlach sein
kann, wurde schon in der Kunsttopographie (S. 309 f.)
hervorgehoben, denn Fischer starb 1742 und die
Künstlerin ist erst 1730 geboren. Um welchen Archi-
tekten mag es sich aber handeln? Am nächsten liegt
es, an den Gatten der Künstlerin zu denken, den
kaiserlichen Hofarchitekten und Statuarius Wilhelm
Beyer, dessen Züge uns in einer überaus seltenen
8*