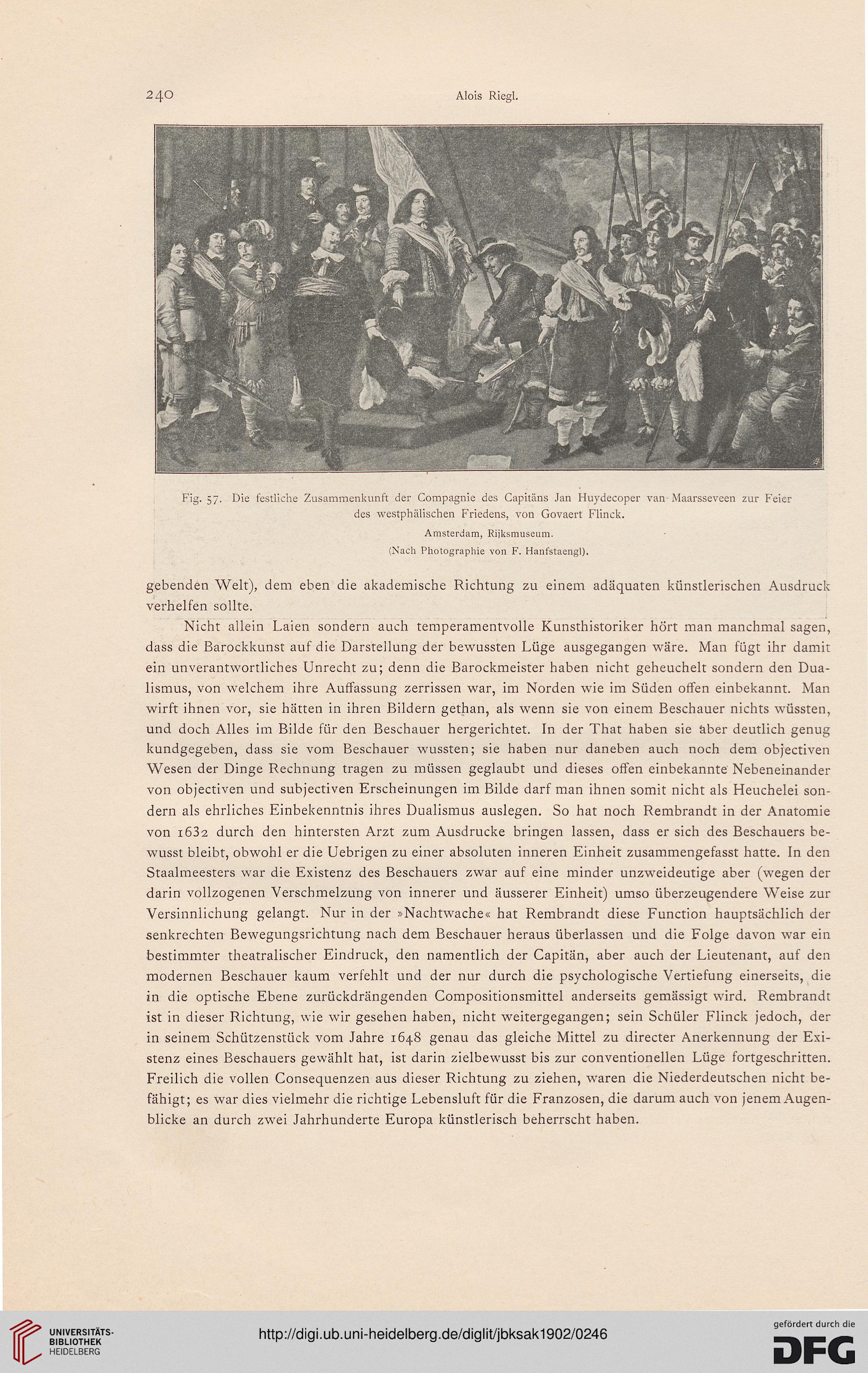240
Alois Riegl.
Fig. 57. Die festliche Zusammenkunft der Compagnie des Capitäns Jan Huydecoper van Maarsseveen zur Feier
des westphälischen Friedens, von Govaert Flinck.
Amsterdam, Rüksmuscum.
(Nach Photographie von F. Hanfstaengl).
gebenden Welt), dem eben die akademische Richtung zu einem adäquaten künstlerischen Ausdruck
verhelfen sollte.
Nicht allein Laien sondern auch temperamentvolle Kunsthistoriker hört man manchmal sagen,
dass die Barockkunst auf die Darstellung der bewussten Lüge ausgegangen wäre. Man fügt ihr damit
ein unverantwortliches Unrecht zu; denn die Barockmeister haben nicht geheuchelt sondern den Dua-
lismus, von welchem ihre Auffassung zerrissen war, im Norden wie im Süden offen einbekannt. Man
wirft ihnen vor, sie hätten in ihren Bildern gethan, als wenn sie von einem Beschauer nichts wüssten,
und doch Alles im Bilde für den Beschauer hergerichtet. In der That haben sie aber deutlich genug
kundgegeben, dass sie vom Beschauer wussten; sie haben nur daneben auch noch dem objectiven
Wesen der Dinge Rechnung tragen zu müssen geglaubt und dieses offen einbekannte Nebeneinander
von objectiven und subjectiven Erscheinungen im Bilde darf man ihnen somit nicht als Heuchelei son-
dern als ehrliches Einbekenntnis ihres Dualismus auslegen. So hat noch Rembrandt in der Anatomie
von i632 durch den hintersten Arzt zum Ausdrucke bringen lassen, dass er sich des Beschauers be-
wusst bleibt, obwohl er die Uebrigen zu einer absoluten inneren Einheit zusammengefasst hatte. In den
Staalmeesters war die Existenz des Beschauers zwar auf eine minder unzweideutige aber (wegen der
darin vollzogenen Verschmelzung von innerer und äusserer Einheit) umso überzeugendere Weise zur
Versinnlichung gelangt. Nur in der »Nachtwache« hat Rembrandt diese Function hauptsächlich der
senkrechten Bewegungsrichtung nach dem Beschauer heraus überlassen und die Folge davon war ein
bestimmter theatralischer Eindruck, den namentlich der Capitän, aber auch der Lieutenant, auf den
modernen Beschauer kaum verfehlt und der nur durch die psychologische Vertiefung einerseits, die
in die optische Ebene zurückdrängenden Compositionsmittel anderseits gemässigt wird. Rembrandt
ist in dieser Richtung, wie wir gesehen haben, nicht weitergegangen; sein Schüler Flinck jedoch, der
in seinem Schützenstück vom Jahre 1648 genau das gleiche Mittel zu directer Anerkennung der Exi-
stenz eines Beschauers gewählt hat, ist darin zielbewusst bis zur conventioneilen Lüge fortgeschritten.
Freilich die vollen Consequenzen aus dieser Richtung zu ziehen, waren die Niederdeutschen nicht be-
fähigt; es war dies vielmehr die richtige Lebensluft für die Franzosen, die darum auch von jenem Augen-
blicke an durch zwei Jahrhunderte Europa künstlerisch beherrscht haben.
Alois Riegl.
Fig. 57. Die festliche Zusammenkunft der Compagnie des Capitäns Jan Huydecoper van Maarsseveen zur Feier
des westphälischen Friedens, von Govaert Flinck.
Amsterdam, Rüksmuscum.
(Nach Photographie von F. Hanfstaengl).
gebenden Welt), dem eben die akademische Richtung zu einem adäquaten künstlerischen Ausdruck
verhelfen sollte.
Nicht allein Laien sondern auch temperamentvolle Kunsthistoriker hört man manchmal sagen,
dass die Barockkunst auf die Darstellung der bewussten Lüge ausgegangen wäre. Man fügt ihr damit
ein unverantwortliches Unrecht zu; denn die Barockmeister haben nicht geheuchelt sondern den Dua-
lismus, von welchem ihre Auffassung zerrissen war, im Norden wie im Süden offen einbekannt. Man
wirft ihnen vor, sie hätten in ihren Bildern gethan, als wenn sie von einem Beschauer nichts wüssten,
und doch Alles im Bilde für den Beschauer hergerichtet. In der That haben sie aber deutlich genug
kundgegeben, dass sie vom Beschauer wussten; sie haben nur daneben auch noch dem objectiven
Wesen der Dinge Rechnung tragen zu müssen geglaubt und dieses offen einbekannte Nebeneinander
von objectiven und subjectiven Erscheinungen im Bilde darf man ihnen somit nicht als Heuchelei son-
dern als ehrliches Einbekenntnis ihres Dualismus auslegen. So hat noch Rembrandt in der Anatomie
von i632 durch den hintersten Arzt zum Ausdrucke bringen lassen, dass er sich des Beschauers be-
wusst bleibt, obwohl er die Uebrigen zu einer absoluten inneren Einheit zusammengefasst hatte. In den
Staalmeesters war die Existenz des Beschauers zwar auf eine minder unzweideutige aber (wegen der
darin vollzogenen Verschmelzung von innerer und äusserer Einheit) umso überzeugendere Weise zur
Versinnlichung gelangt. Nur in der »Nachtwache« hat Rembrandt diese Function hauptsächlich der
senkrechten Bewegungsrichtung nach dem Beschauer heraus überlassen und die Folge davon war ein
bestimmter theatralischer Eindruck, den namentlich der Capitän, aber auch der Lieutenant, auf den
modernen Beschauer kaum verfehlt und der nur durch die psychologische Vertiefung einerseits, die
in die optische Ebene zurückdrängenden Compositionsmittel anderseits gemässigt wird. Rembrandt
ist in dieser Richtung, wie wir gesehen haben, nicht weitergegangen; sein Schüler Flinck jedoch, der
in seinem Schützenstück vom Jahre 1648 genau das gleiche Mittel zu directer Anerkennung der Exi-
stenz eines Beschauers gewählt hat, ist darin zielbewusst bis zur conventioneilen Lüge fortgeschritten.
Freilich die vollen Consequenzen aus dieser Richtung zu ziehen, waren die Niederdeutschen nicht be-
fähigt; es war dies vielmehr die richtige Lebensluft für die Franzosen, die darum auch von jenem Augen-
blicke an durch zwei Jahrhunderte Europa künstlerisch beherrscht haben.