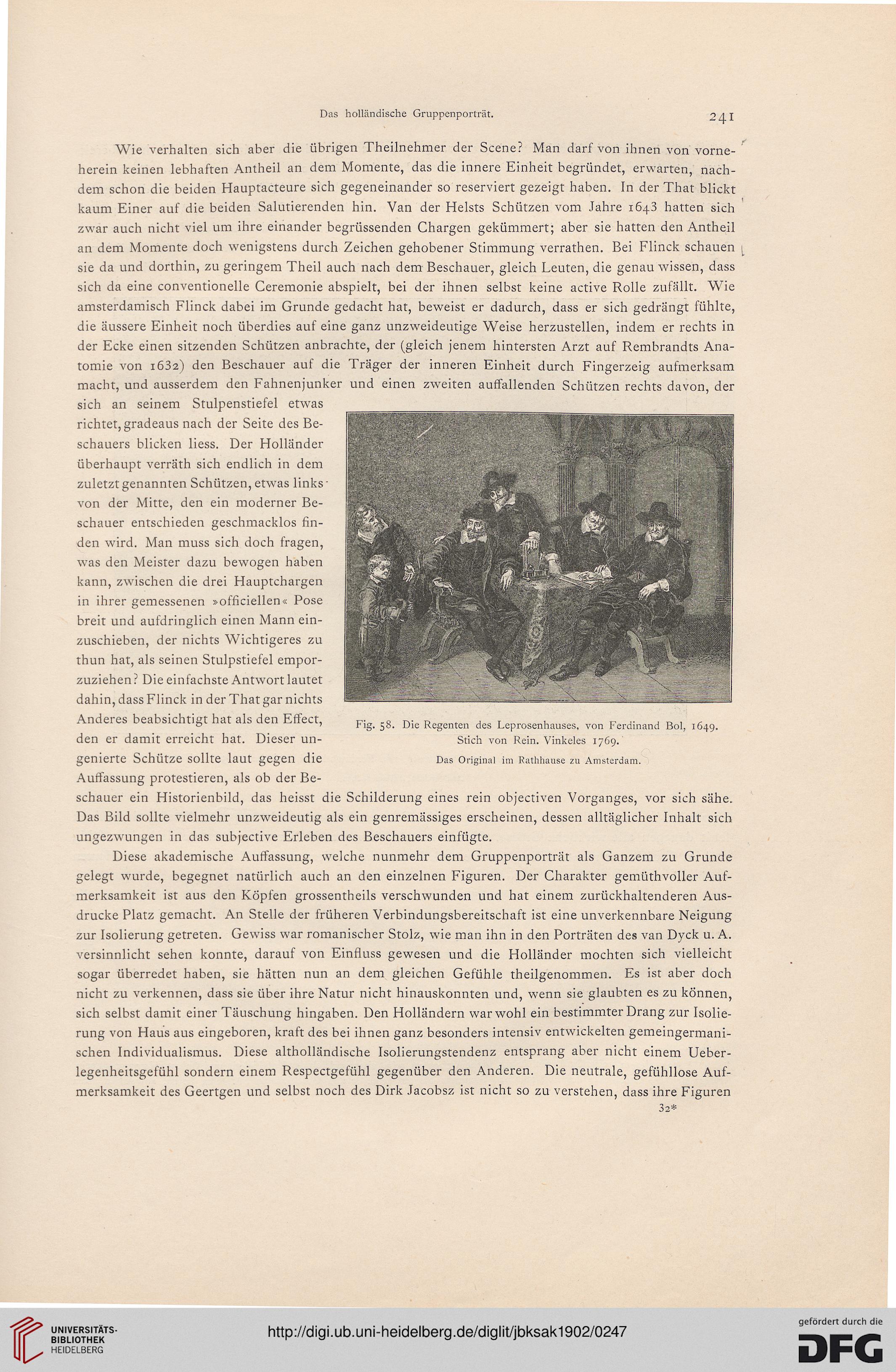Das holländische Gruppenporträt.
24I
Wie verhalten sich aber die übrigen Theilnehmer der Scene? Man darf von ihnen von vorne-
herein keinen lebhaften Antheil an dem Momente, das die innere Einheit begründet, erwarten, nach-
dem schon die beiden Hauptacteure sich gegeneinander so reserviert gezeigt haben. In der That blickt
kaum Einer auf die beiden Salutierenden hin. Van der Heists Schützen vom Jahre 1643 hatten sich
zwar auch nicht viel um ihre einander begrüssenden Chargen gekümmert; aber sie hatten den Antheil
an dem Momente doch wenigstens durch Zeichen gehobener Stimmung verrathen. Bei Flinck schauen >
sie da und dorthin, zu geringem Theil auch nach dem Beschauer, gleich Leuten, die genau wissen, dass
sich da eine conventioneile Ceremonie abspielt, bei der ihnen selbst keine active Rolle zufällt. Wie
amsterdamisch Flinck dabei im Grunde gedacht hat, beweist er dadurch, dass er sich gedrängt fühlte,
die äussere Einheit noch überdies auf eine ganz unzweideutige Weise herzustellen, indem er rechts in
der Ecke einen sitzenden Schützen anbrachte, der (gleich jenem hintersten Arzt auf Rembrandts Ana-
tomie von i632) den Beschauer auf die Träger der inneren Einheit durch Fingerzeig aufmerksam
macht, und ausserdem den Fahnenjunker und einen zweiten auffallenden Schützen rechts davon, der
sich an seinem Stulpenstiefel etwas
richtet, gradeaus nach der Seite des Be-
schauers blicken liess. Der Holländer
überhaupt verräth sich endlich in dem
zuletzt genannten Schützen, etwas links ■
von der Mitte, den ein moderner Be-
schauer entschieden geschmacklos fin-
den wird. Man muss sich doch fragen,
was den Meister dazu bewogen haben
kann, zwischen die drei Hauptchargen
in ihrer gemessenen »officiellen« Pose
breit und aufdringlich einen Mann ein-
zuschieben, der nichts Wichtigeres zu
thun hat, als seinen Stulpstiefel empor-
zuziehen ? Die einfachste Antwort lautet
dahin, dass Flinck in der That gar nichts
Anderes beabsichtigt hat als den Effect,
den er damit erreicht hat. Dieser un-
genierte Schütze sollte laut gegen die
Auffassung protestieren, als ob der Be-
schauer ein Historienbild, das heisst die Schilderung eines rein objectiven Vorganges, vor sich sähe.
Das Bild sollte vielmehr unzweideutig als ein genremässiges erscheinen, dessen alltäglicher Inhalt sich
ungezwungen in das subjective Erleben des Beschauers einfügte.
Diese akademische Auffassung, welche nunmehr dem Gruppenporträt als Ganzem zu Grunde
gelegt wurde, begegnet natürlich auch an den einzelnen Figuren. Der Charakter gemüthvoller Auf-
merksamkeit ist aus den Köpfen grossentheils verschwunden und hat einem zurückhaltenderen Aus-
drucke Platz gemacht. An Stelle der früheren Verbindungsbereitschaft ist eine unverkennbare Neigung
zur Isolierung getreten. Gewiss war romanischer Stolz, wie man ihn in den Porträten des van Dyck u. A.
versinnlicht sehen konnte, darauf von Einfluss gewesen und die Holländer mochten sich vielleicht
sogar überredet haben, sie hätten nun an dem gleichen Gefühle theilgenommen. Es ist aber doch
nicht zu verkennen, dass sie über ihre Natur nicht hinauskonnten und, wenn sie glaubten es zu können,
sich selbst damit einer Täuschung hingaben. Den Holländern war wohl ein bestimmter Drang zur Isolie-
rung von Haus aus eingeboren, kraft des bei ihnen ganz besonders intensiv entwickelten gemeingermani-
schen Individualismus. Diese altholländische Isolierungstendenz entsprang aber nicht einem Ueber-
legenheitsgefühl sondern einem Respectgefühl gegenüber den Anderen. Die neutrale, gefühllose Auf-
merksamkeit des Geertgen und selbst noch des Dirk Jacobsz ist nicht so zu verstehen, dass ihre Figuren
Fig. 58. Die Regenten des Leprosenhauses, von Ferdinand Bol, 1649.
Stich von Rein. Vinkeles 1769.
Das Original im Rathhause zu Amsterdam.
24I
Wie verhalten sich aber die übrigen Theilnehmer der Scene? Man darf von ihnen von vorne-
herein keinen lebhaften Antheil an dem Momente, das die innere Einheit begründet, erwarten, nach-
dem schon die beiden Hauptacteure sich gegeneinander so reserviert gezeigt haben. In der That blickt
kaum Einer auf die beiden Salutierenden hin. Van der Heists Schützen vom Jahre 1643 hatten sich
zwar auch nicht viel um ihre einander begrüssenden Chargen gekümmert; aber sie hatten den Antheil
an dem Momente doch wenigstens durch Zeichen gehobener Stimmung verrathen. Bei Flinck schauen >
sie da und dorthin, zu geringem Theil auch nach dem Beschauer, gleich Leuten, die genau wissen, dass
sich da eine conventioneile Ceremonie abspielt, bei der ihnen selbst keine active Rolle zufällt. Wie
amsterdamisch Flinck dabei im Grunde gedacht hat, beweist er dadurch, dass er sich gedrängt fühlte,
die äussere Einheit noch überdies auf eine ganz unzweideutige Weise herzustellen, indem er rechts in
der Ecke einen sitzenden Schützen anbrachte, der (gleich jenem hintersten Arzt auf Rembrandts Ana-
tomie von i632) den Beschauer auf die Träger der inneren Einheit durch Fingerzeig aufmerksam
macht, und ausserdem den Fahnenjunker und einen zweiten auffallenden Schützen rechts davon, der
sich an seinem Stulpenstiefel etwas
richtet, gradeaus nach der Seite des Be-
schauers blicken liess. Der Holländer
überhaupt verräth sich endlich in dem
zuletzt genannten Schützen, etwas links ■
von der Mitte, den ein moderner Be-
schauer entschieden geschmacklos fin-
den wird. Man muss sich doch fragen,
was den Meister dazu bewogen haben
kann, zwischen die drei Hauptchargen
in ihrer gemessenen »officiellen« Pose
breit und aufdringlich einen Mann ein-
zuschieben, der nichts Wichtigeres zu
thun hat, als seinen Stulpstiefel empor-
zuziehen ? Die einfachste Antwort lautet
dahin, dass Flinck in der That gar nichts
Anderes beabsichtigt hat als den Effect,
den er damit erreicht hat. Dieser un-
genierte Schütze sollte laut gegen die
Auffassung protestieren, als ob der Be-
schauer ein Historienbild, das heisst die Schilderung eines rein objectiven Vorganges, vor sich sähe.
Das Bild sollte vielmehr unzweideutig als ein genremässiges erscheinen, dessen alltäglicher Inhalt sich
ungezwungen in das subjective Erleben des Beschauers einfügte.
Diese akademische Auffassung, welche nunmehr dem Gruppenporträt als Ganzem zu Grunde
gelegt wurde, begegnet natürlich auch an den einzelnen Figuren. Der Charakter gemüthvoller Auf-
merksamkeit ist aus den Köpfen grossentheils verschwunden und hat einem zurückhaltenderen Aus-
drucke Platz gemacht. An Stelle der früheren Verbindungsbereitschaft ist eine unverkennbare Neigung
zur Isolierung getreten. Gewiss war romanischer Stolz, wie man ihn in den Porträten des van Dyck u. A.
versinnlicht sehen konnte, darauf von Einfluss gewesen und die Holländer mochten sich vielleicht
sogar überredet haben, sie hätten nun an dem gleichen Gefühle theilgenommen. Es ist aber doch
nicht zu verkennen, dass sie über ihre Natur nicht hinauskonnten und, wenn sie glaubten es zu können,
sich selbst damit einer Täuschung hingaben. Den Holländern war wohl ein bestimmter Drang zur Isolie-
rung von Haus aus eingeboren, kraft des bei ihnen ganz besonders intensiv entwickelten gemeingermani-
schen Individualismus. Diese altholländische Isolierungstendenz entsprang aber nicht einem Ueber-
legenheitsgefühl sondern einem Respectgefühl gegenüber den Anderen. Die neutrale, gefühllose Auf-
merksamkeit des Geertgen und selbst noch des Dirk Jacobsz ist nicht so zu verstehen, dass ihre Figuren
Fig. 58. Die Regenten des Leprosenhauses, von Ferdinand Bol, 1649.
Stich von Rein. Vinkeles 1769.
Das Original im Rathhause zu Amsterdam.